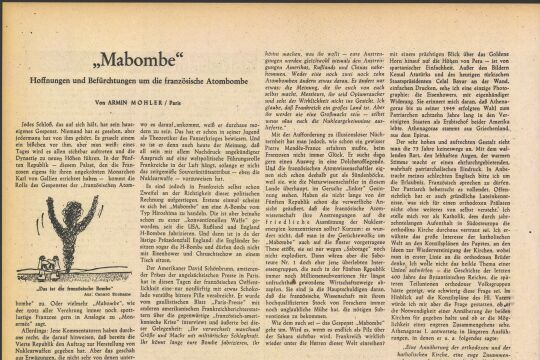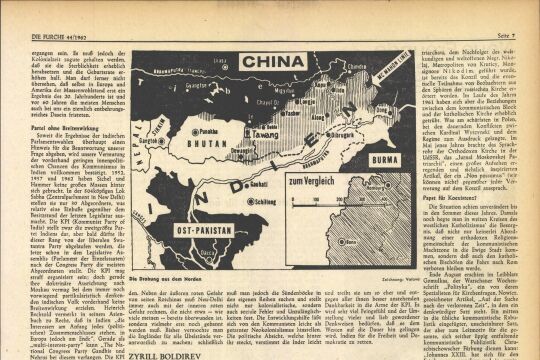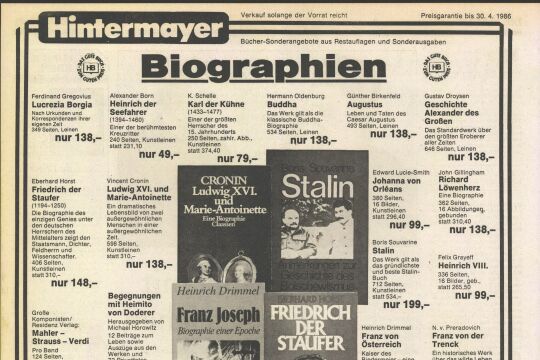Neuanfang nach Chalkedon?
Als im September 1973 Bischöfe und Theologen der altorientalischen Kirchen sich in Wien-Lainz zu inoffiziellen Besprechungen mit katholischen Theologen trafen, war dies ein weiterer Schritt vorwärts auf dem beschwerlichen Weg zu einer Verständigung der beiden Traditionen, die sich über 1500 Jahre lang auseinandergelebt hatten. Den Anfang dieses Gesprächs hatte die Wiener Konsultation von 1971 gesetzt, die ebenfalls der Initiative der ökumenischen Stiftung Pro Oriente und da vor allem der dynamischen Persönlichkeit des im Oktober verstorbenen Mon-signore Otto Mauer zu verdanken war. Bis dahin waren die altorientalischen Kirchen ziemlich am Rande des ökumenischen Interesses gestanden. Nach den vom Weltkirchenrat geförderten Gesprächen zwischen den Altorientalen und den byzantinischen Kirchen von 1964 im dänischen Aarhus war aber die Zeit gekommen, auch mit der lateinischen Kirche die Möglichkeiten einer Wiedervereinigung zu prüfen.
Als im September 1973 Bischöfe und Theologen der altorientalischen Kirchen sich in Wien-Lainz zu inoffiziellen Besprechungen mit katholischen Theologen trafen, war dies ein weiterer Schritt vorwärts auf dem beschwerlichen Weg zu einer Verständigung der beiden Traditionen, die sich über 1500 Jahre lang auseinandergelebt hatten. Den Anfang dieses Gesprächs hatte die Wiener Konsultation von 1971 gesetzt, die ebenfalls der Initiative der ökumenischen Stiftung Pro Oriente und da vor allem der dynamischen Persönlichkeit des im Oktober verstorbenen Mon-signore Otto Mauer zu verdanken war. Bis dahin waren die altorientalischen Kirchen ziemlich am Rande des ökumenischen Interesses gestanden. Nach den vom Weltkirchenrat geförderten Gesprächen zwischen den Altorientalen und den byzantinischen Kirchen von 1964 im dänischen Aarhus war aber die Zeit gekommen, auch mit der lateinischen Kirche die Möglichkeiten einer Wiedervereinigung zu prüfen.
Wann und wie war es überhaupt zu der Trennung gekommen? Das Konzil von Chalkedon im Jahre 451 hatte das christalogische Dogma in einer Weise formuliert, die den Kirchen von Ägypten, Syrien und Armenien nicht annehmbar erschien. Zu dieser Gruppe kamen später die äthiopische Kirche und die syrischorthodoxe Kirche von Indien dazu. Es gab zwar noch einige zaghafte Versuche, doch noch zu einer Einigung zu kommen: diese wurden jedoch von der politischen Entwicklung überrollt; der Islam kam in diesen Ländern zur Herrschaft und isolierte die vorchalkedonensischen Kirchen immer mehr. In wirtschaftlich und politisch oft sehr bedrängter Lage, wegen ihrer relativ kleinen Zahl kaum beachtet, haben diese Kirchen trotzdem die Treue zum christlichen Glauben und zur apostolischen Tradition über die Jahrhunderte hinweg unverbrüchlich bewahrt.
Wenn man sich jetzt um eine Annäherung zueinander bemüht, heißt es, hei 451 einzusetzen. Der Streit ging damals um die nähere Interpretation des Chris'tusglaubens, den das Konzil von Nikaia 325 definiert hatte, daß Christus „eines Wesens mit dem Vater“ ist. Die in der Folgezeit zu klärende Frage war, wie sich Gottheit und Menschheit in Christus zueinander verhalten und welche anthropologischen Konsequenzen die Verbindung von Gottheit und Menschheit in Christus mit sich bringe. Kyrill von Alexandrien prägte die Formel von der „einen fleischgewordenen Natur des Gotteswortes“. Diese Formel erwies sich im Kampf gegen Nestorius, der Gottheit und Menschheit in Jesus radikal trennte, als günstige Verdeutlichung des Dogmas; gleichzeitig aber brachte sie die Gefahr eines Mißverständnisses im Sinn einer Vermischung der Gottheit und der Menschheit Jesu mit sich (wie besonders der Fall des Eutyches und seiner Anhänger zeigte). So kam es in Chalkedon zur Absicherung des christologischen Glaubens zur dogmatischen Formulierung „eine Person (Hypostase) in zwei Naturen“. Die Kyrill anhangenden Kirchen von Ägypten, Syrien und Armenien verstanden dies als Übernahme der Irrlehre des 431 verstorbenen Bischofs Nestorius von Konstantinopel, nach dem Gottheit und Menschheit in Jesus nur durch das Band der Liebe verbunden nebeneinander existierten. Daher sahen sie sich gezwungen, die Entscheidung von Chalkedon abzulehnen. Gleichzeitig aber hatte der Mißbrauch der (an sich orthodoxen) ky-rillianischen Formel diese für den Westen unannehmbar gemacht. Verschiedene ideengeschichtliche Entwicklungen hatten dazu geführt, daß Ost und West sich in der christologischen Terminologie nicht mehr recht verstanden; so kam es zu gegenseitigen Verdächtigungen, Verurteilungen und Anathemen. Die bedrängte Lage der Kirchen, die sich wegen der Formel von Chalkedon von der übrigen Kirche getrennt hatten, führte dann zu ihrer weiteren Isolierung und zur Verhärtung der gegenseitigen Standpunkte. Die Wiener Konsultationen von 1971 und 1973 haben hier zu einer wichtigen Klärung beigetragen. Das am Schluß der Konsultation von 1973 veröffentlichte gemeinsame Kommunique betont die Unzulänglichkeit jedweder Formel und die Unmöglichkeit, das Mysterium Christi in Worten adäquat auszudrücken. „Jede Formel, die erdacht werden kann, bedarf weiterer Auslegung. Wir sahen, daß falsch verstanden werden kann, was eine richtige Formulierung zu sein scheint, und auch, wie hinter einer scheinbar falschen Formulierung ein richtiges Verständnis stehen kann. Wir verstehen, daß unser gemeinsamer Vater in Christus, der hl. Kyrill von Alexandrien, nicht die volle und vollkommene Menschheit Jesu leugnet, wenn er von der einen fleischgewordenen Natur des Gatteswortes spricht. Wir glauben auch, daß das Dekret des Konzils von Chalkedon, richtig verstanden, -trotz des Ausdrucks ,in zwei Naturen' die Einheit der Person und die unauflösliche Vereinigung von Gottheit und Menschheit in Christus bejaht“. Damit hat man sich also gegenseitig die Rechtgläubigkeit in christologischen Fragen zuerkannt, auch wenn man sieht, daß Verstand-nisschwierigkei'ten wegen der verschiedenen Terminologie und der lange getrennten Traditionen weiterbestehen.
War also alles nur ein Mißverständnis? Ist die Kirche ein Opfer ihres Umgangs mit philosophischer Terminologie geworden? Und ist der Weg nun offen für eine sofortige Wiedervereinigung? Leider nein. Zu viele Fragen sind noch offen. Am leichtesten ist da noch die Frage der gegenseitigen Anathemata zu lösen. Verschiedene altorientalische liturgische Texte sprechen noch immer den Bann aus über die Gegner im damaligen Streit (so der armenische Weiheritus über Papst Leo). Auf der Tagung war man sich nicht einig, ob man diese Anathemata so ohne weiteres aufheben könne. Bischof Amba Gregorius von Kairo meinte, die Kirche der Gegenwart habe kein Recht, ein von den Vätern ausgesprochenes Anathem zu revidieren; Papst Leo oder Dioscorus können wir heute nicht mehr absolvieren, sondern nur aufhören, in der Liturgie die Anathemata über Personen der Vergangenheit immer wieder auszusprechen. Einen Präzedenzfall in dieser Richtung gab es ja schon, als man am Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils zwischen Rom und Konstantinopel vereinbarte, nicht die gegenseitigen Anathemata aufzuheben — besonders katholischerseits hatte man dagegen Bedenken —, wohl aber sie aus dem Gedächtnis der Kirche zu löschen. Ähnlich hat auch der äthiopische Patriarch bei seiner Inthronisierung 1971 auf alle Ana-theme verzichtet, sondern einfach zusammen mit den Vertretern der anderen christlichen Kirchen gemeinsam positiv den Glauben bekannt. Hier ist also ein gangbarer Weg vorgezeichnet, mit dem Erbe der Vergangenheit fertig zu werden.
Bedeutend größer jedoch sind die Probleme, die aus den kirchengeschichtlichen Ereignissen der 3500 Jahre der Trennung erwachsen sind. In diesen Jahrhunderten hat die römische Kirche eine Reihe von Konzilien abgehalten, die in ihrem Verständnis ökumenisch und daher auch allgemeinverpflichtend sind; es wurden Dogmen formuliert; der Primatsanspruch des Papstes kristallisierte sich erst jetzt voll heraus; die Unfehlbarkeit des Papstes in Glaubens— und Sittenfragsn wurde als Dogma proklamiert. Kann Rom auf diese Ergebnisse einer geschichtlichen Entwicklung verzichten und noch einmal beim Jahr 451 einsetzen? Oder können die altorientalischen Kirchen auf einen Schlag diese ganze Entwicklung nachholen und sich zu eigen machen? Hier liegen die wesentlichen Schwierigkeiten, die einer Wiedervereinigung entgegenstehan.
Was die nach Chalkedon und noch mehr nach 1054, als sich auch die byzantinischen Kirchen von Rom trennten, abgehaltenen Konzile betrifft, könnte man erwägen, wie Fr. John Long vom römischen Einheitssekretariat vorschlug, die Konzile der lateinischen Kirche, besonders seit dem ersten Lateranum, als Synoden des lateinischen Patriarchats zu betrachten, als Partikularsynoden, die für die Wiedervereinigung nicht bindend anzunehmen wären. Wenn gelegentlich ein Konzil als Weg zu dieser Wiedervereinigung vorgeschlagen wird, müßte man sich zuvor über die Kriterien einigen, welche man von. einem ökumenischen Konzil verlangt. Die formalen Kriterien der katholischen Theologie, mit denen man den ökumenischen Charakter eines Konzils bestimmt, passen genau eigentlich nur auf das Erste Vaticanum. Man könnte diese sicher nicht unbesehen übernehmen. Oder sollte man sich weniger darum kümmern, wie ein solches Konzil a priori ökumenisch und allgemein verpflichtend wird, als vielmehr es der Zukunft überlassen, der Rezeption des Konzils und seiner späteren Auswirkung? Jedenfalls ist derzeit kein Weg zu sehen, wie man ein echt ökumenisches Konzil abhalten könnte.
Wie groß sind dann die Chancen für eine wachsende Annäherung und eventuelle Vereinigung der beiden christlichen Traditionen? Das friedliche Bild ökumenischer Tagungen ist nicht unbedingt repräsentativ für das tatsächliche Verhältnis verschiedener Kirchen zueinander: Die alt-orientalischen Gesprächspartner sind meist fast schon hauptberufliche Reisende in Sachen Ökumene; von einem Kongreß zum anderen unterwegs. Wieweit sie in der Lage sind, den Geist und die Ergebnisse dieser Gespräche auch dem Klerus und dem Volk ihrer Heimatkirchen zu vermitteln, davon wird der eigentliche Erfolg solcher ökumenischer Initiativen abhängen. Katholischerseits ein großes Problem, das auch die künftige Entwicklung belasten könnte, ist die postkonziliare Entwicklung der Theologie: So erfreulich und notwendig dieser theologische Aufbruch innerkirchlich auch sein mag, erschwert er doch den Brückenschlag zum Glaubensverständnis der Altorientalen (und der Ostkirchen ganz allgemein) mit ihrem stark ausgeprägten Konservativismus und Traditionalismus. Man kann nur hoffen, daß das einmal begonnene Gespräch auch weitergeführt wird und auch nach dem Tode von Monsignore Mauer, auf dessen Initiatixe es wesentlich zurückgeht, dieser Elan ökumenischen Bemühens nicht versandet. Die ersten Schritte zumindest sind einmal getan.