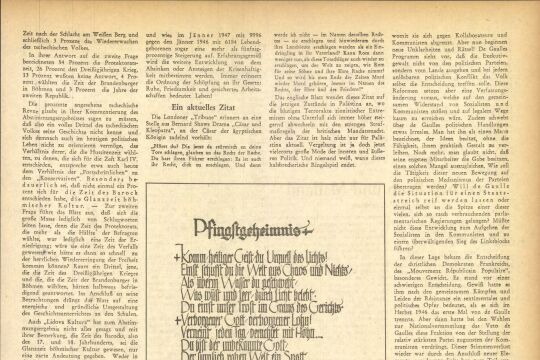Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Nicht Napoleon, nur Louis-Philippe...
Nach jeder Wahl oder Volksbefragung gehört es zu den guten politischen Sitten, die Ergebnisse unter die Lupe zu nehmen und sich mit mehr oder weniger Überzeugung als faktischer Sieger der öffentlichen Meinung vorzustellen. Da werden Referenz-Zahlen angegeben, soziologische Untersuchungen angestellt und die Resultate verglichen, die an sich nichts miteinander zu tun haben. Dieses beliebte Spiel wird auch seit der Nacht des 23. April in Frankreich getrieben. Die Konsequenzen werden abgemessen, die künftighin die Situation des Landes bestimmen. Obwohl ein außenpolitisches Thema zur Frage gestellt war, muß der Ausgang des Referendums unter dem Gesichtspunkt der Einrichtungen der V. Republik und der Parteien verstanden werden. Von den unmittelbaren Folgen und Analysen abgesehen, mögen die weiteren Perspektiven der Entwicklung in den Vordergrund der Diskussion gerückt werden.
Der Schöpfer des Regimes, General de Gaulle, hatte sich in der Verfassung eine Maßuniform geschneidert. Die Stellung des Staatsoberhaupts wurde aufgewertet, mit entfernter Ähnlichkeit zum Höhepunkt der napoleonischen Herrschaft. Mit Recht kann man daher die Epoche von 1958 bis April 1969 als eine „Wahlmonarchie“ bezeichnen. Der ungekrönte Herrscher holte sich in zahlreichen Volksbefragungen über das Parlament hinweg den Konsens seiner Mitbürger. Er verstand es meisterhaft, jedes Referendum zu politisieren, zu dramatisieren und unter die
Parole „ich oder das Chaos“ zu stellen.
Georges Pompidou, der „Adoptiv-kaiser“, glaubte sichtlich, in die Fußstapfen seines illustren Vorgängers zu treten, als er zum ersten Mal nach seiner Machtübernahme von diesem Mittel Gebrauch machen wollte. Der jetzige Amtsträger ist eine vorzügliche Persönlichkeit, ein geschickter Politiker, er vermag jedoch nicht jenes Charisma auszustrahlen, das General de Gaulle zu eigen war. Das direkte Volksplebiszit, Schrecken aller republikanischen Doktrinenhüter, ist keineswegs in das Bewußtsein der Nation als ein unbedingt notwendiges Instrument der Staatsführung eingegangen. Es wird wohl lange Zeit vergehen, bis Frankreich wieder mit einer solchen Frage konfrontiert und damit allgemeine politische Optionen kautionieren wird.
Die Initiative zu dem Vorgehen des 23. April 1972 wurde vom Staatschef persönlich ergriffen. Seine nächsten Ratgeber, einige Minister — unter ihnen der eventuelle Nachfolger Chaban-Delmas', der jetzige Unterrichtsminister Olivier Guichaad — zeigten sich von diesem Plan wenig entzückt. Sie beugten sich aber der hohen Autorität, die laut Verfassung den Staatschef zur zentralen Figur der Innenpolitik emporhebt. Das Regime war bisher auf eine Person abgestellt, die im Elysee-Palast über Gegenwart und Zukunft der Franzosen wachte. Das Referendum sollte diese Position verstärken. Der relative Mißerfolg der Volksbefragung mag die Entwicklung gebremst haben. Der Präsident wird in Zukunft mehr als bisher mit der Arbeit und den Reaktionen des Parlaments zu rechnen haben. Auf den Wahlplakaten konnte der Beobachter die Köpfe von drei Politikern bewundern, die gesammelt, ernst oder stereotyp lächelnd, in diesen morosen Frühling blickten. Es waren die Präsidenten der drei in der Mitte stehenden, europafreundlichen Parteien: der Finanzminister Giscard d'Estaing (unabhängige Republikaner), der Obmann des Zentrums und Bürgermeister von Rouen, Lecanuet, und der wendige J. J. S. S., vulgo Servan-Schreiber, Chef der Radikalsozialisten. Es mag ein Schicksalswink mit dem Zaunpfahl gewesen sein, daß diese Männer, in Temperament und politischem Konzept ähnlich, die Motoren des Wahlkampfes waren. Allerdings folgte die Mitte und die gemäßigte Rechte, die sich aus überzeugten Europäern .zusammensetzt, nicht durchwegs den Parolen ihrer Herolde, sondern flüchtete in die Abstinenz. Die allzu schnelle Verwandlung des früher nationalistischen Teils der Gaullisten in bedingungslose Europäer schien den Mittelklassen etwas suspekt zu sein.
Die gaullistische Sammelpartei UDR hat ihre Stammsitze bewahrt, aber der Auszug der Orthodoxie und der Linksgaullisten ist kaum noch aufzuhalten. Der harte Kern der Anhänger de Gaulles sieht in Georges Pompidou einen ungehorsamen Adoptivsohn. Die Vallons und Ven-droux vergessen nichts und verzeihen nichts. Wie eifrige Mäuse nagen sie am Fundament der Partei. Sie erzeugen eine nicht zu unterschätzende Malaise in den Reihen der treuesten Parteigänger Pompidous. Kann man noch von einer einheitlichen gaullistischen Partei sprechen? Wir wagen, diese Frage mit einem eindeutigen Nein zu beantworten. Die UDR präsentiert sich als eine konservative Gruppe, die — mögen auch historische Vergleiche hinken — ihren jovialen Bürgerkönig gefunden hat. Trotz der Enttäuschung des Referendums bleibt die UDR weiterhin die erste Partei des Landes. Von einer zu großen Absplitterung ist, trotz der Finanzskandale, nichts zu bemerken. Berechnet man nach den gegenwärtigen Wahlgesetzen (Wahl in Bezirken, zwei Wahlgänge) die Chancen der Staatspartei im Licht der Ergebnisse der jetzigen Volksbefragung, so hätte die UDR nur geringe Einbußen an Parlamentssitzen zu erleiden gehabt.
Obwohl die Kommunisten jubeln und ihren größten Sieg seit Gründung der KPF preisen, muß eher von einer Verminderung ihrer Einflußnahme auf die Wähler gesprochen werden. Denn die mehr als 5 Millionen Neinsager rekrutieren sich keineswegs ausschließlich aus begeisterten Kommunisten. Sie wollten vielmehr der Regierung einen Denkzettel geben. Diese Bevölkerungskreise — kleine Kaufleute, Gewerbetreibende und Bauern — sind noch lange keine Marxisten. Die KPF hat mit 17 Prozent der eingeschriebenen Wähler ihre Hauptkampflinie bewahrt, an manchen Orten jedoch an Terrain verloren.
Das Regime wird mit einer anderen Persönlichkeit zu kämpfen haben, die sich als geschicktester Taktiker des Wahlfeldzuges bewährte und deren Erfolge unbestritten sind. Der Erste Sekretär der neuen Sozialistischen Partei, Mitterand, kann die Krönung seiner zähen ideologischen und organisatorischen Arbeit vermelden. Nach dem Tiefpunkt der sozialistischen Partei bei den Präsidentschaftswahlen von 1969 ist das Team Mitterand in der Lage, die linke Mitte zu sammeln und selbst der Jugend ein attraktives Image zu bieten. Die Gespräche zwischen Kommunisten und Sozialisten (Mitterand ist das schwarze Schaf der KPF) dürften in den nächsten Monaten in keiner Weise erleichtert werden, denn Mitterand ist selbstbewußter geworden.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!