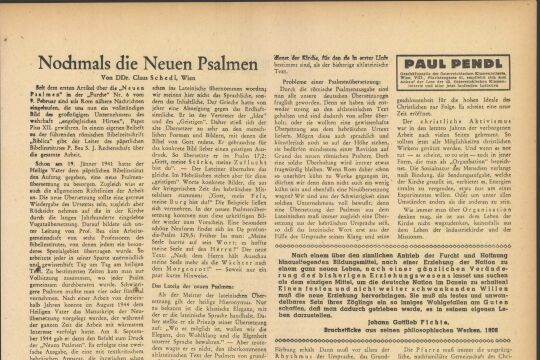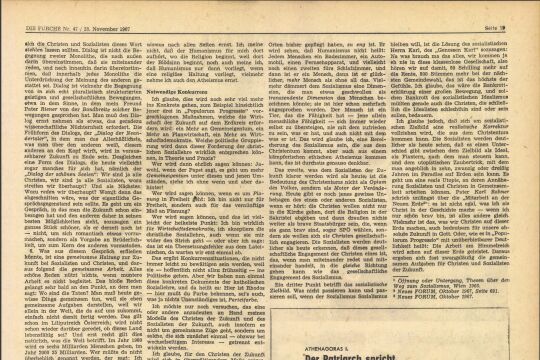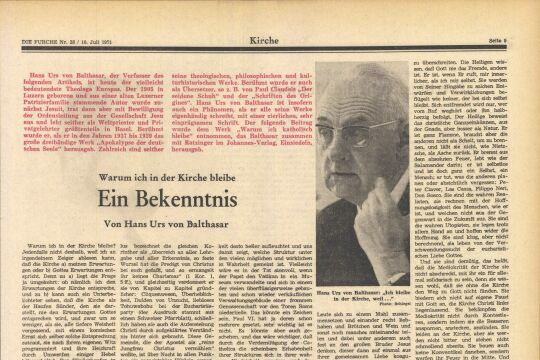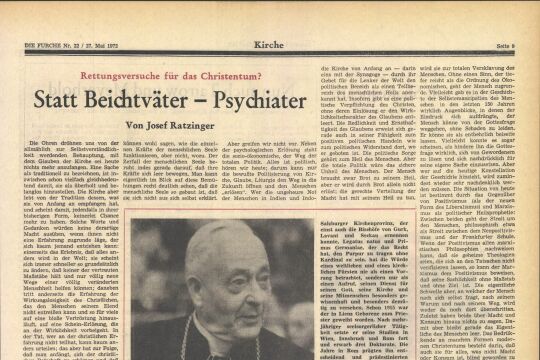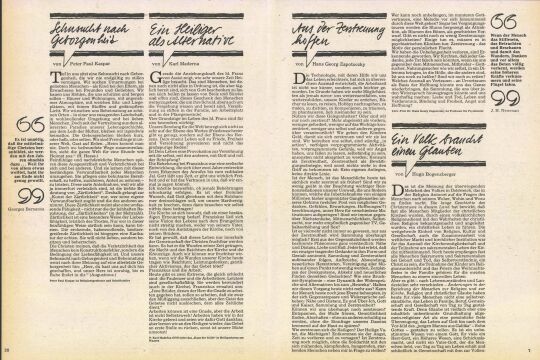Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Nicht nur Hunger nach Brot - auch Hunger nach Liebe
Unermüdlich rufen die Missionswerke Jahr für Jahr zum Sonntag der Weltmission auf. Vielleicht liegt die Versuchung nahe, sich dadurch gar nicht mehr sonderlich bewegen zu lassen: Wie soll man neben dem Tag des Baumes und dem Tag der Milch, dem Weltspartag und gar dem Jahr der Familie oder dem Jahr des Kindes dem Sonntag der Weltmission voll Rechnung tragen?
Aktualität und Brisanz sind gefragt. Aber Mission?
Skeptikern steht außerdem eine ganze Reihe von Argumenten zur Verfügung, die Mission - scheinbar - grundsätzlich vom Tisch zu wischen versuchen.
• Rein zahlenmäßig gerät die Mission, trotz der größten Anstrengungen, mehr und mehr ins Hintertreffen. Die Weltbevölkerung wächst rascher als die Zahl der Christen.
• Auch sonst scheint die Mission vielfach auf verlorenem Posten zu stehen. Missionare werden ausgewiesen, inhaftiert, vielleicht auch da und dort gerade noch geduldet Selbst dort, wo sie sich voll und ganz einsetzen können und ihre Arbeit geschätzt wird, sind ihre Bemühungen wie Wassertropfen auf heiße Steine.
• Das westliche Christentum befindet sich in einer Krise. Wäre es nicht wichtiger, alle verfügbaren Kräfte in der Heimat einzusetzen, um hier die Sache wieder in den Griff zu bekommen?
• Warum soll man überhaupt Menschen, die einen Glauben haben und von ihm überzeugt sind, zum Christentum bekehren wollen? Sind nicht oft genug Entwurzelung, Verunsicherung, ja der Zusammensturz ganzer Gesellschaftsordnungen Folgen missionarischer Bemühungen? Wäre es nicht wirklich besser, zu versuchen, aus Hindus bessere Hindus, aus Mos- lim bessere Moslim zu machen, oder sie ganz in Ruhe zu lassen?
• Sollten wir nicht außerdem zunächst einmal energisch versuchen, der Not Herr zu werden, bevor wir überhaupt an Verkündigung und Mission denken?
Wahrscheinlich wird das Bild und das Verständnis, das man von „Kirche” hat, nirgends so hart getestet, wie wenn es mit Mission konfrontiert wird.
EinAuto ist für jeden einBegriff. Ein Auto hat man zum Fahren. Das klingt sehr simpel, ist jedoch gar nicht so selbstverständlich. Wohin man fahrt, wie man fährt - wie komfortabel oder nicht, wie umständlich oder zielstrebig -, das ist bereits ein anderes Paar Schuhe; wesentlich ist, daß man fahren kann. Wesentlich gehört also ein Motor zum Auto. Bei einem Auto ohne Motor könnte man zwar noch immer die Reifen pflegen, man könnte die Sitze neu polstern, die Karosserie frisch lackieren lassen, man kann unter Umständen sogar im Auto wohnen, sich installieren, meinetwegen eine Bar einrichten - nur fahren kann man nicht. So „daneben” wie ein Auto ohne Motor wäre eine Kirche ohne Mission. Das Konzil hat dafür mehrfach die lapidare Formel verwendet: „Die Kirche ist ihrem Wesen nach missionarisch.”
Um ihrem Wesen zu entsprechen, um das sein zu können, was sie sein muß, braucht die Kirche die Mission.
Wir brauchen ‘die Mission.
Wie das Auto den Motor braucht.
Jede kirchliche’ Initiative oder Sektion, die Selbstzweck bliebe, ginge in die Binsen.
Mission ist nicht Religionsvergleich- mit dem Ergebnis etwa, daß das Christentum die beste aller Religionen sei und deshalb als Norm für alle Menschen zu gelten habe; Mission ist auch nicht das Hobby einiger Superchristen, sondern Wesensaufgabe der Kirche überall dort, wo es sie gibt.
Heute leben Christen und Nichtchristen auf engstem Raum nebeneinander, in den „christlichen” Ländern ebenso wie in den Missionsländern. Überall lebt die Kirche vom Dasein für die andern, vom Dialog, vom Wahrnehmen der Aufgaben rundherum, von der Auseinandersetzung mit denen, die nicht, nicht mehr, noch nicht glauben.
Der Dialog hat dazu geführt, daß Mission nicht mehr im Einbahnverkehr geschehen kann, sondern mit „Gegenverkehr” zu rechnen hat. Nicht mehr ein überhebliches Sendungsbewußtsein steht irp Vordergrund, sondern das Bewußtsein, daß auch bei Nichtchristen und bei Nicht-Glaubenden Gutes und Wahres anzutreffen ist, und daß die Überzeugung und das Gewissen eines Menschen und einer Gesellschaft in jedem Fall Respekt und Ehrfurcht verlangen. Am Horizont der Mission lassen sich Antworten auf die Fragen, die uns (im innerkirchlichen Raum) bewegen, leichter und richtiger finden. Aus der Praxis und Erfahrung der jungen Kirchen lassen sich Orientierungen finden, Wesentliches und Unwesentliches auseinanderzuhalten - kulturell und historisch Bedingtes aus dem Geflecht unseres Glaubens- und Kirchenverständnisses herauszulösen.
Mission zwingt uns dazu, mit häuslichen Zwistigkeiten aufzuräumen, ökumenisch zu denken und zu handeln, bescheiden, tolerant und verträglich zu werden.
Es geht nicht in erster Linie darum, „Seelen zu retten”, die sonst verlorengingen, sondern Menschen, die auf dem Weg sind, die Botschaft von Jesus Christus anzubieten, und das Glück, das in ihr verborgen liegt, mit ihnen zu teilen.
Das Glaubenszeugnis in vielen nicht-westlichen Ländern sieht sich fast durchwegs mit Unterentwicklung, Armut, Analphabetentum, Elend und Hunger konfrontiert. Es bliebe unglaubwürdig und unwesentlich, würde es sich nicht auch als ein Zeugnis der brüderlichen Hilfe erweisen, das den Menschen mit all seinen Fragen und Nöten ernst nimmt.
Denn der Mensch hat Hunger nach Brot - und Hunger nach Liebe. Er fragt nach einem gerechten Lohn - und nach dem Sinn des Lebens.
Manchmal ist es wichtiger, die Not zu teilen, als das Brot. Einen Menschen neben sich zu haben, der aus einer inneren Kraft heraus das Leben meistert, so wie es ist.
Einen Menschen neben sich zu haben, der einen ernst nimmt, ob man nun nichts zu essen hat, oder ob man Antwort auf letzte Fragen sucht, die nun einmal das Leben bewegen.
Genau das ist Mission. Nicht vor- übergeh’n, sondern hinschau’n, aufmerksam werden. Sagen und zeigen, daß es Christus gibt, und deshalb Verantwortung und Liebe zwischen den Menschen. Dafür gibt es Kirche. Darin wird sie sie selbst.
Die Botschaft, die die Missionare zu verkünden haben, heißt wahrlich nicht, „alles haben und noch mehr haben wollen”; sondern „du bist bei mir aufgehoben, weil es Christus gibt”.
Sonst kommt es zu einem ähnlichen Zustand, wie ihn ein Gastarbeiter einmal in kurzen Worten beschrieben hat. Er sagte von den Menschen in dem Lande, in dem er arbeitete: „Viel arbeiten, viel essen, viel traurig.”
Nein. Schon das Angebot des Evangeliums kann eine echte Hilfe sein; vielleicht sogar die beste Voraussetzung für eine tatsächliche und wirksame Entwicklung. So hat eine Laienmissionarin in Mexikp nicht damit begonnen, bei den Tseltal-Indianern Brunnen zu graben und Versuchsfelder anzulegen, um ihre Ernährung zu verbessern. Als sie ihre Arbeit bei diesem Stamm vor 15 Jahren begann, richtete sie zunächst ihr Hauptaugenmerk auf die Ausbildung einheimischer Katecheten. Heute sind diese jungen Männer in der Lage, ihren Dorfgemeinschaften nicht nur am Sonntag das Evangelium zu erklären, sondern sie haben es auch fertiggebracht, so viel Verantwortungs- , bewußtsein und Zusammengehörigkeitsgefühl in den Siedlungen zu wek- ken, daß es seit mehreren Jahren auch möglich und sinnvoll ist, gemeinsame Aktionen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse zu setzen. Und wenn ein Dorf wieder so weit ist, daß ein neuer Brunnen eingeweiht werden kann, dann kommt der Priester, um das Fest mit ihnen zu feiern. Das Wasser ist eine Wohltat, ein Geschenk, das allen Freude macht - aber genauso ein Symbol für das, was Gott an den Menschen tut. Und der Dorfbrunnen wird zum Zeichen der Zusammengehörigkeit, wo es keinen Streit geben soll, sondern gegenseitiges Helfen…
Technische und materielle Hilfe müssen sein. Spenden müssen sein. Aber sie können auch zum Alibi, zur großen Versuchung werden. Ihre Überbetonung kann zu jener Schizophrenie führen, die wohl noch bereit ist, einen Scheck auszufüllen, persönliches Engagement jeder Art jedoch entrüstet ablehnt.
Auch das Geld, das man nur zu gern im unmittelbaren Zusammenhang mit der „Mission” sieht, hat zwei Seiten. Es kann auch in der Mission falsch eingesetzt werden. Es kann - wenn es unüberlegt in Missionskirchen gepumpt wird - den Eifer und die eigenen Anstrengungen lähmen und in ständiger Abhängigkeit erhalten. Es kann Streit und Eifersucht verursachen, wenn es ungerecht und einseitig verteilt wird. Es kann aber auch die entscheidende und notwendige Hilfe darstellen, die etwa jungen Menschen eine Ausbildung erlaubt, die sie befähigt, ihre Landsleute zu größerer Unabhängigkeit, Reife und Freiheit zu führen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!