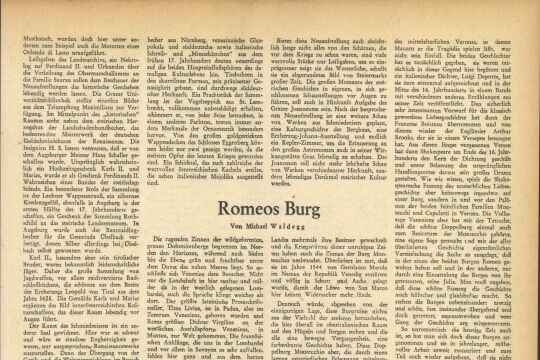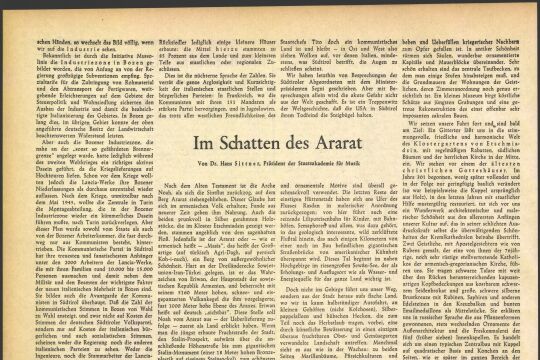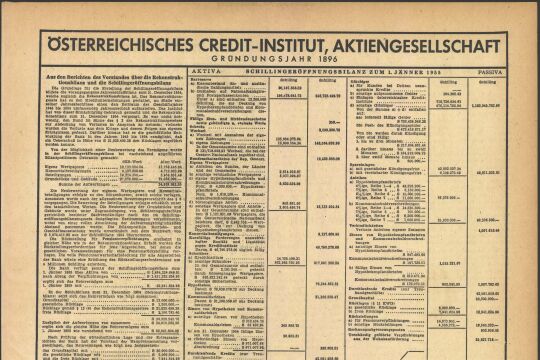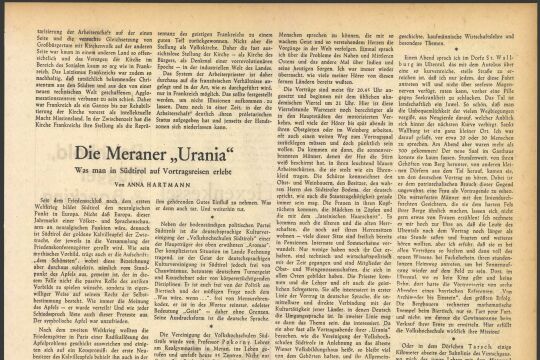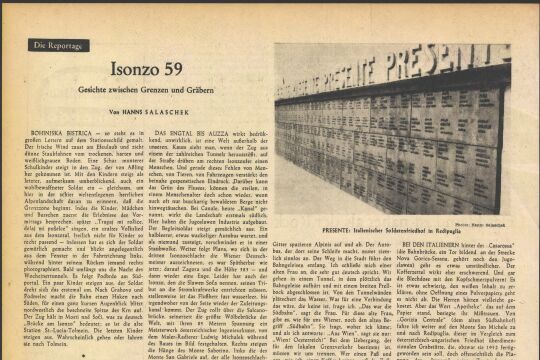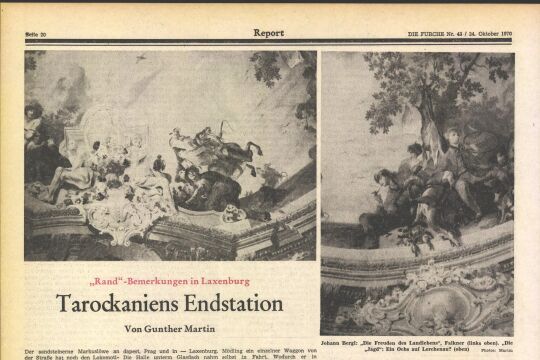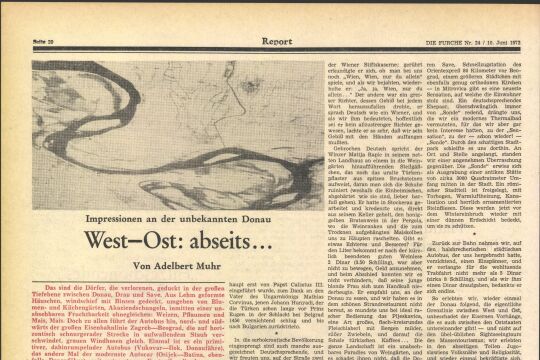Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Österreich ist unsere alte Mutter”
Noch vor einigen Jahren konnte der Durchschnittsbürger mit dem Begriff „Friaul” kaum etwas anfangen. Und seit 1976 assoziiert man automatisch „Erdbeben”, eine Naturkatastrophe, die deshalb so stark in das Bewußtsein der Öffentlichkeit gedrungen ist, weil sie nicht tausende Kilometer entfernt, sondern knapp zwei Autostunden von der österreichischen Grenze stattgefunden hat. Ansonsten ist diese Landschaft Dekoration für eine nicht allzu bequeme Autostraße, die einen in die Zentren des italienischen Massentourismus führt. Bestenfalls gibt es für die Bewohner grenznahen Gebietes noch die Möglichkeit, Schuhe oder Lederwaren billig zu erstehen, in Udine oder in den gesichtslosen Supermärkten, die wie spätkapitalistisches Unkraut neben den Erdbebenruinen aus dem Boden schossen.
Noch vor einigen Jahren konnte der Durchschnittsbürger mit dem Begriff „Friaul” kaum etwas anfangen. Und seit 1976 assoziiert man automatisch „Erdbeben”, eine Naturkatastrophe, die deshalb so stark in das Bewußtsein der Öffentlichkeit gedrungen ist, weil sie nicht tausende Kilometer entfernt, sondern knapp zwei Autostunden von der österreichischen Grenze stattgefunden hat. Ansonsten ist diese Landschaft Dekoration für eine nicht allzu bequeme Autostraße, die einen in die Zentren des italienischen Massentourismus führt. Bestenfalls gibt es für die Bewohner grenznahen Gebietes noch die Möglichkeit, Schuhe oder Lederwaren billig zu erstehen, in Udine oder in den gesichtslosen Supermärkten, die wie spätkapitalistisches Unkraut neben den Erdbebenruinen aus dem Boden schossen.
Aber das Friaul ist mehr als ein Schlachtfeld der Natur oder Ziel für Billigtrips. Es ist ein uns Österreichern sehr verwandtes Land, eine einsame und verschlafene Kulturlandschaft, ein unbekannter, vielleicht etwas verarmter Vetter.
Wenn man sich die Mühe macht und dieses Land kreuz und quer durchstreift, so entdeckt man viele versteckte Kostbarkeiten und Kuriositäten, Relikte aus langobardischer, frühchristlicher, venezianischer oder österreichischer Zeit.
Görz ist die ehemalige österreichische Provinzhauptstadt immer noch anzumerken, wenn es auch durch seine heutige politische und geographische Situation das Flair eines „Nizza austriaca” längst verloren hat. Die Architektur der Gründerzeit prägt das äußere Bild der heute geteilten Stadt, aber die Eleganz der Jahrhundertwende kann man nur noch erahnen. Billigware für jugoslawische Grenzgänger in den Auslagen und das Fehlen einer gesunden Infrastruktur sind für Görz heute charakteristisch.
„Chiuso per ferie” ist auf den meisten Geschäften und Bars zu lesen, sofern ihre Besitzer die Rollbalken nicht schon für immer heruntergezogen haben. Dem Wirt der „Trattoria alla fortūna” scheint das Glück abhold gewesen zu sein, denn in dieser Trattoria ist schon lange niemand mehr zu Gast gewesen.
Für manche Görzer ist die Zeit aber stehengeblieben. So bietet eine alte Gemischtwarenhändlerin, deren Geschäft ein paar Meter vom Schlagbaum entfernt liegt, Ansichtskarten feil, auf denen der auf jugoslawischer Seite liegende alte Görzer Bahnhof - mit Stacheldrahtzaun - zu sehen ist. Text auf der Rückseite: „Confine prowisorio Italia - Jugoslavia”.
Auch im Palazzo des Grafen Coro- nini fühle ich mich zumindest um ein paar Jahrzehnte zurückversetzt. Nach längerem Betätigen des Türklopfers öffnet die Haushälterin - ein weiblicher Quasimodo - und fuhrt mich in die Bibliothek mit offenem Kamin, speckige Lederfauteuils, illuminierten Schreinen mit Heiligenbildern sowie Jünglings- und Jungfrauentorsi und zahllosen in Braun und Gold gebundenen Büchern.
Der Herr des Hauses ist überaus freundlich, aber fotografieren läßt er sich nicht. Nur eine seiner Doggen, die hinter einem Barockgitter Männchen macht, darf als Kuriosum aufs Zelloloid gebannt werden. Auch möge man davon Abstand nehmen, seine Lieblingsstatue im Park des Palazzo zu fotografieren.
Wesentlich freizügiger ist man in Soleschiano bei Manzano, wo ein geschäftstüchtiger Conte den Wirtschaftstrakt seiner „Villa veneta” in ein Hotel umgewandelt hat und in einem aufwendigen Prospekt exklusive Reitferien anbietet. Gern zeigt er das Schloß fremden Gästen und auch seine afrikanische Frau läßt sich durch die Besucher nicht vom Stillen ihres Babys abbringen.
Doch im Allgemeinen gelingt es selten, in einen der Herrschaftssitze vorzudringen, die meisten scheinen unbewohnt, wie die reizvolle Villa At- tems in Aiello, wo keiner der Eingänge darauf hindeutet, in den letzten zwanzig Jahren jemals benützt worden zu sein. Um so mehr wundere ich mich dann, daß die Besitzerin nach etwa halbstündigen hartnäckigen Klopfen knarrend das Haupttor öffnet.
In Tapogliano ist fotografieren von vornherein unerwünscht, aus Angst vor Kunstdiebstählen, heißt es. Dennoch werden dem Gast gerne die museal anmutenden Räume des Schlo- ßes gezeigt, wo keine verirrte Geschmacklosigkeit oder ein zufällig herumliegender Gegenstand des täglichen Gebrauchs darauf hindeuten, daß hier immerhin eine vierköpfige Familie wohnt.
Versteckt und wie ausgestorben wirken auch die Dörfer im Friaul. Pavia di Udine ist so ein verstecktes Dorf. Wie in fast allen Orten ist der Mittelpunkt eine „Villa”. Auch hier keine Spur von Leben, die Holzläden sind geschlossen und der Hinweis auf einen scharfen Hund gehört der Vergangenheit an. Eine Kapelle mit prachtvollen Außenfresken ist durch Verkehrsschilder verunstaltet, und in der „Osteria alla speranza” denkt man eher an das Gegenteil.
Sofern man das Glück hat, den einen oder anderen Bewohner dieser Dörfer zu Gesicht zu bekommen, wird man freundlichst empfangen und mit dem Fotografieren gibt es keine Probleme. Ein Großvater posiert mit seinem Enkel und ein zahnloser Schilfschneider lächelt bereitwillig in die Kamera.
Ganz anders ist das in den Kami- schen Alpen. Dort scheint man als Fremder nicht willkommen zu sein. Ein Hotelzimmer in Tolmezzo zu finden, ist fast unmöglich. Ein Schild „Hier spricht man deutsch” an einem abbruchreifen Albergo mit Jugendstilbalkon erinnert daran, daß dieser Ort noch vor ein paar Jahren beliebtes Ziel vieler Touristen war. Fremdenverkehr und jahrhundertealte Bräuche sind hier dem Erdbeben zum Opfer gefallen. Auch das berühmte „Museo Camico” mit seinen einzigartigen ethnologischen Sammlungen wird seine Pforten nicht so bald wieder öffnen.
In den Gebieten, die vom Erdbeben verschont geblieben sind, hat sich in den letzten Jahrzehnten allerdings kaum etwas geändert, wie die Abbildungen in dem kürzlich erschienen Bildband „Friuli ieri e oggi” beweisen, wo heutige Ansichten aus den Dörfern des Friaul Postkarten der Jahrhundertwende gegenübergestellt werden. Der Unterschied ist minimal.
Aber das Friaul ist nicht nur ein Land der ausgestorbenen Dörfer und verlassenen Villen. Cividale, das römische Forum Iulii, das dem Friaul seinen Namen gab, hat zwar seine Vormachtstellung unter den Städten Oberitaliens schon im Mittelalter verloren, gehört aber neben dem „deutschen” Pordenone und dem „venezischen” Palmanova zu den interessantesten Städten dieses Landes. Das Außergewöhnliche an dieserStadt ist ihr geschlossener, uxbaner Bereich mit dem langobardischen Dom als beherrschendes Zentrum.
„Civitas Austriae”, wie es zur Zeit der fränkischen Markgrafen hieß, wird seinem alten Namen auch im Stadtwappen gerecht. Der österreichische Bindenschild ziert den Eingang zum Municipio und die Helme der Verkehrspolizisten. Im Stadtmuseum ist die Urkunde zu besichtigen, in der Kaiser Ferdinand I. dieses rot-weiß-rote Wappen ausdrücklich bestätigt.
War Cividale eines der politischen Zentren des Friaul, so ist Aquileia, einst Sitz eines mächtigen Patriarchen, nach wie vor religiöses Zentrum des friulanischen Volkes, und der Ort, der noch den meisten Italienurlaubem ein Begriff ist, da er eine der bedeutendsten frühchristlichen Basiliken besitzt und obendrein nicht weit von Grado entfernt liegt.
Grado, zu österreichischer Zeit eine beliebte Sommerfrische, ist heute ein Alptraum an Massentourismus. Gerade deshalb hält man es nicht für möglich, daß diese Stadt ein vollkommen intaktes historisches Zentrum mit bezaubernden verwinkelten Gäßchen und Steinhäusern besitzt.
Die Bedeutung all dieser Städte ist längst Geschichte geworden. Udine ist heute die de-facto-Hauptstadt der Region. Kann Görz seinen österreichischen Einfluß nicht verleugnen, so gilt dasselbe für das venezianische Element in Udine. Die „Piazza Liber- ta” der Provinzhauptstadt soll bekanntlich der venezianischste Platz außerhalb Venedigs sein. Venezianisch ist auch die „Villa Manin” in Passariano, das „Versailles Friauls” und Sitz des letzten Dogen Lodovico Manin.
So vereinigt sich in diesem Land Bodenständiges mit Venezianischem und österreichischem. Aber auch Zeugen für ein tragisches Kapitel der jüngeren Geschichte Europas kann man genug finden. Etwa Redipuglia, einem kleinen Ort in der Nähe von Monfalcone. Genauer gesagt, besteht dieser Ort eigentlich nur aus einem von zwei Granaten flankierten stufenförmig angelegten Kriegerdenk mal von geradezu sowjetischen Ausmaßen. Den italienischen Gefallenen des Ersten Weltkrieges wird hier in patriotischen Aussprüchen gedacht, die, ins Deutsche übersetzt, viel von ihrer Theatralik verlieren würden.
Neben diesem kalten vaterländischen Prunk nimmt sich der ein paar Kilometer entfernt liegende österreichisch-ungarische Soldatenfriedhof, wie ein verträumter Dorfanger aus. Eine bescheidene Tafel verkündet: „7000 unbekannte Helden des österreichisch-ungarischen Heeres fürs Vaterland gefallen. Italiens Bruderliebe hat sie hier vereint bestattet”. Am Gitter des Eingangs steckt eine verwelkte Blume als anonymer Gruß.
Daß die Einwohner der „veccie province” ihre unbekannten Helden niöht ganz vergessen hab’en, davon konnte man sich heuer in Giassico bei Cormons überzeugen. Dieser kleine Weinort nahe der ehemaligen österreichisch-italienischen Grenze ist seit 1975 alljährlich am 18. August Schauplatz eines Festes zum Geburtstag Kaiser Franz Josefs. Dieses Jahr wurde ich jedoch Zeuge einer kleinen Sensation.
Zum ersten Mal seit sechzig Jahren wurde auf italienischem Boden eine Messe für die gefallenen Angehörigen der k. u. k. Armee zelebriert. Der Gottesdienst wird teils in italienischer, teils in friulanischer Sprache abgehalten, ein Männerchor singt friulanische Kirchenlieder und am Schluß der Feier singen die zahlreich erschienen Gläubigen die alte Haydn-Hymne auf italienisch, aber auch etliche slowenische Worte kann ich zwischendurch vernehmen.
Die Bewohner dieses Schmelztiegels verschiedener Völker und Kulturen sind in den letzten Jahren bewußter geworden, verwenden ihre Sprache mehr denn je und in den Auslagen der Buchhandlungen größerer Städte sieht man fast nur „Friulana”. Sogar ein friulanischer Comicstrip ä la Asterix kam kürzlich auf den Markt.
Der friedliche Protest gegen den italienischen Staat nimmt zu. Auf Plakaten wird die Errichtung einer eigenen friulanischen Universität gefordert, Wandparolen wie ,-,Friül li- bar” sind immer häufiger zu lesen und Nationalisten übermalten auf allen Ortstafeln der Provinzhauptstadt das „e”, so daß die friulanische Bezeichnung „Udin” übrigblieb. Ortstafelkonflikt einmal anders.
Friaul, die versteckte Kulturlandschaft vor unserer Haustür, hat viel mit uns gemeinsam. Ein friulanischer Kommunalpolitiker sagte einmal: „Österreich ist unsere alte Mutter, die ihre Kinder nicht vergessen sollte.”
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!