
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ohne Utopie kann Berlin nicht leben
Eine Touristenschar an der Mauer, die eine Stadt durchschneidet. Man steht auf einem Podest aus Stahlrohren mit einem kräftigen Holzboden, hoch genug, um das Bauwerk in doppelter Ausfertigung zu überblicken, dazwischen in den Boden gerammte, zusammengeschweißte T-Träger und säuberlich geharktes Erdreich, das beim Betreten explodiert. Die Fotoapparate klicken.
Ein kleiner Geländewagen mit offenem Verdeck schaukelt über die Bodenwellen auf dem Asphaltweg zwischen den Mauerstücken. „Nein Rus
sen sind das nicht. Die sehen nur so aus." Am Beobachtungsturm eine Gruppe in braunem Drillich, die Maschinenpistolen über die Schulter. Einer hat eine Thermosflasche in der Hand. Er gießt in einen roten Becher und prostet herüber.
Ob es denn hier auch Tote gegeben habe? Der Fremdenführer zeigt auf die Kreuze innerhalb des Podests auf der Westberliner Seite. Ja, ja, die kenne man aus dem Fernsehen. Die seien ja alt. Nein, jetzt? Nein, jetzt nicht mehr.
Am nächsten Tag auf der anderen Seite der Mauer. Der Alte unter dem Schild „Volkssolidarität-Feierabendheim“ schaut auf das Podest, auf dem sich wieder eine Menge drängelt. Der Volkspolizist hinter dem Gitter vor der Mauer beachtet uns nicht. „Wie im Zoo. Ich frage mir nur, wenn ick det so sehe, wer nu die Affen sind?“ Er wohnt „direkt über dem Ding.“
Ob hier in der Gegend unmittelbar an der Mauer nicht nur Hundertprozentige wohnen dürften? „Hier könn
te nur een hundertprozentiger Idiot versuchen, rüber zu machen. Wenn er will, dann sucht der sich schon wat anders aus. Nee, Hundertprozentige sind hier selten.“
Der Erfrischungskiosk unterhalb des großen Mauerpodests in der Ber- nauer Straße. Der junge Mann hinter dem Tresen ist zwanzig Jahre alt. Früher war er Verkäufer von Eis, Würstchen, Kaffee, Bier, Limonade am Potsdamer Platz. „Da war mehr los.“ Seitdem die DDR auf der Ostseite der Straße die zugemauerten Häuser abrasiert habe, kämen immer weniger Touristen.
„Hier gibt es nicht mehr genug zu sehen.“ Nur noch ein paar Kreuze für die, die nach West-Berlin sprangen, als nach dem 13. August 1961 Volkspolizisten die Wohnungen räumten. Sie verfehlten das Sprungtuch.
Auf den an Stelle der Bernauer Straße gesetzten Betonwall haben Kinder einen grünen Baum gemalt. Ein stadtbekannter Kranker war auch hier mit der Sprühdose tätig, seine Sprüche los zu werden. Vor Jahren wurde er einmal vor Gericht gestellt. Wegen Sachbeschädigung. Das Verfahren wurde eingestellt. Wegen Unzurechnungsfähigkeit. Und so ist er weiter unterwegs entlang der Mauer. Nirgends Findet er soviel Fläche, sich auszudrücken. Mauer-Therapie.
Statistik: Bis zum 31. August 1961 80 Straßenübergänge zwischen Ost- und West-Berlin. Nachbarschaft und Zusammenleben funktionierten, weil Trennung nur auf dem Papier stand und jederzeit überwindbar war. 12.000 Westberliner arbeiteten in Ost- Berlin, 53.000 Ostberliner schafften im Westen.
In einem Jahr wurden zehn Millionen Kinokarten gegen Vorzeigen des DDR-Personalausweises in West-Berlin verbilligt verkauft. 60.000 kamen zu Theater-, Opern- und Operetten
aufführungen, 85.000 zu Konzerten, die Freie Volksbühne hatte 25.000 Mitglieder in Ost-Berlin. Die Kinder, die im Ostteil der Stadt wohnten, durften auf Westberliner Schulen gehen.
Der Hauptstrang für die Verbindungen zwischen Ost und West war die S-Bahn, betrieben von der DDR. Nach dem 13. August 1961 erklärte Willy Brandt: „Es ist unzumutbar, daß die West-Geldeinnahmen für den Einkauf von Stacheldraht verwendet werden, durch den man die Familien trennt.“
Gleichentags rief der Deutsche Gewerkschaftsbund in West-Berlin zum Boykott auf. Posten vor den Bahnhöfen brandmarkten Passagiere und Personal: „Kein Pfennig für Olbricht.“
20 Pfennig kostete die Fahrt. Die Westberliner Verkehrsgesellschaft verlangte fünf für Bus und U-Bahn. Minderbemittelte, die zu rechnen hatten, wären gerne bei der S-Bahn geblieben. Aber sie trauten sich nicht mehr. Statt Spießruten zu laufen, stiegen auch sie auf die Busse um. Davon hat sich die S-Bahn nicht mehr erholt.
Eine Touristengruppe visitiert die Mauer. Unter ihnen sind zwei Blinde. Ihnen wird geschildert, was zu sehen ist. Die beiden Blinden wollen die Schilderung fühlen, und sie berühren mit den Händen das Mauerwerk. In diesem Augenblick haben sie plötzlich das Augenlicht wieder.
Das Wunderbare spricht sich in Windeseile herum. Es ist eine Sensation. Weltweit. Gebrechliche rund um den Globus machen sich auf den Weg nach West-Berlin. Hoffnung auf Heilung bringt überbesetzte Züge und total ausgebuchte Flüge. Die Beherber
gungsstätten sind dem Ansturm nicht gewachsen. Entlang der Mauer entstehen neue Hotels.
In den Läden, die vorher Berliner Luft in Dosen verkauften, werden Mauerstücke feilgeboten. Rasant ist der Absatz. Der Versandhandel blüht. West-Berlin prosperiert wie nie zuvor. Und es ist in aller Munde, braucht nicht mehr für sich zu werben, um der Gefahr des Vergessens zu begegnen. West-Berlin - der Name spricht für sich. Dank der Mauer.
Aber da meldet sich eines Tages die DDR. Sie ist erzürnt ob der neugewonnenen Vitalität und der hochschießenden Einnahmen: „Das ist unsere Mauer.“ Verhandlungen werden verlangt zum Zweck des Partizipierens. Aber sie enden ergebnislos. Westliche Intransigenz bewirkt östliche Konsequenz: Die Mauer wird abgerissen . ..
Dieser Filmstoff wurde jahrelang vergeblich zur Produktion angeboten. Tenor der Absagen: „Wird übelgenommen.“ Jetzt, nach zwei Dezennien Mauer, soll er verwirklicht werden. • Tragödien, auch wenn sie dauern, veralten. Man gewöhnt sich an sie, muckt nicht mehr auf.
Die Inszenierung, die einst betroffen machte, ins Mark schnitt, wird zur Kuriosität. Gefühle lassen sich nicht konservieren, und Gefühligkeit hinterläßt einen schalen Geschmack. Der Stoff muß neu durchdacht werden. Vergangenheit und Zukunft verlangen nach Verbundensein. Utopie als Brückenschlag. Ohne sie kann diese Stadt nicht existieren.
Copyright: „Rheinischer Merkur‘‘/..Christ und Welf - Die FURCHE
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!


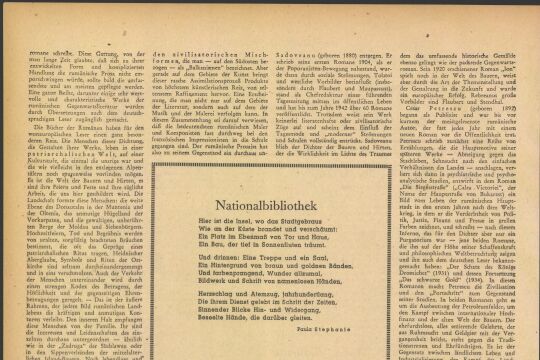





















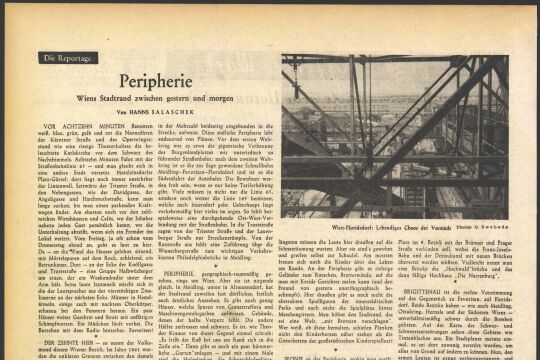









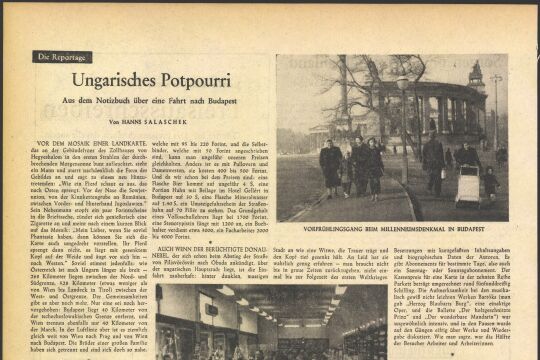





















































.png)






