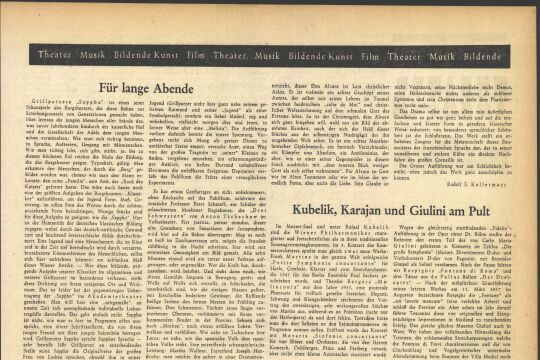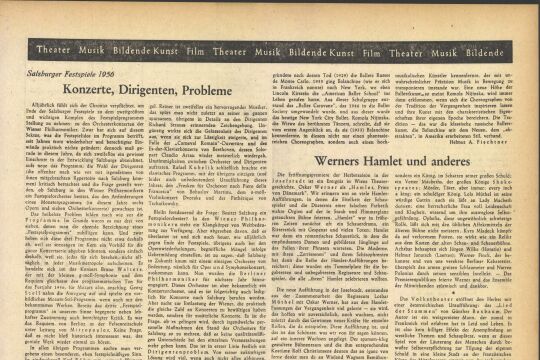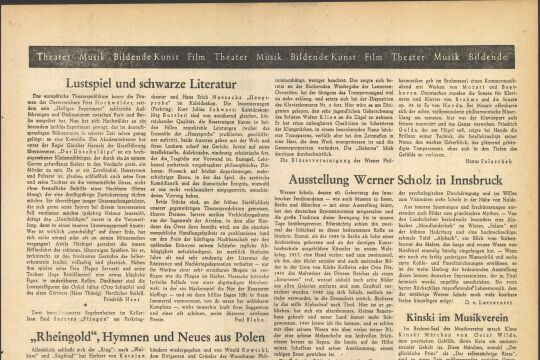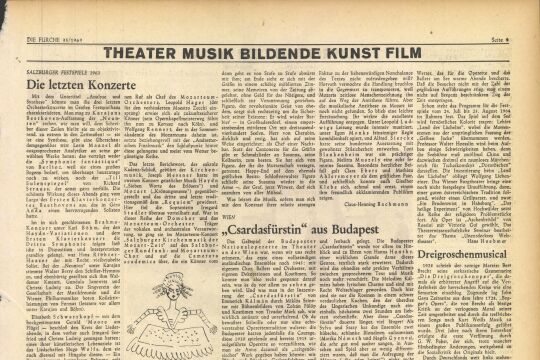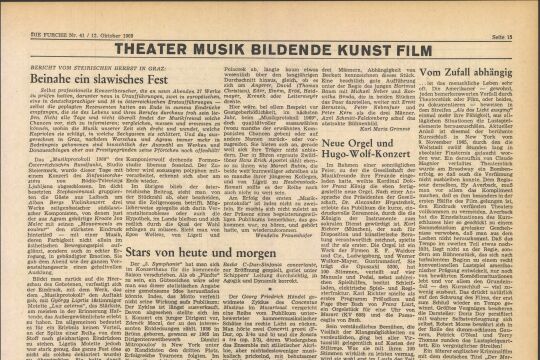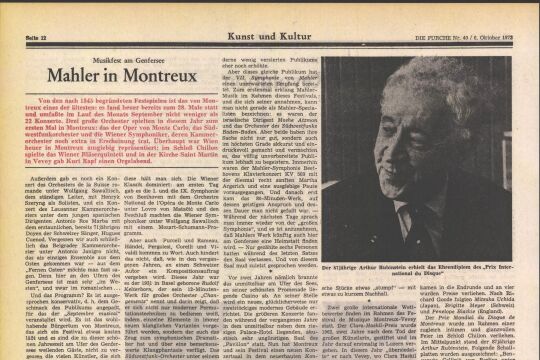Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ozawa, Böhm, Giulini
Im Internationalen Orchester- und Chorzyklus gastierte am vergangenen Wochenende das seit etwa sechzig Jahren bestehende San Francisco Symphony Orchestra unter Seiji Öaawa, der das berühmte Ensemble seit der Saison 1970/71 als Chefdiri-gerrt leitet. Ozawa, 1935 geboren, hat in Wien ziemlich spät debütiert (1966), und seither hat man ihn da und dort mit verschiedenen Orchestern musizieren hören. Kraft und Lyrismus, Spannung und Gelöstheit: die ganze Skala der Ausdruckswerte steht ihm wie selbstverständlich zur Verfügung. In der das Konzert eröffnenden IV. Symphonie von Beethoven war dynamische Differenzierung ebenso zu erkennen wie das sensible Nachziehen der Melodiebögen und die klare Phrasierung.
— Im Mittelpunkt des Programms stand eine bereits zwanzig Jahre alte „Serenade für Solovioline, Streicher, Harfe und Schlagzeug“ von Leonard Bernstein. Ubersieht man das durch die Untertitel angedeutete Programm (die Vertonung von fünf Platonischen Dialogen) und hält sich an die Bezeichnung „Serenade“, so mag es hingehen — nur ist das 30-Minuten-Werk für dies Genre viel zu lang. Der Allerweltsstil wird durch einige Anleihen bei Strawinsky ein wenig „modernisiert“ (man denkt an das „Concerto in re“ und an „Dumbar-tön Oaks“). Was bleibt, ist ein von Konzertmeister Stuart Canin virtuos exekutierter Solopart sowie da und dort einige hübsche lyrische Stellen.
— Den zweiten Teil des Programms bildete Bartöks Ballettsuite zu „Der wunderbare Mandarin“, die wir vor kurzem (vollständig) unter Boule gehört haben. Die von Ozawa benutzte Fassung hat den Vorteil, konzentrierter zu sein, seine Interpretation ist spontaner und fesselnder. Hier zeigt das Orchester auch seine ganze dynamische Kapazität, ohne je lärmend zu wirken. (Es sitzt übrigens auch etwa ein Dutzend Damen im Orchester, unter anderem an den Pauken und vor den großen Becken). Im ganzen: edn erstklassiges, international zusammengesetztes, trotzdem homogenes Ensemble und ein faszinierender Dirigent, der zugleich auch ein guter Musiker ist.
H. A. F.
Karl Böhm jubiliert und jubiliert ... Eben erst hat er den Professortitel engegengenommen, der „Achtziger“ steht vor der Tür. Und nun feierte er gerade seinen „Vierziger'“ in der Zusammenarbeit mit den Wiener Philharmonikern, bei denen er 1933 mit Mozart, Brahms und Beethoven seinen Einstand absolviert hatte. Fürs 8. „Philharmonische“ hatte er sich allerdings ein reines Symphonie-Programm ausge-
sucht; und zwar die von Mozart in g-Moll (KV 550), A-Dur (KV 201) und C-Dur („Jupiter“, KV. 551). Bewundernswert ist es, wie Böhm seine Musiker selbst bei den Werken, die die Musiker quasi schon im Schlaf spielen, zu Spitzenleistungen anspornt. Fulminant geriet vor allem die „Jupiter“-Symphonie, bei der er mit zunehmendem Alter — immer mehr vom Maestro-Charakter abgeht und — vor allem in den Ecksätzen — die Orchesterbravour und ein bißchen theatralisch schillerndes Pathos hervorkehrt. Allerdings ohne daß das Spiel des Orchesters kühl klänge. Denn eines weiß er wie kaum sonst ein Dirigent zu bewahren: das harmonische, stets persönlich eingestimmte Musizieren, dem es niemals an Wärme und Gefühlstiefe mangelt.
K. H. R.
Die chromatischen Reizwirkungen und die konsequente Linienführung, die „Ma mere l'oye“ von Maurice Ravel auch in der 1912 entstandenen Orchesterfassung auszeichnen, scheinen es Carlo Maria Giulini angetan zu haben. Bei seinem ersten Wiener Auftreten als Chefdirigent der Symphoniker — seine offizielle Inthronisation erfolgt allerdings erst am 1. September — erarbeitete er mit dem wohldisponierten Orchester^ das offenbar alles daransetzte, den neuen Herrn zufriedenzustellen, eine interpretative Luxusausgabe, ein wahres Feuerwerk von glitzernden Lichtern und Reflexen. Wenn auch dieser Höhepunkt des Konzerts durch die nachfolgende, sehr auf dem Effekt der inneren Spannungsgesetze des Werkes aufbauende Wiedergabe von Debussys „La mer“ nicht mehr erreicht wurde, so konnte man doch erkennen, daß die Musik des französischen Impressionismus dem neuen Chefdirigenten besonders am Herzen liegt. Zur makellosen Nachemp-flndung dieser Kunst will er offenbar das ihm nunmehr anvertraute Orchester führen. Wir werden ihm auf diesem Weg sicher gerne folgen. Der erste Teil des Konzerts war der von der Konzerthausgesellschaft geforderten Pflichtverneigung vor Mozart gewidmet. Alfred Brendel spielte das Klavierkonzert in D-Dur (KV 503), aus dem Winter 1786, nuancenreich im Anschlag und technisch sehr brillant, wenn auch etwas unterkühlt — Mozart ä Panglaise könnte man sagen. Giulini begleitete mit großem Takt, ohne freilich die Subtilität in der Instrumentation, die gerade dieses Konzert vor anderen auszeichnet, entsprechend herauszuarbeiten. Die Interpretation der „Kleinen Nachtmusik“' durch den Maestro war kühl, glatt und ausschließlich auf den eleganten Wohlklang abgestellt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!