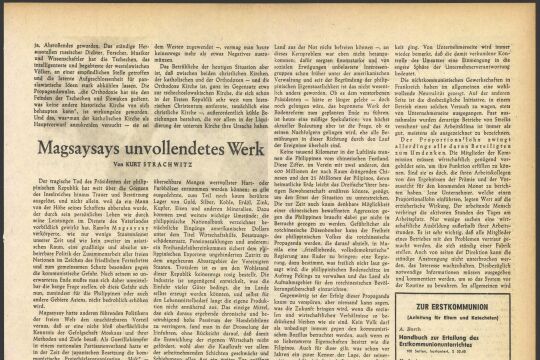Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Pharisäer & Rechtsdeuter
Nach geltendem Recht dürfen wir weder an Marokko noch an Libyen Panzer verkaufen. Doppelzüngigkeit war aber immer ein Merkmal der heimischen Diskussion um Waffenexporte.
Nach geltendem Recht dürfen wir weder an Marokko noch an Libyen Panzer verkaufen. Doppelzüngigkeit war aber immer ein Merkmal der heimischen Diskussion um Waffenexporte.
Man schrieb das Jahr 1977, als der Nationalrat mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und FPÖ das „Kriegsmaterialgesetz” in seiner ursprünglichen Fassung beschloß. Anlaß dafür war nicht zuletzt die Waffenschmuggelaffäre rund um den früheren Verteidigungsminister Karl Lütgendorf.
Das Gesetz machte die „Ein-, Aus- und Durchfuhr von Kriegsmaterial” von einer Bewilligung des Innenministers abhängig, die dieser im Einvernehmen mit dem Außen- und. dem Verteidigungsminister und nach Anhörung des Bundeskanzlers zu erteilen hat. Was als Kriegsmaterial im Sinne dieses Gesetzes anzusehen sei, sollte die Bundesregierung im Einvernehmen mit dem Hauptausschuß des Nationalrates durch Verordnung festlegen können.
Für die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von Kriegsmaterial ohne die entsprechende Bewilligung wurde eine Strafandrohung, nämlich Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, normiert.
Schon nach der ursprünglichen Fassung des Kriegsmaterialgesetzes war die Bewilligung für einen Waffenexport zu versagen, „wenn sie völkerrechtlichen Verpflichtungen oder außenpolitischen Interessen der Republik Österreich unter besonderer Be-dachtnahme auf die immerwährende Neutralität zuwiderläuft oder sicherheitspolizeiliche oder militärische Gründe entgegenstehen oder andere diesen vergleichbare gewichtige Bedenken bestehen.”
Als „andere gewichtige Bedenken” waren nach der Regierungsvorlage solche humanitärer Art anzusehen, „wenn etwa Grund zur Annahme besteht, daß eine Kriegsmateriallieferung im Bestimmungsland zur Unterdrük-kung der Menschenrechte verwendet werden soll...
Folgerichtig blieb dem geplanten Export von 96 Steyr-Küras-sier-Panzern nach Chile die Bewilligung versagt. Erstaunlicherweise wurde jedoch praktisch gleichzeitig der Export von 57 Kürassier-Panzern nach Argentinien im Juni 1981 bewilligt. Das, obwohl die Menschenrechtsverletzungen durch das argentinische Militärregime damals schon bekannt waren.
Nach diesen Erfahrungen verlangten die SPÖ-Abgeordneten Fischer, Wille, Dobesberger, Ble-cha und Genossen in einem Initiativantrag im Mai 1982, das Verbot des Waffenexports in Länder, die die Menschenrechte mißachten oder in denen kriegsähnliche Zustände oder Spannungen auch nur zu befürchten sind, im Gesetz noch deutlicher zu verankern.
Freilich wäre das dann nicht notwendig gewesen, hätte die Regierung das Kriegsmaterialgesetz von Anfang an wirklich ernst genommen. Deshalb sprach die ÖVP damals auch davon, der Initiativantrag der SP-Abgeordneten komme einem Mißtrauensvotum gegenüber der SP-Alleinregie-rung gleich.
Aufgrund des Initiativantrages beschloß der Nationalrat 1982 mit den Stimmen von SPÖ und ÖVP, das bestehende Kriegsmaterialgesetz zu „verschärfen” (siehe Kasten „Was das Gesetz bestimmt”).
In Wirklichkeit hat man dabei nichts anderes getan, als die Formulierung, die sich bereits in der Regierungsvorlage 1977 als Interpretationsrichtlinie befand, in den Gesetzestext 1982 aufzunehmen.
Dennoch stimmte die FPÖ diesmal dagegen und stellte sich auf folgenden Standpunkt, den der damalige FP-Hauptredner, der jetzige Justizminister Harald Of-ner, so formulierte: „Ich frage mich, ob wir es uns wirklich leisten können, auf diesem Sektor großzügig zu sein, päpstlicher als manche Päpste zu sein”, denn „wir haben es nicht in der Hand, dafür zu sorgen, daß Leute, die wir zu Recht ablehnen, keine Waffen bekommen. Daher glaube ich und glauben wir Freiheitlichen, daß der Weg, der da beschritten werden soll, niemandem nützt, sondern nur imstande ist, der
österreichischen Wirtschaft und den österreichischen Arbeitnehmern zu schaden.”
Dem entgegnete der SPÖ-Ab-geordnete (und jetzige Klubobmann) Sepp Wille, daß „die Of-ner-Formel, derzufolge zur Sicherung der Freiheit ein Heer, zur Sicherung des Heeres eine Waffenproduktion und zur Sicherung der Waffenproduktion der Waffenexport auch an die Tyrannen dieser Erde notwendig sei, absolut unzutreffend ist. Wir distanzieren uns davon, daß die Sicherung unserer Freiheit mit den Erträgen, die uns die Beihilfe zur Unterdrückung der anderen einbringt, finanziert werden soll.”
Für die ÖVP schließlich stimmte der Abgeordnete Felix Erma-cora dem Initiativantrag mit der Bemerkung zu, daß „auch in der Alltagspolitik ein Stück weltbürgerlicher Moral maßgebend sein soll.”
Die Rückbesinnung auf die Entstehungsgeschichte des Kriegsmaterialgesetzes und die dabei entscheidenden Intentionen des Gesetzgebers macht deutlich, daß ein Panzerexport nach Marokko keinesfalls bewilligt werden kann. Auch die angeblich bereits erteilte Waffenexportgenehmigung für Libyen ist schlicht und einfach rechtswidrig.
Daß letztere dennoch erteilt worden sein soll, fördert wieder einmal jenes Phänomen zutage, das allmählich zu einer ernsten Gefahr für den Rechtsstaat wird: Die Diskrepanz zwischen den gesetzlichen Regelungen, mit denen sich Gesetzgeber und Regierung gerne schmücken, und der tatsächlichen Handhabung dieser Gesetze wird immer größer.
Verglichen mit dem — was die Waffenexporte betrifft - kaum mehr zu überbietenden Pharisäertum, wäre sogar der zitierte „Ofnersche Weg” besser als der derzeit praktizierte „österreichische Weg”. Wenn man der Meinung ist, daß man auf Rüstungsexporte — aus welchen Gründen auch immer — nicht verzichten kann, dann bleibt nur ein Weg: Man soll auf der Stelle das Kriegsmaterialgesetz entsprechend ändern oder überhaupt aufheben.
Wenigstens den Vorwurf der Pharisäerhaftigkeit und der Gefährdung des Rechtsstaates würde man sich dann ersparen.
Der Autor ist Assistent an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!