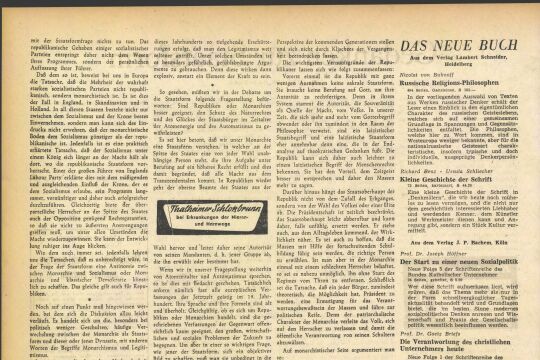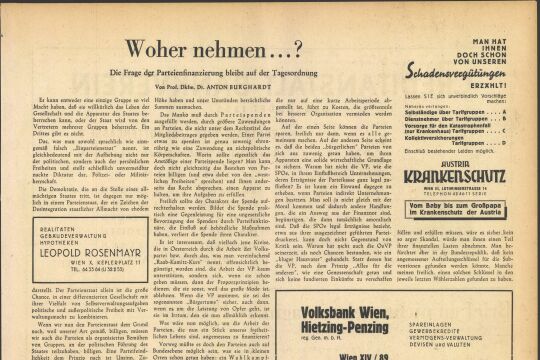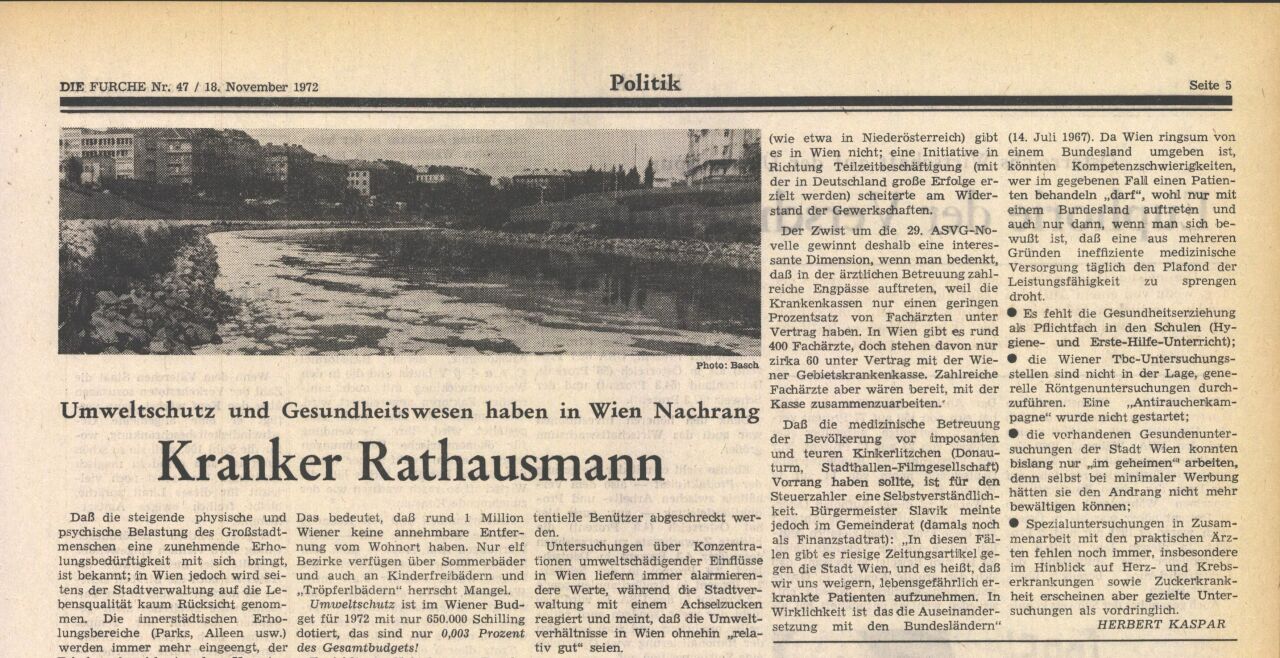
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Plädoyer für den Mehrparteienstaat
Lange bevor die Wahlrechtsreform des Jahres 1971 dazu geführt hat, daß dem in der Verfassung.veranker-ten Proportionalwahlrecht nun besser entsprochen wird als bisher, gab es die Behauptung vom Weg zum Zweiparteienstaat. Damit im Zusammenhang stand und steht die Diskussion um die Vor- und Nachteile eines Zwei- oder Mehrparteienstaates.
Verständlich ist, daß diese Diskussion vor allem aus dem subjektiven Blickwinkel betroffener Parteien und Organisationen geführt wird. Die Aussagen orientieren sich daher nach den Einflußmöglichkeiten der Interessierten im einen wie im anderen Fall. Gleiches gilt für Behauptung und Gegenbehauptung in der Frage, ob nunmehr der Trend zum „Zweiparteienstaat“— von dem ich persönlich meine, daß er nie bestanden hat — gestoppt wurde.
Es würde mir als Freiheitlichem nicht schwerfallen, unter Heranziehung der letzten Wahlergebnisse einen derartigen „Stopp“ zu behaupten und zu beweisen. Viel wesentlicher scheint mir jedoch zu sein, die Frage Zwei- oder Mehrparteienstaat objektiv ' dahingehend zu prüfen, welches System der Demokratie besser entspricht und in welchem notwendige Reformen eher erreichbar sind. Dabei möchte ich außer Streit stellen, daß eine derartige Weiterentwicklung und dauernde Reform der Demokratie unerläßlich ist, sofern man nicht gewaltsame Änderungen der Staatsform heraufbeschwören will. Mag es nun die obligate Begründung des Vorteiles eines Zweiparteienstaates geben, die darin besteht, daß die jeweilige Mehrheitspartei ihre Zielvorstellungen „ungestört“ in die Tat umsetzen kann, so hat dieses Argument doch wenig mit dem Grundgehalt einer demokratischen Verfassung zu tun. Ebenso meine ich, daß der immer wieder an die Wand gemalte „Nachteil“ eines Mehrparteienstaates — nämlich Kompromisse zwischen verschiedenen Zielsetzungen finden zu müssen — auch nur eine sehr oberflächliche Beziehung zum demokratischen Denken anzeigt
Geht man von der österreichischen Bundesverfassung aus, so muß man feststellen, daß das für den funktionierenden Staat und vor allem für die nötige Kontrolle der Machtausübung wesentliche Prinzip der Gewaltenteilung so gut wie nicht mehr besteht. Zumindest nicht in jener Form, die Kelsen im Auge hatte. Exekutive, Legislative und Gerichtsbarkeit als Träger der Staatswelt mit gegenseitigen Kontroll- und Überwachungsaufgaben sehen heute ganz anders aus. Ob man die Entwicklung bejaht oder für falsch hält, ändert nichts an der Tatsache, daß die Trager der Macht wie. jene, der Kontrolle durch politische Parteien und deren Einflußbereiche repräsentiert werden. Selbst dort, wo formell der direkte Einfluß der Parteien nicht nachweisbar ist, wird die indirekte Einflußnahme niemand ernsthaft in Zweifel ziehen. Das bedeutet aber weiter, daß die Parteien, deren Funktion und Verantwortung in der Verfassung überhaupt nicht umschrieben ist, genauer und gründlich durchdacht in ihrer staatstragenden Rolle gesehen werden müssen. Jede Partei vertritt nun einerseits ihre Wähler und Anhänger und kann anderseits mit Recht darauf hinweisen, daß sich dieser Kreis mit der politischen Zielsetzung der Partei identifiziert. Ich bin mir bewußt, daß es da und dort auch nur pragmatische Entscheidungen oder tagespolitische Verhaltensweisen sein mögen, die vom Wähler zustimmend oder ablehnend zur Kenntnis genommen werden, doch ändert dies nichts an der Feststellung, daß mit dem Ja zu einer Partei auch das Ja zur grundsätzlichen Zielsetzung derselben verbunden ist.
Die Unterschiedlichkeit politischer Auffassung und die Möglichkeit, sie zu akzentuieren, machen den Kern einer Demokratie aus. Versucht man, diese Unterschiedlichkeiten auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, was im Rahmen politischer Parteien geschieht, so ist es klar, daß mit sinkender Zahl der Parteien auch die Möglichkeit sinkt, wirtschaftliche, politische oder kulturelle Zielsetzungen präzise vertreten zu wissen. Von dieser Feststellung bis zur Behauptung, daß dadurch auch der innere Stellenwert der Demokratie leide, ist es nur noch ein kleiner Schritt — einer, der von mir trotz der Vorhaltungen .im Hinblick auf das Modell England gemacht wird. Zwei Parteien, die dann dem System nach Großparteien sein müßten, sind verhalten, ihre Hauptzielsetzungen darin zu sehen, jenen Prozent- oder Promillesatz an Stimmen mehr zu erhalten, der sie selbst über die 50-Pro-zent-Marke und den Kontrahenten unter dieselbe bringt. Das heißt aber auch, daß man im außerordentlich hohen Maße der Publikumswirksamkeit politischer Geschehnisse Platz einräumen muß, und zwar jenen Platz, der dann für notwendige, aber nicht populäre Entscheidungen fehlt. Ist dann dieses Ziel der mehr als 50 Prozent Stimmen erreicht, dann kommt der große Vorteil, „ohne Behinderung durch Konzessionen“ allein den eigenen Zielvorstellungen nach handeln zu können. Nahezu 50 Prozent sind mit ihren Wünschen und Vorstellungen von der Realisierung ausgeschlossen. Die einzige Zielsetzung besteht dann darin, das nächste oder übernächste Mal den Spieß umdrehen zu können.
Geht man aber noch etwas weiter darauf ein, daß ja die unterschiedlichen Auffassungen auch in der innerparteilichen Diskussion auf einen Nenner gebracht werden müßten und die Vielfalt der Meinungen eben parteiintern zum Ausdruck kommen, dann muß man logischerweise auch die Frage anschneiden: Warum dann zwei Parteien, warum nicht nur eine? Diese Frage ist nicht unberechtigt, weil ja nicht übersehen werden kann, daß die parteiinternen „Übereinstimmungen“ nur zum Teil auf der Basis besserer Einsicht, zum viel größeren Teil in der wirksamen Macht der großen Organisation liegen, jene Macht, die im gleichen Ausmaß wächst wie die Ohnmacht der Organisierten.
Ein Mehrparteienstaat wird gegen derartige Kumulationen wesentlich weniger anfällig sein. Er ist allerdings gezwungen, in Form von Regierungskoalitionen Kompromisse zwischen verschiedenen Zielsetzungen zu suchen und zu finden. Nur werden diese Kompromisse, die völlig zu Unrecht abfällig beurteilt werden, in aller Öffentlichkeit klar und deutlich — oder sollten es zumindest sein. Es sind im übrigen die gleichen, die sonst parteiintern herbeigeführt werden müssen, wenn eine Partei vier, fünf oder mehr Zielsetzungen in sich vereinigt und damit eigentlich ebensoviel Parteien im eigenen Schoß beherbergt.
Um aber nochmals auf die „Kompromisse' einzugehen: sie bieten jedenfalls die Möglichkeit, einen erträglichen politischen Weg, eine zumutbare Lösung, wenn schon nicht für alle, so doch für fast alle Bevölkerungsteile zu finden. Je weiter alle Parteien von einer absoluten Mehrheit entfernt sind, desto mehr wird aus dieser Möglichkeit der Zwang zum gemeinsamen Handeln. Mit anderen Worten, der Zwang, aus der Vielfalt der Auffassungen der Staatsbürger eine Auffassung mit dem größtmöglichen Konsens herauszu-filtern. Ist das nicht genau jene Überlegung, mit der die Geburtsstunde der Demokratie eingeleitet wurde?
Was bleibt, ist die Hoffnung, daß der Weg eines wandlungs- und reformfähigen demokratischen Staates in Österreich gegangen werden kann, durch die politische Vertretung vielfältiger Ziele — durch den Mehrparteienstaat.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!