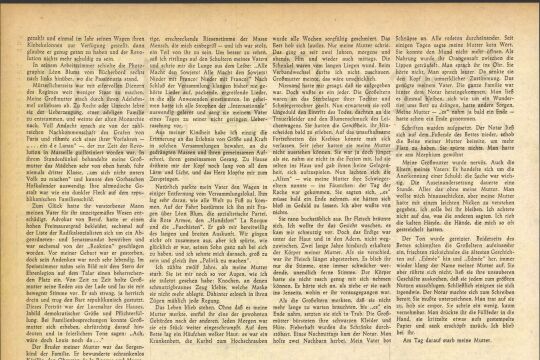Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Rätsel, die uns keine Ruhe geben
Die Frau im Witwenschleier packte meine Hand und wies heftig — mit dem Ausdruck des Hasses — auf einen jungen Franziskanerbruder, der vor uns die Straße überquerte. Er hinkte, und sein helles, rundes Gesicht sah etwas blödsinnig drein. Die Frau preßte meine Hand und schüttelte meinen Arm dabei. „Schau dir das an!" murmelte sie halberstickt. „So etwas lebt! — und mein Richard, mein Richard mußte fallen."
Ich war ein Kind, vielleicht erst fünf und sicher nicht älter als sechs Jahre alt. Trotzdem glaubte ich zu verstehen, was die Frau meinte, denn davon war damals im Ersten Weltkrieg bei uns zu
Hause oft die Rede: Die Besten fallen. Die Schlechten kommen davon.
Obgleich ich mich im Augenblick ein wenig wunderte, was denn an dem jungen hinkenden Franziskanerbruder so Böses sein sollte, so war ich doch bereit zu glauben, daß der Tod des Mannes Richard für unsere Nachbarin ein nie wieder gutzumachendes Unglück sei. Und nun sagte mir die Nachbarin, die ich Tante Christine nannte, daß sie den Tod ihres Mannes gegen das Leben des jungen abwog und daß sie daran etwas empörend fand.
Die kleine Szene ist mir im Gedächtnis geblieben, sie wurde mir später Schlüsselszene für ein ungeheures und sehr schreckliches Panorama.
„Die Besten sind gefallen." Diesen Refrain hörten wir immerfort: am Familientisch, wenn sich die Erwachsenen über die Zeit unterhielten, in bitterem Ton klagten, anklagten, verurteilten. Mit demselben Refrain schlössen so viele Ergüsse in Zeitungen, Zeitschriften; er tönte durch bei öffentlichen Reden und Kriegsopferfeiern.
Dagegen war die moralische Horrorfigur des Kriegsgewinnler. Ihn gab es in jedem Witzblatt, bösartig und bissig karikiert. Kein Wunder: er hatte gepraßt, während andere bittere Not gelitten; er hatte sich gemästet, während andere starben. Er war davongekommen. Davongekommen.
Das war am Ende der schärfste,
aber unauslöschliche Vorwurf. Und die verhaßte Witzblattfigur, der Davongekommene, trug oft jüdische Züge.
In den meisten Köpfen setzte sich die Vorstellung fest, „der Jude" habe durch den Krieg gewonnen. Daß Juden mit an der Front gestanden, daß viele von ihnen auch gefallen waren, das entschwand dem Bewußtsein.
Nicht, daß man es geradezu geleugnet hätte. Denn vielleicht kannte man selbst den einen oder anderen Juden, der in der Tat... Aber man glaubte nicht ganz daran. Zuckte die Achseln: Jaja, mag sein. Ein weißer Rabe. Aber die anderen. Immer die anderen.
Und wie immer, wenn Neid und Bitterkeit am Werk sind, schattete Verdacht auf dem Beneideten, er" habe sich nur durch böse Unterschleife Vorteile verschafft.
Das hatte vielfach noch nichts mit handfestem Antisemitismus zu tun. Man war — als „Bürgerlicher" — doch aufgeklärt. Man war doch kultiviert. Zum Juden von nebenan war man höflich, freundlich, schloß sogar Freundschaft mit ihm. Liebesverhältnisse waren nicht selten. Ehen waren weit rarer. Der Jude galt als mangeur des coeurs. Hier sickerten wieder Neid und Mißgunst ein.
Einen ersten antisemitischen Affront erlebte ich in München. Ich ging mit einem jungen Mann im Englischen Garten spazieren. Es war Januar oder Februar 1932, ein sonniger Mittag. Die Wege wimmelten von Promenierenden.
Ich kannte meinen Begleiter nur flüchtig. Ich wußte lediglich, daß er einen italienischen Namen hatte — er sah auch wie ein Italiener aus — und daß er Jurist war.
Unser Gespräch war noch gar nicht recht in Gang gekommen, da sahen wir auf dem schwarzerdigen Weg vor uns einen Schlüsselbund liegen. Es waren etliche to-sische Schlüssel daran und eine Hülse aus schwarzem Leder. Mein Begleiter hob den Schlüsselbund
auf und steckte ihn ein; er werde ihn zum Fundamt tragen. Aber schbn eine h be Minute später kam uns ein älteres Ehepaar eiligen Schrittes und mit besorgten Mienen entgegen. Sie suchten etwas; ganz offenbar waren sie die Verlierer des Schlüsselbundes.
Mein Begleiter sprach sie an: „Haben Sie etwas verloren?"
„Ja, einen Schlüsselbund." - Ich hätte den beiden den Schlüsselbund nun ohne weiteres ausgehändigt. Aber mein Jurist wollte sich offenbar etwas aufspielen.
„Wieviel Schlüssel waren an dem Bund?"—Der alte Mann antwortete: „Sechs — oder sieben —." „Sechs oder sieben? Sie müssen doch wissen, wie viele Schlüssel Sie haben?" „Ich sag es Ihnen doch: eine ganze Menge." „Das ist doch keine Antwort!" Dem Alten platzte der Kragen. Er zog los: „Sie frecher Judenbub, Sie Judenschlingel!" — Auch die alte Frau begann zu zetern: „Sie sehen doch, wir suchen..."
Verwirrt zog mein Begleiter den Bund aus der Tasche, händigte ihn aus, ergriff die Flucht. Verwirrt stolperte ich hinterdrein. Was sollte ich sagen? Ich hatte das Benehmen meines Bekannten gegen die alten Leute ungehörig gefunden. Ich hatte den Ausbruch des alten Mannes noch ungehöriger gefunden. Am unmöglichsten aber wäre es mir gewesen zu fragen: „Sind Sie nun wirklich Jude?" Wir trennten uns rasch und sahen uns nie mehr wieder.
So wuchsen Mauern auch dort, wo keine gewesen waren. Und doch erklärte es das Spätere nicht Wieso konnte ein Hirn auf die Idee verfallen, die nach Auschwitz führte? Mir war das lange ein Rätsel, und da es das scandalum unserer Generation bleibt — ein quälendes Rätsel — bis... ja, bis mir eines Tages Tante Christine einfiel mit ihrem haßerfüllt gezischten Satz: „Schau dir das an! So etwas lebt—und mein Richard mußte fallen."
Nun fielen sie wieder, so viele Richarde. Ein Krieg war entfesselt worden, ein, wie sein Entfeß-ler wohl wissen mußte, ungerechter und dabei blutiger Krieg. Was die Nachkriegszeit aufgehäuft hatte an Bitternissen gegen die Davongekommenen, das kam nun wieder herauf und schlug um in die fürchterliche perverse Logik: Wenn die einen sterben, sollen es auch die anderen; und wurden die einen in Kesselschlachten verheizt, so sollten auch die anderen in eine ähnliche Hölle gehen.
Aus den Beneideten und Verhaßten wurde zum zweitenmal so etwas.
Auch aus den Ärmsten der Armen, Idioten, Wahnsinnigen, Krüppeln wurde so etwas. Ihr Tod kaufte keinen anderen los.
Aber er steht als Schatten über uns, den Davongekommenen.
Abdruck aus dem soeben erschienenen und in der FURCHE Nr. 33/82 rezensierten Bild/ Textband „Wir erlebten das Ende der Weimarer Republik". Hrsg. von Rolf Italiaander. Droste-Verlag. Düsseldorf 1982.240 Seiten, öS 36430.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!