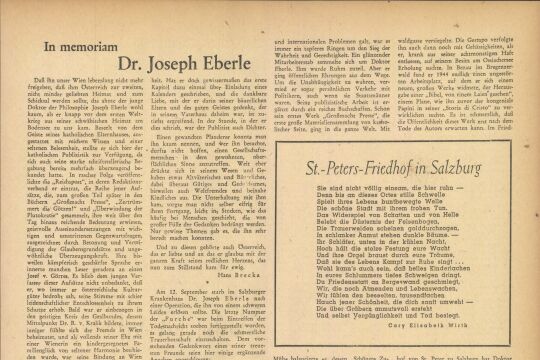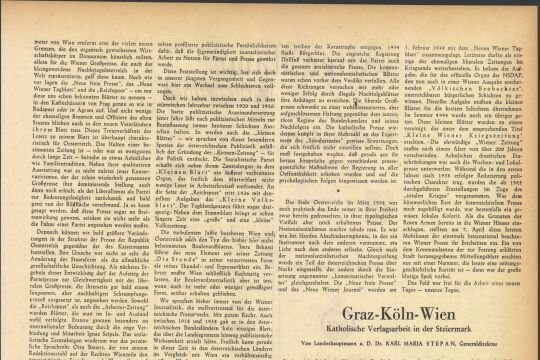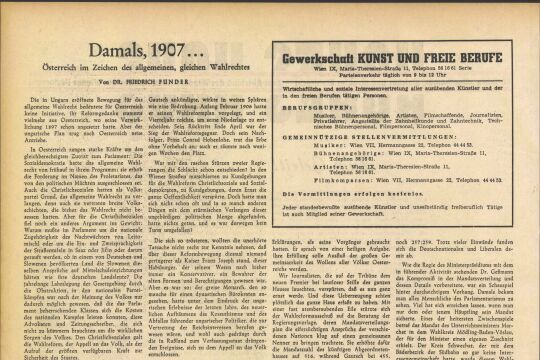Zwei römische Prälaten haben in Österreich während der Ära des Ubergangs von der Monarchie zur Republik eine hervorragende Rolle gespielt: Der Fiakersohn aus dem Wiener Vorort Rudolfsheim Ignaz Seipel und der Wirtssohn aus dem bajuvarischen Kernland Oberösterreichs, Johann Nepomuk Hauser. Die Bedeutung beider Politiker wird unter anderem in dem Image sichtbar, in dem sich die großen politischen Faktoren ihrer Zeit versuchten, wenn sie den beiden Prälaten etwas heimzahlen wollten. Nach dem totalen Versagen der sozialdemokratischen Parteiführung sowie des Schutzbundes anläßlich des Brandes des Justizpalastes 1927 hat die Propaganda der Linken dem Bundeskanzler Seipel das Wort im Mund verdreht und ihm das Image eines Prälaten ohne Milde angehängt. Und 55 Jahre nach dem Ende der Monarchie in Österreich hat Kaiserin Zita in ihrer vom ORF ausgestrahlten eindrucksvollen Lebensgeschichte nur einer einzigen politischen Partei Erwähnung getan, nämlich jener Christlichsozialen von 1918, deren Obmann und Klubobmann Hauser seither in hochkonservativen Kreisen mit dem Vorwurf belastet ist, er habe durch seine Unverläßlich-keit das Schicksal der Monarchie in ihrer Endkrise besiegelt.
Josef Honeder ist es hoch anzurechnen, daß er eine von Legenden und Vorurteilen freie Biographie Johann Nepomuk Hausers geschrieben hat. Der Autor ist weder Ideologiekritiker noch Politologe, wie das jetzt in einer gewissen Krise der Geschichtswissenschaft nicht wenige Historiker zu sein versuchen. Das Land Oberösterreich war seinem Landeshauptmann der Jahre 1908 bis 1927 dieses Werk schuldig und es war richtig, den Autor zu ermutigen, seine Dissertationsschrift von 1963, nach allem, was inzwischen an Österreich geschehen ist, im Jahre 1974 zu diesem wichtigen Beitrag zur Zeitgeschichte auszugestalten.
Zur gleichen Zeit übergibt Harry Slapnicka, der Lesern der FURCHE nicht erst vorgestellt zu werden braucht, den Band 1 seiner Zeitgeschichte Oberösterreichs, „Von Hauser bis Eigruber“, der Öffentlichkeit. Auch dieses Buch beschäftigt sich vorwiegend mit der Person Hausers, allerdings mehr mit dem Landespolitiker, der sich nach 1918 aus verschiedenen Ursachen vom Parkett der Politik in Wien zurückgezogen hat. Slapnicka liefert ein genaues Abszissen- und Ordinatennetz der Landespolitik in Oberösterreich während des ersten Jahrzehnts der Republik und damit ein Ganzes, über dem das biographische Werk Hon-eders seinen guten Platz hat.
Es ist bekannt, daß die beiden römischen Prälaten Seipel und Hauser in politicis nicht gut aufeinander zu sprechen waren. Viktor Kolassa, der langjährige Generalsekretär der Christlichsozialen Partei, hat dem Verfasser dieser Zeilen einige eindrucksvolle Illustrationen zu diesem Thema geliefert. Das bestätigen die Autoren der beiden jetzt vorliegenden Bände und sie bestätigen damit, gewollt oder ungewollt, die Größe des damaligen Katholizismus, in dessen Weite beide Politikerprälaten Raum genug zur vollen und unangefochtenen Entfaltung ihrer priesterlichen Existenz fanden.
Hauser, der andere Prälat, genoß zuletzt den Vorteil davon, daß auf den Prälaten ohne Milde das pausenlose Vernichtungsfeuer der roten Propaganda der zwanziger Jahre niederging. Wurde so an Seipel kein gutes Haar gelassen, dann gingen über Hauser, zumal von den sozialdemokratischen Spitzenpolitikern in Wien, schließlich wahre Kaskaden des Lobes nieder. (Hinweis: Honeder, S. 102, Slapnicka, S. 158 und a. a. O.)
Die nunmehr vorliegenden zeitgeschichtlichen Untersuchungen bestätigen, daß Hauser, gemeinsam mit Seipel, es 1918 der Christlichsozialen Volkspartei erspart hat, zusammen mit der Monarchie zügrunde zu gehen oder wegen der Frage der Monarchie wieder in jene Fraktionierung zu verfallen, in der vor 1907 die Konservative Partei der Alpenländer und die Christlichsoziale des Doktor Lueger existiert haben. Das realpolitische Handeln während des Umsturzes, 1918, war allerdings für Hauser politisch viel kostspieliger als jenes des eben erst am 11. November 1918 zurückgetretenen k. k. Ministers und Exzellenzherrn Seipel. Denn Seipel hat mit seiner Artikelserie in der REICHSPOST von 1918 post fe-stum nur mehr das auch grundsätzlich bestätigt, was Hauser bereits einen Monat vorher mit seinem „Ja“ für die Republik als Parteiführer verantwortlich zu entscheiden hatte und wofür er gerade aus den eigenen Reihen eine politisch kostspielige Rechnung präsentiert bekommen hat.
Beide Bücher widerlegen die von heutigen Politologen verbreitete Legende vom Charakter des damaligen „politischen Katholizismus“ als einer kirchlich-organisatorisch abgestützten Ideologienpartei. Honeder zeigt unwiderlegbar auf, daß sich Hauser zu Zeiten höchst mäßiger Sympathien seitens der hochwürdigsten Herrn Bischöfe von Linz und des hochwürdigen Klerus im Lande erfreute. Bischof Doppelbauers Sympathien galten bis zu seinem Tod (1908) den Konservativen; Hauser ging aus dieser Richtung hervor, aber er ging seinen Weg weiter in die katholische Volksbewegung, die, solange es sie gab, das Mark der Partei Luegers wurde. Ausgesprochen gespannt wurde das Verhältnis Hausers zu Bischof Gföllner (1915 bis 1941), und dies zumal dann, als Hauser in einen Frontalzusammenstoß mit der monarchistischen Bewegung in Österreich geriet, wobei sein Bischof nicht verhehlte, daß seine Treue nach wie vor dem Kaiser im Exil gehörte. 1921 wurde Hauser gegen die Absichten seines Bischofs und nur auf Grund des einstimmig gefaßten Wunsches der Vertrauensmänner der Christlichsozialen Partei neuerlich als Kandidat für den Nationalrat aufgestellt.
Die irrige Vorstellung, die Katho-lizität der politischen Führer der ChristMchsozialen hätte ihre politische Abstützung und Abhängigkeit von den Bischöfen und Geistlichen, führte in der Spätkrise der Monarchie dazu, daß politische Kreise, namentlich solche bei Hof, der Ansicht waren, man müsse nur den jeweils zuständigen Bischof dazu bringen, die christlichsozialen Führer zur Räson zu bringen; der „Rest“ würde dann schon Order parieren. Sicher war es ein Fehler des Wiener Kar-dinal-Erzbischofs Piffl, noch im November 1918 dem Kaiser gegenüber den Auftrag zu übernehmen, den Klubobmann der Christlichsozialen, Hauser, bei der Stange zu halten und das Votum dieser Partei zugunsten eines Fortbestands der Monarchie für die entscheidende Abstimmung in der Provisorischen Nationalversammlung am 12. November 1918 so zu sichern. Zumal im November 1918 die Anhänger der Monarchie ohnedies in Wien saßen (so die Arbeiterführer Kunschak, Spalowsky, He-male u. a.), während die ersten Rufe nach der Republik aus christlichsozialen Kreisen Tirols und anderen westlichen Kronländern kamen, so auch aus Oberösterreich. Honeder erwähnt (S. 76) Hausers Bezugnahme auf die Haltung des damaligen Bürgermeisters von Eferding: Er nennt diesen einen kernfesten Österreicher, aber auch bei diesem „alten Unteroffizier“ zeigt sich die Stimmung gegen den Kaiser. Beide Autoren machen ersichtlich, daß 1918 nicht das Auftreten der Roten Garde in Wien oder das Anarchistein in den Marschkompanien der Deutschmeister allein die Stimmung in den Truppen des Millionenheeres charakterisierten, sondern das Auslassen der „Getreuesten der Getreuen“: des Linzer Infanterieregiments Hessen Numero 14, das nach Abgabe seines Sturmbataillons den weiteren Einsatz an der Front in Südtirol bereits in der letzten Oktoberwoche verweigerte. Des Salzburger Infanterieregiments Rainer Numero 59, die schließlich weder auf Offiziere noch Feldkurat hörten und denen es nach allen Opfern des Kriegführens genug war.
Es war und ist ein schwerer Irrtum, dem treubiederen Typ der al-penländischen Bajuwaren so etwas wie eine Hundetreue zuzumuten. 1848 schon hatte in Wien das Grenadierbataillon Richter (zusammengesetzt aus den Grenadierkompanien 59/Salzburg, Hessen/Linz und Heß/ St. Pölten) den bewaffneten Aufstand begonnen und dies, während die Garnisonstruppen italienischer Ergänzungsbezirke befehlsgemäß ausrückten und die Deutschmeister das Zeughaus bis zuletzt gegen eine erdrückende Ubermacht der Revolutionäre ihrer Vaterstadt verteidigten.
Honeder schreibt kein Psycho-gramm Hausers. Aber die sorgfältig ausgewählten Porträtillustrationen seines Buches lassen an hervorragenden Persönlichkeiten jene typischen breitflächigen und fleischigen Gesichter erkennen, hinter denen sich ein mächtiger Schädel verbirgt, der oft voll schwer analysierbarer Emotionen und Geisteskräfte ist. Anton Bruckner, von Wiener Journalisten seiner Zeit als ein G'scherter vom Land abgewertet, dessen Höchstleistungen riesige Portionen von G'seichtem, Kraut und Knödeln seien, mußte lange für das irreführende Image eines Mostschädels herhalten. Was in diesem Schlag, der verschiedener Gestaltungen fähig ist, stecken kann, das hat Oberösterreich zumal nach der Wende von 1945 bewiesen, als es sich mit einer andernorts leider oft fehlenden Dynamik an die Spitze der Aufwärtsentwicklung in Österreich setzte. Politisch, wirtschaftlich und kulturell gelang hier eine vorbildliche Symbiose des alten Bauernlandes mit einer gekonnt gesteuerten Industriegesellschaft.
Es war Seipel, der Hauser zuweilen als den bloßen Figuranten des gleichzeitig hervorragend tätigen christlichsozialen Vorarlbergers Jodok Fink hinzustellen beliebte. Quasi der klobige Prälat im Gegensatz zu dem gewitzten Alemannen, einem Republikaner der ersten Stunde. Man sagte, Hauser sei am Vorabend gewisser Entscheidungen gerne „krank“ geworden oder er sei in Linz „unabkömmlich“ gewesen. Sicher tat sich ein amtierender Landeshauptmann von Oberösterreich schwer, wenn er gleichzeitig auch als Parteiobmann und Klubvorsitzender der größten staatstragenden Partei die gewerbsmäßigen Kurbier und Intriganten in den Zentralstellen mit einem nassen Fetzen davonjagen sollte. In den großen Proportionen der Politik war Hauser nie absent. Sein Satz: Man mußte damals (1918) mit den gegebenen Tatsachen rechnen, man mußte vermeiden, daß Blut floß (Hinweis: Honeder, S. 78), ist Leitmotiv seiner politischen Hinterlassenschaft, eines der unersetzlichen Elemente des heutigen politischen Klimas in Oberösterreich. Wohltemperiert.
Wie sehr Hauser sein ständiges Kranksein zugesetzt hat, ergibt ein flüchtiger Vergleich seiner von Honeder gebrachten Porträts aus 1915 und 1925 (S. 94. ff.). Ein Psychogramm Hausers müßte mit seinem inneren Ringen und Fühlen beginnen, über das er aus der Linzer Diözesanlehr-anstalt an priesterliche Freunde (nicht wie heute üblich an Boulevardblätter) schrieb. Den frühen Tod beider Eltern hat der familienlose Geistliche lange nicht überwinden können. Ein Schock war es für den mit „eminenter“ abgeschlossenen Theologen, daß ihm sein Ansuchen um Fortsetzung seines Studiums am Germanicum in Rom abschlägig beschieden wurde. Er ist selbstkritisch genug, um einzusehen, daß ihn dafür das „Seminar nicht in einer Weise vorbereiten hätte können, wie es die Würde und Erhabenheit dieses Standes (nämlich des priesterlichen) erfordert“ (Honeder, S. 9 ff.). Hausers musisches Interesse war — im Lande Bruckners — der Literatur zugewandt; in seiner Bücherliste fehlt bezeichnenderweise Adalbert Stifter. Als junger Kaplan in der Konservativen Volkspartei Oberösterreichs bedeuten ihm die Umstände des Todes des Kronprinzen Rudolf ein Monitum, auf das er mit Äußerungen reagiert, die nicht überlesen werden dürfen, wenn man in seinem Verhalten während der Krise des Jahres 1918 stöbert. Diese Laesio von 1889 ging tiefer als die vor Torschluß während der Titel- und Ordens-inflation von 1918 erfolgte Verleihung der Würde eines Geheimen Rates. Der junge Kooperator mit 29 Jahren schaut weiter skeptisch in die Welt (siehe Porträt) und er schämt sich zwar und hält sich für „dumm“, aber er sagt es: „Ich bin bis in die innerste Fiber aufgeregt, ich bin außerstande mich zu fassen, ich bin gemütskrank.“ Als 35jähriger schreibt er das erste semer vier Testamente. Die detaillierten Verfügungen über seine bescheidene Hinterlassenschaft und die jeweilige Bedachtnahme auf Menschen, die ihm etwas bedeuteten, können nicht darüber hinwegtäuschen, daß er sich des lebensgefährlichen Risikos des Lebens mehr bewußt war, als das in einer Welt, die man jetzt die heile Welt nennt, bei Politikern seiner Zeit üblich gewesen ist.
Es ist Harry Slapnickas Verdienst, daß er hinter der Szenerie des Oberösterreichs der zwanziger Jahre und der Person des Landeshauptmanns Hauser die Fluchtlinien auf einen riesigen Horizont zieht, innerhalb dessen schon alles auf seinen Platz gerückt war, um die große Katastrophe in der Mitte des Jahrhunderts zu inszenieren.
Daß dieser „andere Prälat“, im Gegensatz zu einem zeitgenössischen Image, trotz aller Bedrängnisse des Leibes und der Seele als Mensch und Priester und Politiker, und behaftet mit einer nicht unbeträchtlichen Quantität menschlicher Mängel, sein Leben durchgestanden hat, das aus den beiden vorliegenden Büchern zu erkennen, macht sie für junge Politiker katholischer Herkunft und Anschauung empfehlenswert. Und das nachträgliche Verständnis der „anderen“ braucht der „andere Prälat“ nicht. Er hatte es zu Zeiten eher und mehr als jenes der sogenannten Näherstehenden.
JOHANN NEPOMUK HAUSER, LANDESHAUPTMANN VON OBERÖSTERREICH 1908—1927. Von Josef Honeder. Oberösterreichischer Landesverlag, Linz 1974. 148 Seiten, illustriert.
VON HAUSER BIS EIGRUBER. Eine Zeitgeschichte Oberösterreichs. Von Harry Slapnicka. Band 1 (Vom Ende des ersten Weltkrieges bis zum Tode des Landeshauptmannes Hauser im Jahre 1927). Oberösterreichischer Landesverlag, Linz 1974. 223 Seiten, illustriert.