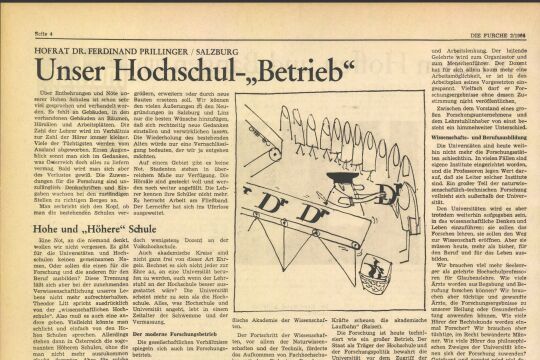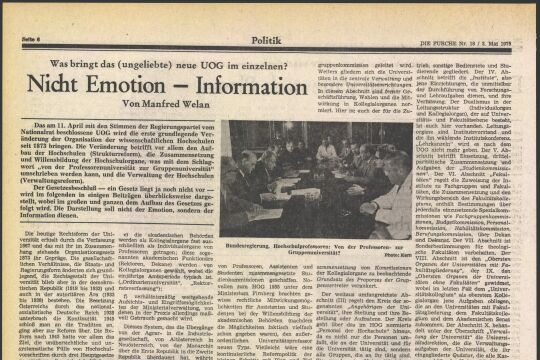Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Reform — rechts der Mitte
Die Partie ist eröffnet. Auf den ersten Zug des Ministeriums folgte der Geigenzug der Professoren. Konkret: auf den Ministerialentwurf für ein Universitätsorganisationsgesetz präsentierte die Rechts- und Staats-wissenschaftliche Fakultät der Universität Wien ihren Gegenvorschlag, lagistisch streng exakt in 14 Abschnitte und 118 Paragraphen gefaßt, mit den Erläuternden Bemerkungen (die beim Ministerialentwurf noch fehlen) ein Konvodut von 168 Seiten. Abgesehen von den früher veröffentlichten Vorschlägen — Obertrumer Programm der Studenten, Vorstellungen der Rektorenkonferenz, „Gfatter“- Entwurf der Assistenten, Stellungnahmen einzelner Hochschulen und Fakultäten — von denen so manche Idee in die nun vorliegenden Dolcumente Eingang gefunden hat, dürften damit die Papiere auf dem Tisch liegen, an denen sich nun in den kommenden Monaten die entscheidende Diskussion um die Universität von morgen kristallisieren soll.
Zwei Papiere, zwei verschiedene Ausgangshasen und damit auch zwei verschiedene Zielrichtungen, auch wenn das gemeinsame Anliegen die Universität von morgen ist. Aber diese Universität sieht eben für den sozialistischen Politiker, der sich auf
U1C CdmöVJliU'l/C iOUlCl IT CLL KCl stützen kann und aus dieser seinen Auftrag ableitet, anders aus, als für den Insider, für den die Funktionsfähigkeit der universitären Einrichtungen Voraussetzung für die Erfüllung der Aufgaben in der Gesellschaft ist. Dan Auswag aus diesem Dilemma kann nur das Bemühen weisen, zwischen beiden Standpunkten einen Kompromiß zu erzielen.
Die Funktionsfähigkeit soll nach Ansicht der Autoren das Juristenentwurfs „durch eine wirksamere, übersichtlichere, flexiblere und kostensparende Verwaltungsorganisation ohne unzumutbare Belastungen für Forschende und Lehrende“ sowie „durch eine gleicherweise sachgerechte wie transparente, flexible Institutionsorganisation“ erreicht werden. Deswegen bleibt der Entwurf zwar bei der bestehenden Fakultätseinteilung, läßt aber den einzelnen Fakultäten die Möglichkeit offen, selbst über notwendig gewordene oder werdende Unterteilungen zu bestimmen. Er unterscheidet — statt wie der UOG-Entwumf die Aufgaben des Instituts zu umschreiben und dabei die Möglichkeiten von Varianten offenzulassen — Institutstypen nach der Eigenart des Faches (naturwissenschaftlicher und technischer Richtung, geistes- und sozialwissenschaftkcher Richtung sowie Kliniken) sowie nach der Funktion im Aushildungsgang (Durchgangsoder Heimatinstitute). Es sollen zwar aide Institute einen Beirat zur Beratung des — aus allen ordentlichen Professoren bestehenden — Vorstandes erhalten, aber nur bei Heimatinstituten wären darin auch die Studenten „mit Nahbeziehung zum Institut“ vertreten. Dem Beirat sollen neben den außerordentliche.! Professoren noch wenigstens zwei wissenschaftliche Mitarbeiter angehören, die Beiziehung von nichtwissenschaftlichem Personal wird offengelassen.
Im Sinn der Funktionsfähigkeit und des Grundsatzes, daß nur der mitentscheiden soll — etwa bei Habilitationen und Berufungen —, der die in Frage stehende Qualifikation salbst schon erworben hat, sind in den Fakuiltätskollegien die Vertreter von Dozenten, Assistenten und Studenten nur etwa im Verhältnis von eins zu zehn gegenüber der Zahl der Ordinarien vorgesehen, denn hier stehen die entscheidenden Personalfragen an. Dagegen bleiben die Stu-dienkornmissionen — wie sie fast überall bereits bestehen — wie im Ministerialentwurf drittelparitätisch bestehen, da gerade bei Fragen des Studiums und der Lehre die
Studenten sehr wohl mitentscheiden können.
Im akademischen Senat stehen einander Professoren einerseits, Dozenten-, Assistenten- und Studentenvertreter anderseits in gleicher Zahl gegenüber (wobei die Gesamtzahl von der Zahl der Fakultäten abhängt). Hier tritt aber ein neuer Gedanke hervor, der sich wie ein roter Faden durch den Entwurf zieht: die stärkere Einbindung in die Gesellschaft soll durch die Gewinnung von wissenschaftlich fundierten Praktikern aus Wirtschaft und Industrie für die Lehre erreicht werden — und diese Honorar- und Titular-prof assoren können ebenso zum Rektor gewählt werden wie Ordinarien oder Extraordinarien (die Funktion des Institutsvorstandes und des Dekans sind dagegen den Ordinarien vorbehalten). Für die Wahl des Rektors — die nach dem Ministerialentwurf Auifgaibe der Vollversammlung sämtlicher Pakultätskoiiegdan wäre —, soll ein drittelparitätischer Konvent einberufen werden.
Keine politischen Exerzierfelder
Es war klar, daß den Mitgliedern der Juristenfakultät die Bedenken gerechtfertigt erschienen, eine allzuweit gehende Mitbestimmung von Assistenten und Studenten könnte gegen den Verfassungsparagraphen von der Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre verstoßen. Sie versichern, mit ihren Vorschlägen soweit gegangen zu sein, wie diese Barriere irgendwie zulasse. Dafür soll aber alles getan werden, um dem wissenschaftlichen Nachwuchs das Hineinwachsen in die entscheidungsfähigen Personenkreise zu erleichtern — etwa durch die Einsetzung von „Akademischen Räten“, die etwa den heutigen Oberassistenten entsprächen, oder von „Forschungsassistenten“, die an ihrer Habilitierung arbeiten können, ohne von Lehr- und Verwaltungsausgaben behindert zu sein, oder durch den Passus, daß dem Assistenten die halbe Dienstzeit für eigene wissenschaftliche Forschung, Fortbildung und Lehrtätigkeit eingeräumt werden muß.
„Die Universitäten in politische Exerzierfeider zu verwandeln, hieße, die gesllschaftspoMtischen Aufgaben der Wissenschaft verkennen“, heißt es in den Erläuterungen. In einer flunktionsmäßig geteilten Gesellschaft fällt der Universität nicht zu, demokratischen Elementarunterricht zu geben. Vielmehr bedarf die Gesellschaft ... ebenso einer nur ihrer Selbstkontrolle unterworfenen Wissenschaft wie der Ausbildung zu selbständigem Denken. Das sind die gesellschaftspolitischen Aufgaben, die der Universität als Institution aufgetragen sind.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!