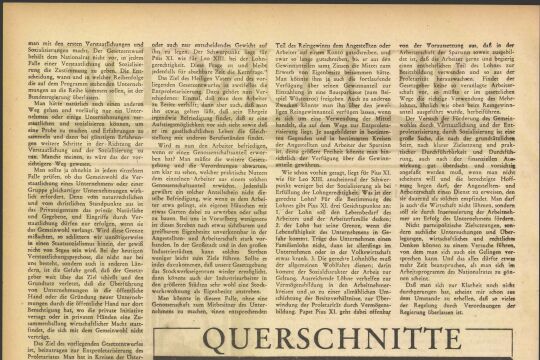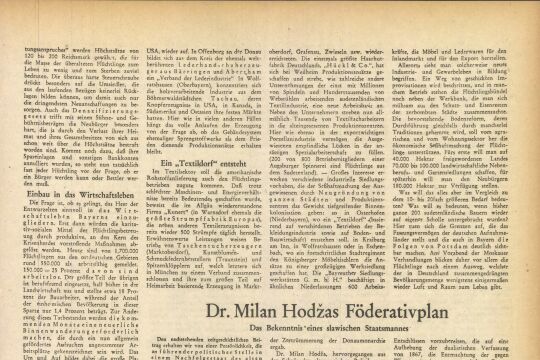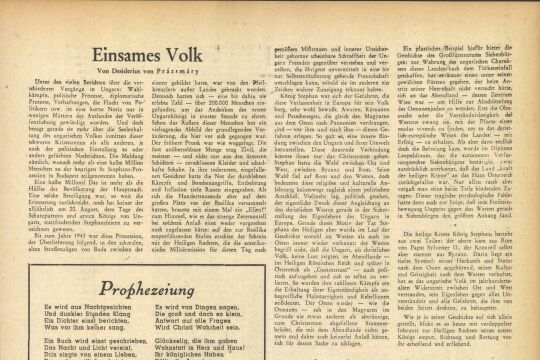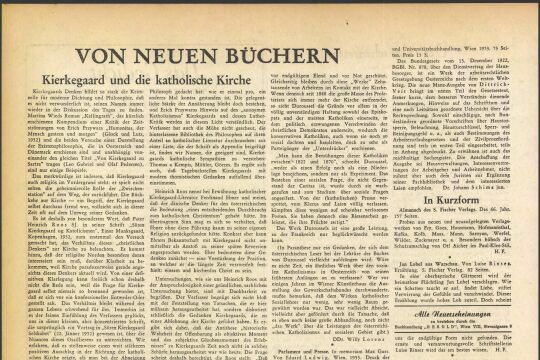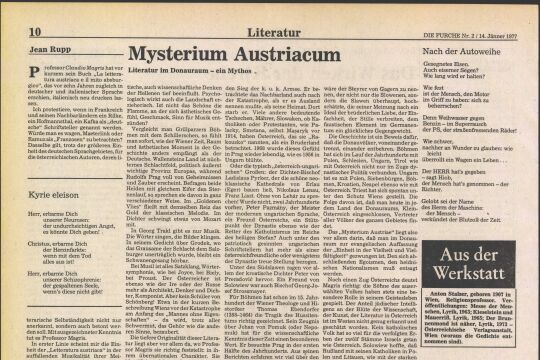Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Religion und Nation im Widerstreit
„Im Anfang war das Wort“ heißt es am Beginn des Johannes-Evangeliums. Dieses Zitat steht auch am Anfang einer Abhandlung des Wiener Soziologen Univ.-Prof. Walter B. Simon, denn es geht darin um die Bedeutung der Sprache und um die Rolle der katholischen Kirche in den Sprachkonflikten der Donaumonarchie. Die Basis für Simons Arbeit haben Forschungen des amerikanischen Historikers Prof. Paul O’Grady geboten.
„Keine andere Institution hat je soviel zur Entwicklung der Volkssprachen sowohl in Europa wie in den anderen Erdteilen beigetragen wie die katholische Kirche.“ Damit würdigt Simon mit konkreten Hinweisen (Wulfila, Cyril und Methodius) die Rolle christlicher Missionare bei der Entwicklung von Schriftsprachen. Es war keineswegs so, daß man Völker bei der Bekehrung ihrer Kultur und Sprache berauben wollte. Im Gegenteil: Missionare waren nur selten die „Vorhut des Imperialismus“, tauchten meist völlig unabhängig von Eroberern auf und nahmen oft gegen die imperialistischen Eroberer für die unterdrückten Eingeborenen Partei.
In vorindustriellen Gesellschaften gab es nach Simon keine Sprachkonflikte, erst die mit fortschreitender Industrialisierung erzwungene Berufsstruktur verlangte zunehmend eine Ausbildung im Gebrauch der Sprache in Wort und Schrift, und damit kam es zu Konflikten. Vorher hatten sich die Herrschenden zwar oft bemüht, ihren Untertanen ihre Religion aufzudrängen, aber niemals ihre Sprache.
Sprachkonflikte beruhen meist auf inateriellen Interessen, Ideologien oder Mystifizierungen des Begriffs der „Nation“. Kompromisse sind schwierig, da die Anerkennung einer Sprache völlig andere Voraussetzungen schafft. Simon: „Jede Anerkennung einer vorher ausgeschlossenen Sprache gibt der vorher unterprivilegierten Sprachgruppe eine Monopolstellung, da hier die Unterprivilegierten die vorher privilegierte Sprache beherrschen und nicht umgekehrt.“
Die österreichische Donaumonarchie mit ihren elf verschiedenen Sprachen bietet Gelegenheit, dieses Problem, das hier natürlich gehäuft auftrat, sorgfältig zu untersuchen und wertvolle Aufschlüsse zu gewinnen.
Um eine friedliche Lösung der Sprachkonflikte war nicht nur die Regierung bemüht, sondern auch wesentliche politische Kräfte: der fortschrittliche Liberalismus, der internationale Sozialismus und der übernationale Katholizismus.
Der fortschrittliche Liberalismus, ursprünglich Hüter der universellen Werte der Aufklärung, tendierte aber bald zu einem besonders engstirnigen, nationalen Chauvinismus. Simon sieht das in der besonderen Interessenlage der führenden Liberalen (vorwiegend Akademiker) begründet, die von sprachpolitischen Maßnahmen am meisten betroffen wurden.
Die „nationale Frage“ überrollte aber auch Sozialisten und klerikale Konservative. Simon zitiert den „pessimistischen Konservativen“ Franz Grillparzer, der bereits die Gefahr erkannte: „Der Weg der neuen Bildung geht von der Humanität zur Nationalität und Bestialität.“
So kam es um die Jahrhundertwende quer durch die politischen Lager einmal zu Frontstellungen zwischen nationalen und antinationalen Kräften oder zu Konfrontierungen klerikaler Kreise mit Antiklerikalen.
Unterden Sprachen der Donaumonarchie stand die deutsche Sprache (Umgangssprache für etwas mefyr als ein Drittel der Bewohner des cisleitha- nischen Österreich) klar an erster Stelle.
Die Deutschösterreicher sahen natürlich in einem gemischtsprachigen Gebiet ihre Berufsaussichten empfindlich geschmälert, wenn eine zweite Sprache zugeiassen wurde, die sie nicht beherrschten. Hier schlugen sich viele Christlichsoziale auf eine Seite mit den Deutschnationalen, mit denen sie zum Teil auch (ein etwas weniger ausgeprägter) Antisemitismus verband.
Simon zitiert in diesem Zusammenhang die Mahnung des jüdischen Liberalen Adolf Fischhof an die Deutschen der Donaumonarchie:
„Nicht ein Vormund sei er den Völkern, sondern ein Vorbild ... Durch
Germamsationsversuche erfüllt der Deutsche nicht seine Kultursendung, sondern weckt nur den Haß der Nationalitäten, fördert er die Zwecke Rußlands. Der Sache Deutschlands und dem Interesse Europas dient er nur, indem er den West- und Südslawen die Pfade der Selbstentwicklung ebnet.“
FURCHE-Gründer Friedrich Funder, der diese Sätze Fischhofs in seinem Werk „Vom Gestern ins Heute“ festgehalten hat, meint dort auch, die Geschichte habe die Warnung Fischhofs bestätigt.
Auch konservative Klerikale und Christlichsoziale erhoben ihre mahnende Stimme gegen den zunehmenden Nationalchauvinismus. Die deutsch-böhmische Dichterin Marie von Ebner-Eschenbach formulierte es so:
„Deutschland, Du herrliches, mach Dich doch frei von den Einflüsterungen der Deutschtümelei.
Achtest sonst kaum unsern Herrn
Jesus Christ, weil er nicht in Pommern geboren ist."
Die rund drei Prozent der Bevölkerung, die Italienisch als Umgangssprache angaben, scheiterten mit dem' Wunsch nach einer italienischen Universität am Widerstand der Deutschnationalen. Anderseits forderte die
Bewegung der „Irredenta“ (von „terra irredenta" - „unerlöste Erde“), vorwiegend aus Bildungsbürgertum und Studenten bestehend, den Anschluß der italienischen Gebiete (Trentino, Görz, Triest, Istrien und Fiume) an Italien.
Unter der slawischen Bevölkerung - fast drei Fünftel der Bewohner des cisleithanischen Österreich - gab es pan-slawistische Tendenzen - so Simon - nur unter einer Minderheit „nationaler Tschechen“, die mit Rußland sympathisierten, sowie unter orthodoxen Ruthenen oder Westukrainern in Ostgalizien und der Bukowina, die ihre Religion mit dem Zarenreich verband.
Während' es vor allem unter den Tschechen mit einem betont antiklerikalen Nationalismus gärte, waren die Polen und Südslawen gläubige Katholiken und loyale Österreicher. Trotzdem waren Konflikte in Südkärnten und in der damaligen Untersteiermark mit Deutschnationalen, aber auch an der oberen Adria und im Raum Görz mit Italienern keine Seltenheit. Aber trotz empfindlicher Benachteiligungen hofften die Südslawen eher auf eine autonome Einheit im Rahmen Österreichs, während ein südslawischer Staat mit den Serben, in dem die Katholiken in der Minderheit sein würden, wenig Anziehungskraft für sie hatte. Die Religion ging offenbar vor Sprache und Nation.
Die Abhandlung kommt zu dem Schluß, daß die gutgemeinten Lösungsvorschläge zur Beilegung der Sprachkonflikte deshalb so wenig Erfolg hatten, weil Liberalsimus, Sozialismus und Katholizismus nicht einmal imstande waren, die Spannungen in den eigenen Reihen zu bewältigen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!