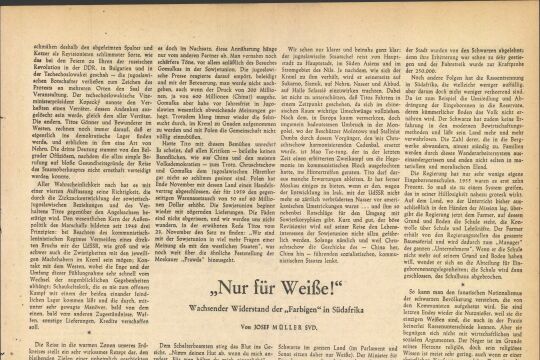Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Rhodesische Wolken
Im Salonwagen des südafrikanischen Ministerpräsidenten John Vorster fand eine denkwürdige Unterredung zwischen dem rhodesischen Ministerpräsidenten Ian Smith und Vertretern der nationalistischen Bewegung der Schwarzen in Rhodesien unter Führung des geächteten Bischofs Abel Muzorewa statt Nach wenigen Sitzungen gingen die Verhandlungspartner wieder auseinander, ohne zu positiven Resultaten gelangt zu sein, ja ohne auch nur eine gemeinsame Plattform für weitere Gespräche gefunden zu haben. Vorster und der Präsident von Zambia, Kaunda, hatten auf dieses Treffen gedrängt, ein Repräsentant der Apartheid und ein Vertreter der schwarzafrikanischen Staatenwelt. Beide wissen, daß es um nicht weniger als um die Entscheidung über Krieg oder Frieden im südlichen Afrika geht.
Im Salonwagen des südafrikanischen Ministerpräsidenten John Vorster fand eine denkwürdige Unterredung zwischen dem rhodesischen Ministerpräsidenten Ian Smith und Vertretern der nationalistischen Bewegung der Schwarzen in Rhodesien unter Führung des geächteten Bischofs Abel Muzorewa statt Nach wenigen Sitzungen gingen die Verhandlungspartner wieder auseinander, ohne zu positiven Resultaten gelangt zu sein, ja ohne auch nur eine gemeinsame Plattform für weitere Gespräche gefunden zu haben. Vorster und der Präsident von Zambia, Kaunda, hatten auf dieses Treffen gedrängt, ein Repräsentant der Apartheid und ein Vertreter der schwarzafrikanischen Staatenwelt. Beide wissen, daß es um nicht weniger als um die Entscheidung über Krieg oder Frieden im südlichen Afrika geht.
Ian Smith war nicht leicht dazu zu bewegen, sich mit Leuten an einen Tisch zu setzen, die er bis dahin als Aufrührer und Mörder bezeichnet hatte. Außerdem muß er, wie alle Politiker in demokratischen Staaten, auf die Stimmung unter seinen Wählern Rücksicht nehmen. Viele Rhode-sier fanden diese Konferenz grotesk, und jedes Entgegenkommen ist in ihren Augen eine Einladung zur Intensivierung des Terrors.
Auf der andern Seite fürchteten die verfolgten Führer des ANC, des afrikanischen Nationalrates, sie könnten in eine Falle geraten. Sie stellten Bedingungen, um den guten Willen der Regierung zu testen und um zugleich Vorteile zu erringen, Bedingungen, von denen schließlich ein Teil wirklich erfüllt wurde, aber bei weitem nicht alle. Wenn die Anführer der Befreiungsbewegung sich zuletzt entschlossen, sich am Tagungsort einzufinden, so war eines ihrer Motive wahrscheinlich die Absicht, der Welt Gesprächsbereitschaft zu demonstrieren, um den späteren-Terror zu entschuldigen.
Ihnen zuliebe wurde die Konferenz dann im Niemandsland, auf der Brücke über den Sambesi unterhalb der Viktoriafälle, im Eisenbahnwaggon abgehalten.
Nach ihrem Scheitern erklärte Premierminister Vorster, es sei falsch, zu behaupten, die Verhandlungen hätten einen toten Punkt erreicht oder seien fehlgeschlagen. Man sei lediglich auf Hindernisse gestoßen, es hätten sich Probleme ergeben, die noch zu lösen seien. Er und Präsident Kaunda von Zambia, die den Gesprächen beigewohnt hätten, würden in ihren Anstrengungen nicht nachlassen, eine Lösung zu finden. Präsident Kaunda sei ebenso ehrlich bemüht wie er selbst, im südlichen Afrika den Frieden zu sichern.
Die meisten Beobachter sind sich darin einig, daß das Engagement Vorsters und Kaundas der Silberstreif am Horizont ist. Davon abgesehen aber liegt dieser Erklärung des südafrikanischen Premiers Zweckoptimismus zu Grunde. Die Lage ist ernster, als man es aus diesen Worten herausliest.
Er selbst weiß das nur zu gut. Von ihm stammt das oft zitierte Wort, das südliche Afirka befinde sich am Scheidewege zwischen einer glücklichen Entwicklung oder einem grausamen, alles verzehrenden Krieg. Seine rastlose Aktivität, Spannungen abzubauen, wirtschaftliche Bindungen zu knüpfen, den verschiedenen Gruppen der Bevölkerung Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen, aufkommenden Nationalismus zu kanalisieren, beweist, daß er sich über die Tragweite der Entscheidung keiner Täuschung hingibt.
Die Gipfelkonferenz der Organisation für Afrikanische Einheit, die gegen Ende Juli in Kampala tagte, forderte Gespräche der Regierung Smith über einen Regierungsanspruch der schwarzen Mehrheit in Rhodesien und kündigte für den Fall ihres Scheiterns eine verstärkte Guerilla gegen die Weißen an. Daß es sich um keine leere Drohung handelt, wissen alle Beteiligten. Terror und Unruhen gibt es seit Jahren in Rhodesien. Sie haben in den letzten zweieinhalb Jahren mehr als 950 Todesopfer gefordert. Die Regierung versucht, ihnen mit Ausgehverbot, Umsiedlung von Teilen der Bevölkerung und mit der öffentlichen Zur-Schaustellung getöteter Guerillakämpfer zu begegnen. 18 Prozent der Budgetausgaben sind für Sicherheit und Landesverteidigung bestimmt, der Straßenbau und verschiedene Aktivitäten des Innenministeriums dienen ebenfalls militärischen Zwecken. Rhodesische Zeitungen zeigen Schlagzeilen wie „Rhodesien ist in tödlicher Gefahr“.
„Die Weißen können bleiben, wenn sie nicht herrschen wollen“, erklärte Julius Nyerere, der Staatschef von Tanzania. Aber wenn die Guerilla ihren Höhepunkt erreicht, wird die Praxis anderes lehren. Wenn der Terror wütet, entgleitet die Macht den Händen besonnener Führer.
Ein Vergleich mit den Ereignissen in Angola liegt nahe. Dort kam der Umsturz viel früher, als allgemein erwartet wurde. Die Ursache hiefür war allerdings der Sturz des früheren Regimes im Mutterland Portugal, der unmittelbare Anstoß kam also von außen. Ein auslösendes Moment dieser Art kommt für Rhodesien nicht in Frage.
Aber andere Aspekte des Dramas in Angola werden für Rhodesien relevant werden. Die Ereignisse ermutigen die Schwarzen gewiß einerseits; anderseits aber werden sie sie auch zum Nachdenken anregen. Zu deutlich zeigt sich, daß die „Befreiung“, das Zerbrechen der Herrschaft der Weißen, nicht unmittelbar das
Glück und die wahre Freiheit für die Bevölkerung bedeutet; zu eindringlich erweist es sich, daß die Befreiungsarmeen danach die Waffen gegeneinander kehren, die Waffen, die sie vom Ausland erhalten haben und im Dienste ausländischer Mächtegruppen führen; zu klar ist erkennbar, daß ein „befreites“ Land allzuleicht zum Kriegsschauplatz im Ost-Westkonflikt wird.
Nur wenige afrikanische Regierungen werden allerdings aus solchen Gründen den Schluß ziehen, daß es besser sei, die Guerillakämpfer nicht oder nur lässig zu unterstützen. Die meisten werden sich eher dazu entschließen, ihre Gruppe besser auszurüsten und sie so auszubilden, daß sie auf Anhieb siegt. Solche Vorbereitungen werden mehr Zeit in Anspruch nehmen. So kann man annehmen, daß die aus den Ereignissen in Angola gezogenen Lehren im Hinblick auf Rhodesien zunächst eine retardierende, dann aber eine eskalierende Wirkung ausüben werden. Die Bewegung des schwarzen Rassismus ist derzeit nicht aufzuhalten.
Ian Smith argumentiert sicherlich richtig, wenn er behauptet, die Übernahme der Macht „durch die schwarze Mehrheit“ sei eine Fiktion, weil die Bevölkerung auf eine demokratische Machtausübung in keiner Weise vorbereitet sei und zu viele Voraussetzungen dafür fehlten, und wenn er erklärt, ein Regierungswechsel würde der Masse der schwarzen Einwohner gar nichts bringen. Woran es in Rhodesien aber fehlt, ist ein einigermaßen befriedigendes Gesamtkonzept, wie es in Südafrika mit der Autonomie der Bantu-Ho-melands praktiziert wird. Und deshalb ziehen sich die Gewitterwolken zusammen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!