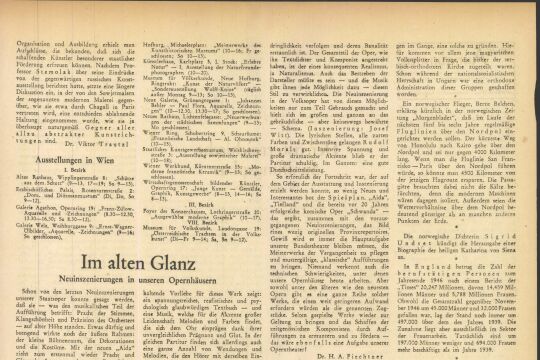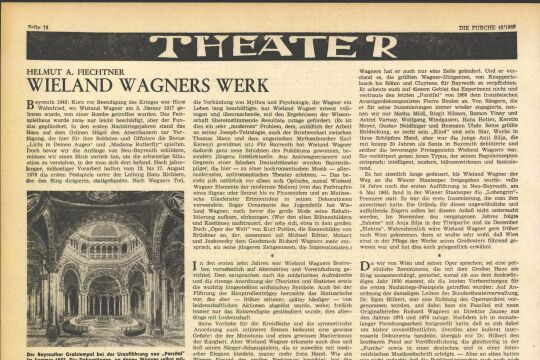Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Salome im Jugendstil
Obwohl für die Ausstattung der neuinszenierten „Salome“ von Richard Strauss in der Presse und im Rundfunk viel (gefährliche) Vorreklame gemacht wurde, muß eine Besprechung der Aufführung in der Staatsoper gerechterweise mit einer Würdigung der Bühnenbilder und Kostüme Jürgen Roses beginnen. Da die Idee zu dieser Jugendstilinszenierung, wie man hört, von Boleslaw Barlog ausgegangen ist, darf man ihn gleich in dieses Lob — denn um ein solches handelt es sich — einbeziehen.
Obwohl für die Ausstattung der neuinszenierten „Salome“ von Richard Strauss in der Presse und im Rundfunk viel (gefährliche) Vorreklame gemacht wurde, muß eine Besprechung der Aufführung in der Staatsoper gerechterweise mit einer Würdigung der Bühnenbilder und Kostüme Jürgen Roses beginnen. Da die Idee zu dieser Jugendstilinszenierung, wie man hört, von Boleslaw Barlog ausgegangen ist, darf man ihn gleich in dieses Lob — denn um ein solches handelt es sich — einbeziehen.
Es gibt merkwürdige Dinge in unserem Musiktheaterbetrieb. Da inszeniert ein Künstler von Rang allein in Berlin mehr als 100 Sprechstücke und neun Opern — und es dauert bis nach seiner Pensionierung, daß man ihn auch für Wien einmal gewinnt. Die Einladenden hatten nichts zu bereuen, obwohl es sich bei „Salome“ um ein schwieriges Stück für den Anfang und Einstand vor einem neuen Publikum handelt.
Wieland Wagner hatte zuletzt die „Salome“ inszeniert und ausgestattet. Es gelang ihm damals eine Art „Uberrumpelungseffekt“: man war von der Neuartigkeit, dem absolut Anderen eindrucksvoll verblüfft. Aber dieser positive Eindruck hielt der Zeit nicht stand: Als wir vor kurzem Wieland Wagners „Salome“ wieder sahen, verspürten wir keinen Wunsch mehr, ihr noch weiterhin zu begegnen. Außer natürlich seiner Heroine Anja Silja, die den Abend immer noch interessant und aufregend machte. Wieland Wagners Idee war es, das Milieu eines zeitlosen Verfalls, des absoluten Chaos uns vor Augen zu führen. Barlog und Kose taten das Gegenteil. Sie siedelten „Salome“ optisch genau dort an, wo sie entstanden ist: in der Zeit des um 1895 aufkommenden Jugendstils.
Erinnern wir uns: zwei Jahre vorher hatte Oscar Wilde (1856 bis 1900) zunächst für Sarah Bernhardt in französischer Sprache sein Stück geschrieben. Das biblische Thema war ihm aus frühmittelalterlichen Mosaiken, Miniaturen und Tafelbildern bekannt, ebenso Salome-Dichtungen in Vers und Prosa. Wilde benützte mit unbedenklichem Zynismus die Sprache der Bibel, um seinen gestanzten und stelzenden Figuren künstliches Leben einzuhauchen. Alle diese psychoanalysierten Schemen könnten ein echtes Drama erleben und erleiden. Aber sie taugen nur zu einem fatalen Todesreigen und einseitigen Verliebtheiten: des Pagen in Narraboth, Narraboths in Salome, Salomes in Jochanaan — und des Herodes in seine Stieftochter.
Diese Figuren Wildes hat sein Freund, der frühverstorbene Aubrey Beardsley (1872 bis 1898), mit höchstem künstlerischem beziehungsweise kunstgewerblichem Raffinement gezeichnet, und ein Insel-Bändchen hat sie fast populär gemacht. Während Wilde an seinem Stück bastelte und Richard Strauss (in den Jahren 1903 bis 1905) die „Salome“-Partitur schrieb, war Klimt auf der Höhe seiner Kunst. Barlog und Rose haben viele seiner Motive, vor allem aber ein in Venedig befindliches Salome-Bild Klimts, als Vorlagen benützt: Ihre Dekorationen und Kostüme zeigen raffinierte Jugendstilornamente, vor allem Klimtscher Provenienz: Pflanzenmotive aus gebündelten und frei sich auffächernden Linien, stilisiertes Rankenwerk, geheimnisvoll schimmernde Augen, einen leuchtenden blau-violetten Himmel mit opalisierenden Sternen, davor schwarze Baumsilhouetten mit goldenen Blättern, die überaus prächtigen Kostüme in symbolischen Farben, die dunkel schimmernden Rüstungen der Leibwachen, und immer wieder die Farben Grün und Silber, Blau und Gold. Der Gesamteindruck ist der Leibwachen, und immer wieder Schönheit. (Eine etwas stärkere Ausleuchtung hätte viele sehenswerte Details besser zur Geltung kommen lassen.)
Wir sind in unserem Referat noch immer nicht bei den Sängern. Denn es gilt bei dieser Gelegenheit daran zu erinnern, daß die weltberühmten Kreationen der Diaghilew-Truppe in den Jahren 1909 bis 1929 in Zusammenarbeit mit den berühmtesten Malern der damaligen Zeit entstanden sind: In den ersten Jahren haben Benois, Bakst und Golowin für die „Ballets Russes“ in Paris gearbeitet, später waren es Picasso, Derain, Larionow, Marie Laurencin, Juan Gris und Rouault. In den zwanziger Jahren entwarfen Chagall, Leger und Picasso für die „Ballets Suedois“ Dekorationen und Kostüme. Das soll ein Hinweis auf die Oper als Gesamtkunstwerk sein — und ein wenig von der bei uns herrschenden Sängeridolatrie ablenken. Obwohl es an diesem Abend wirklich keinen Grund zu irgendwelchen „Ablenkungen“ gab.
Leonie Rysanek hat mit schöner und kräftiger Stimme die gewaltige Titelpartie, die sie viele Jahre gemieden hat, vorbildlich bewältigt. (Das bestätigten auch ihre Erfolge als Salome in New York, Athen und München.) Ihr angenehm dunkeltim-brierter Sopran klang immer gut, ausdrucksvoll und nie schrill. Hans Hopf stellte einen metallisch scharf charakterisierten Tetrarchen und Grace Hofmann eine in Stimme und Erscheinung gleichermaßen imponierende Herodias dar. Zwei kraftvolle und ausdrucksstarke Stimmen:Eberhard Wächter als Jochanaan und Waldemar Kmentt — Narraboth; in entsprechendem Abstand Rohangiz Yachmi als Page. — Damit der Wermutstropfen im Freudenbecher nicht fehle: mit Salomes Tanz wußten weder der Regisseur noch die Choreographin noch Leonie Rysanek etwas anzufangen. Hier wären wir eher für ein Double gewesen.
Am Pult stand Dr. Karl Böhm, der die Aufführung mit Sensibilität und Temperament leitete. Vom ersten cis-moll-Klarinettenlauf und der Liebeslyrik Narraboths über die feierlichen musikalischen Banalitäten, die Jochanaan zu produzieren hat, über Salomes sentimentalen English-Valse-Triste bis zu ihrem großartigen Schlußgesang, in dessen letzten zehn Minuten die Musik von Strauss eine große tragische Gebärde, unwahrscheinliche Intensität und Ausdrucksgewalt hat: das alles gestalteten Dr. Böhm und die Philharmoniker mit Meisterhänden. — Daß von dem wohlbekannten Text nur etwa ein Drittel verständlich war, lag weder am Dirigenten noch an den Solisten, sondern an jenem verhängnisvollen „Nervenkontrapunkt“, dessen Gefahren keiner besser kannte, als Strauss selbst.
Sehr lebhafter, langanhaltender Beifall, demonstrative Begrüßung des Dirigenten — und keinerlei Störungen. (Die nächsten Reprisen finden am 2., 6. und 18. Jänner statt.)
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!