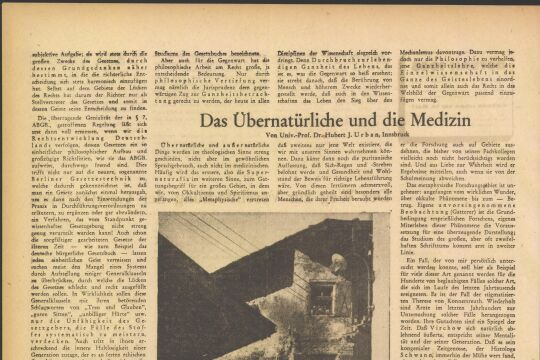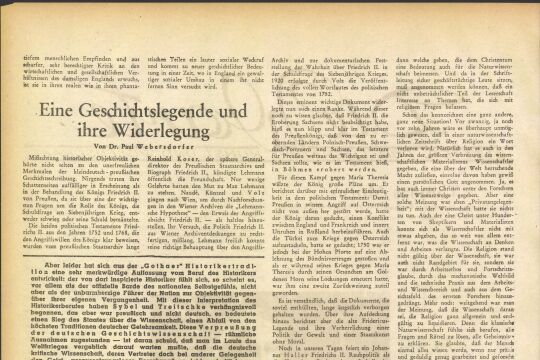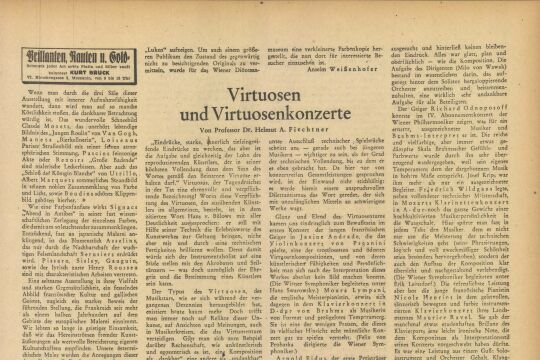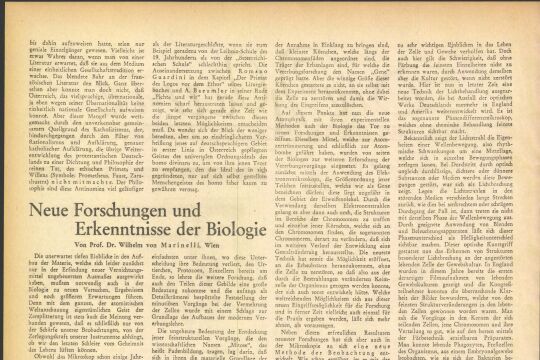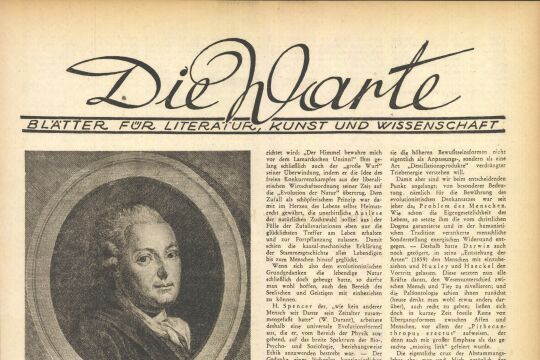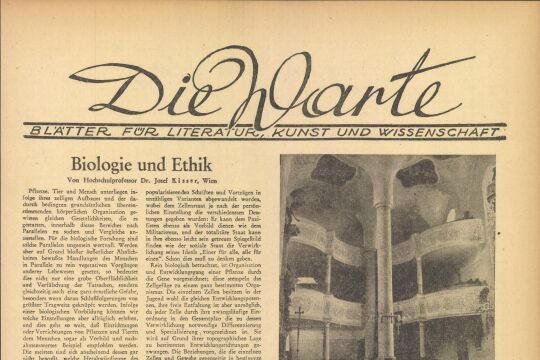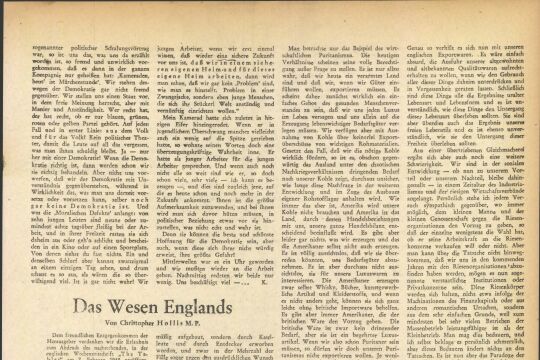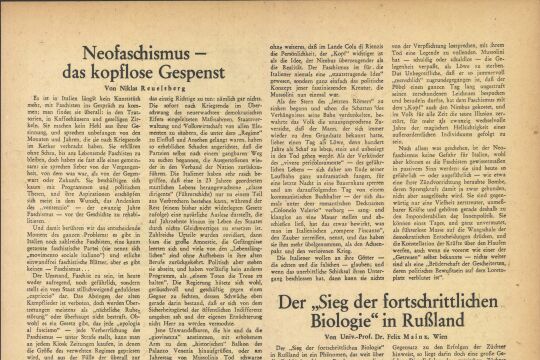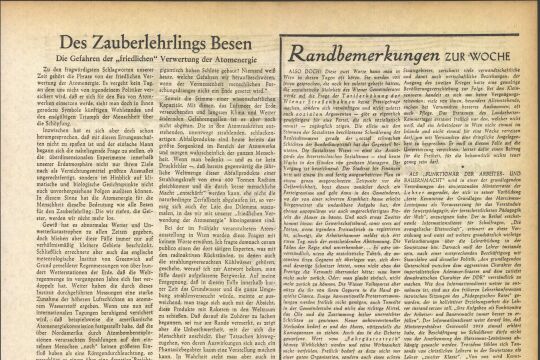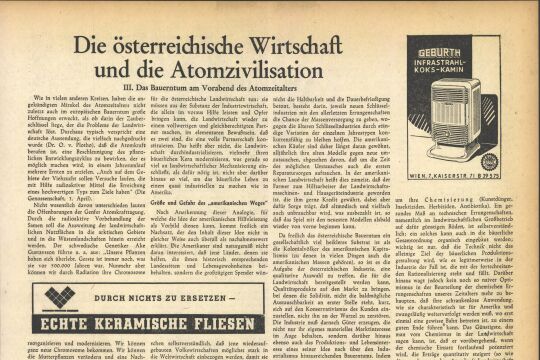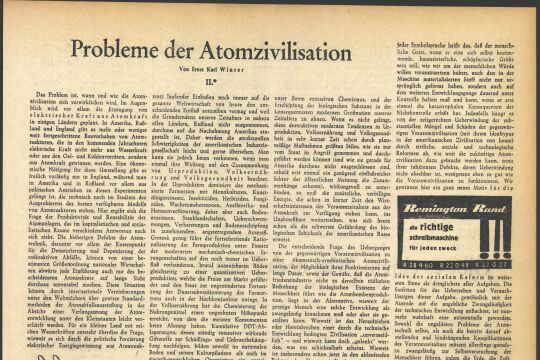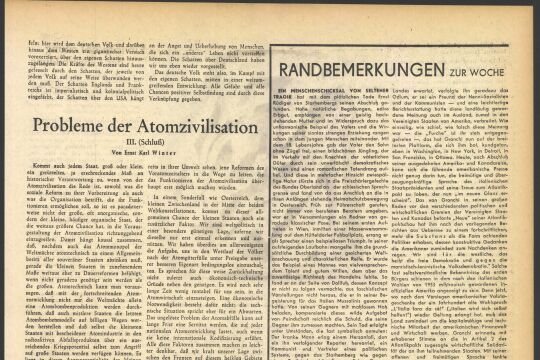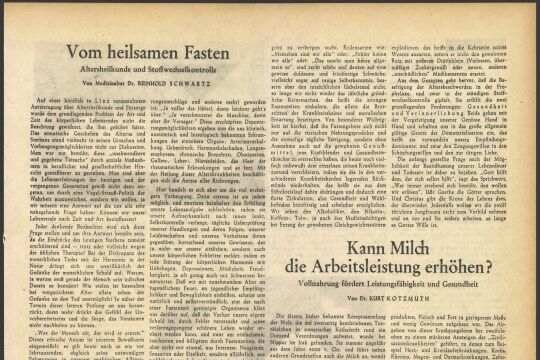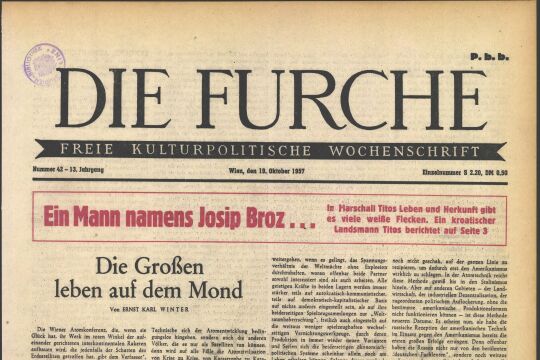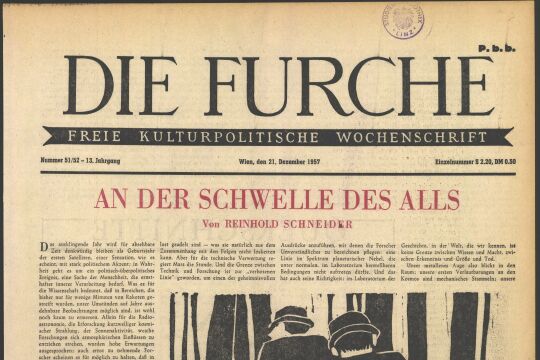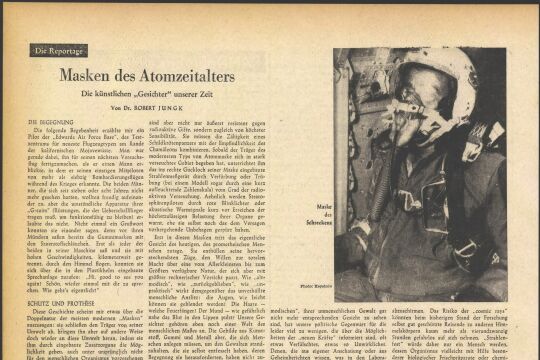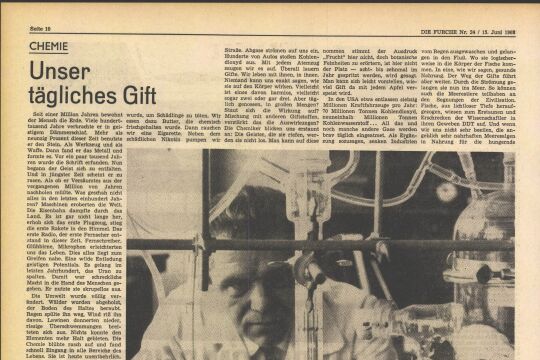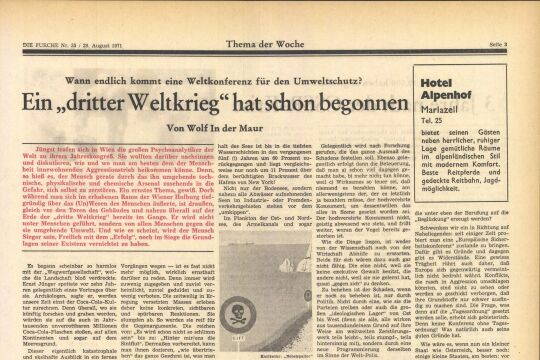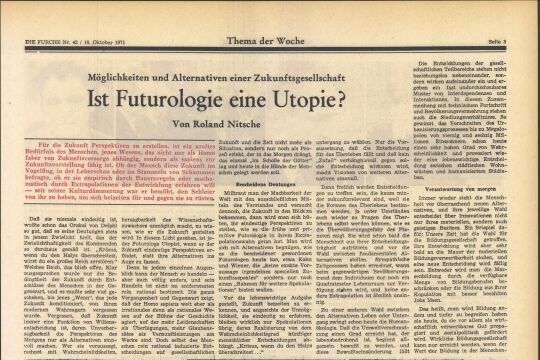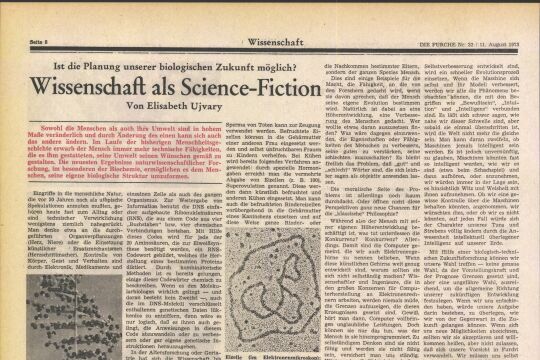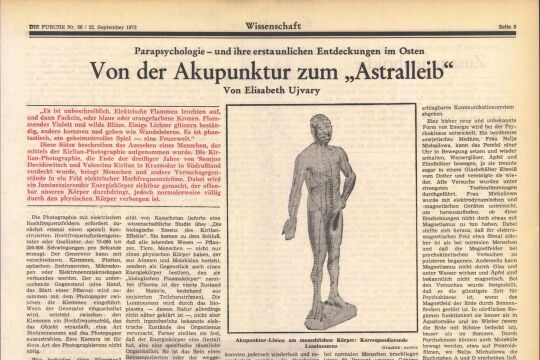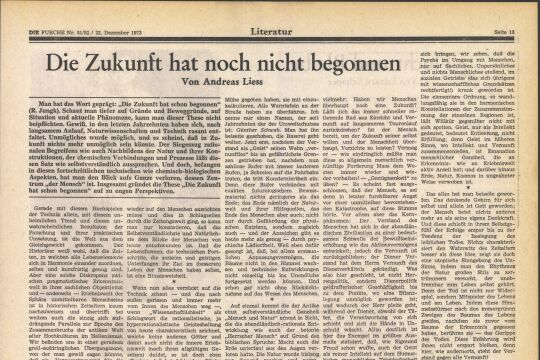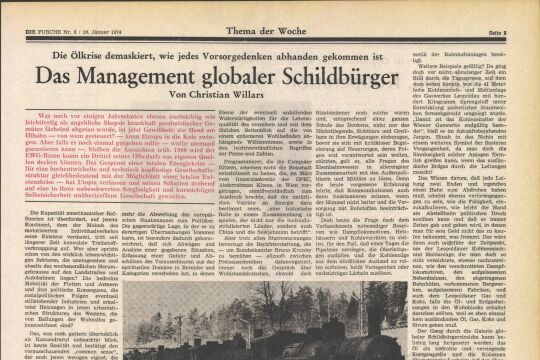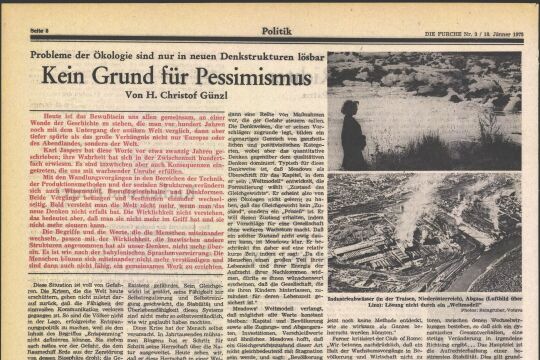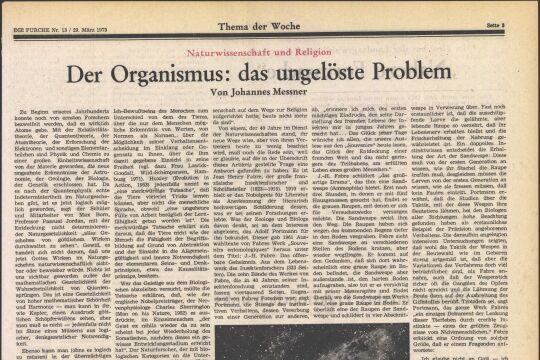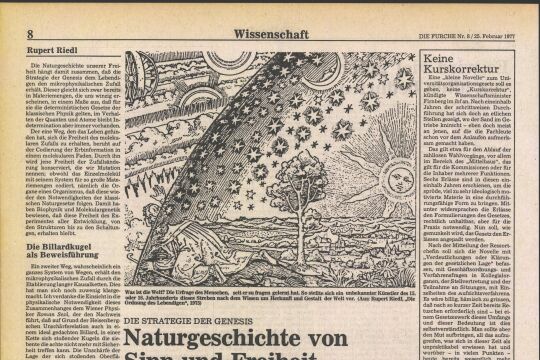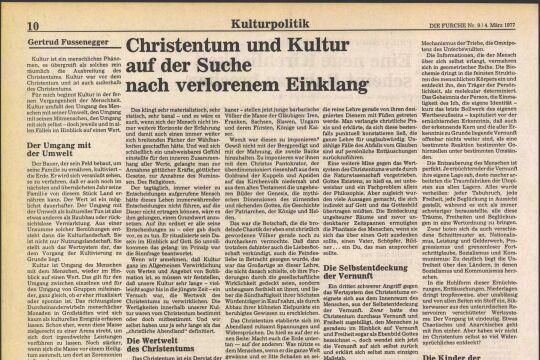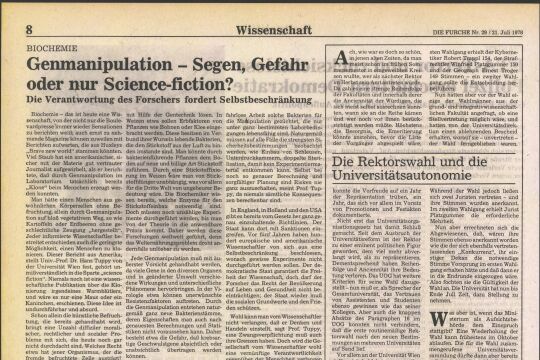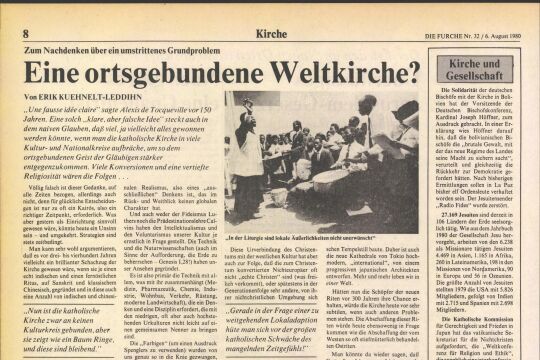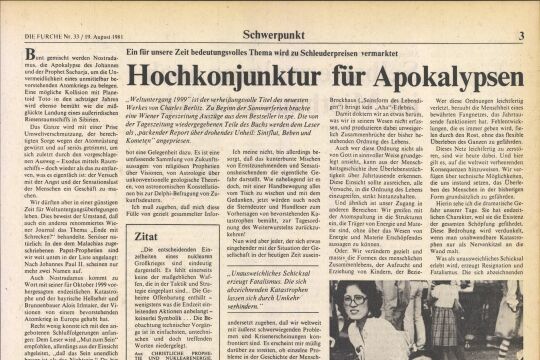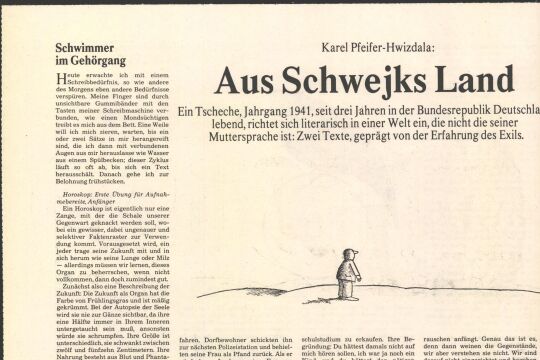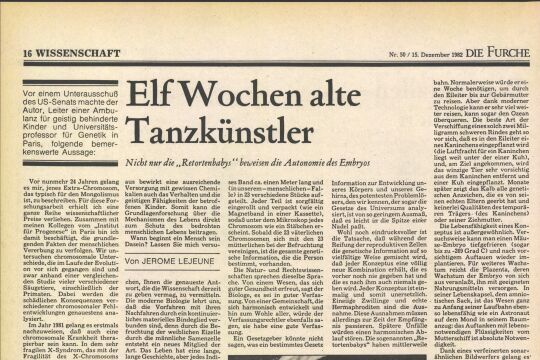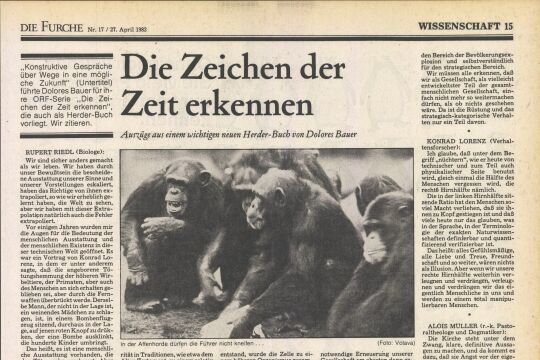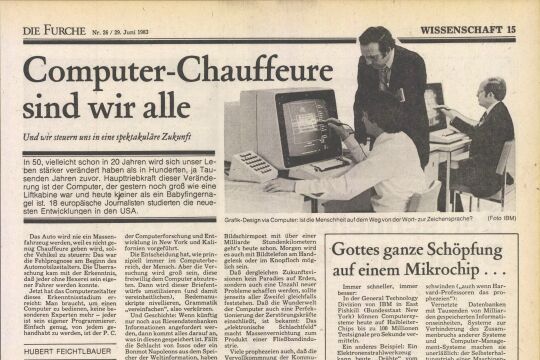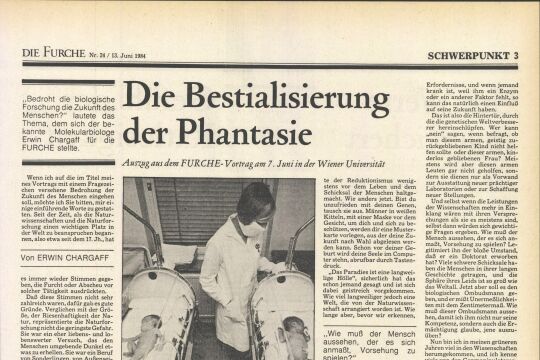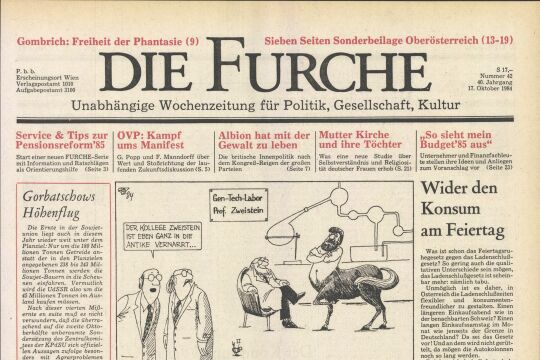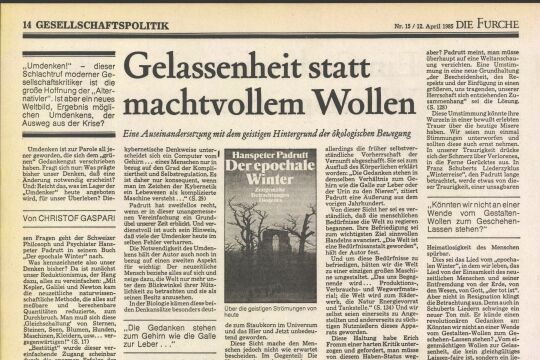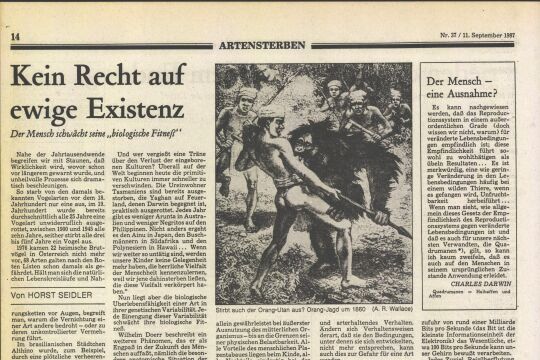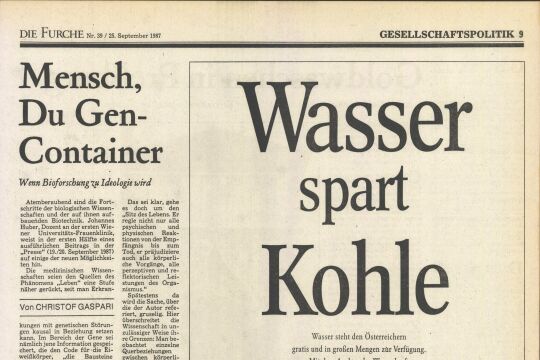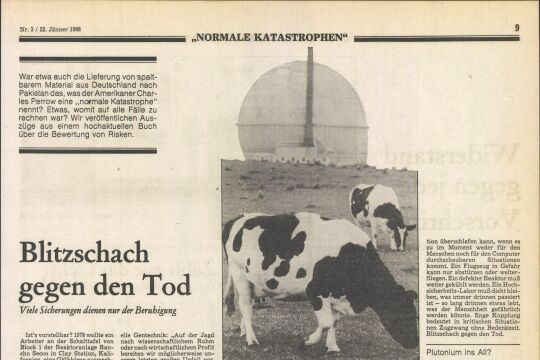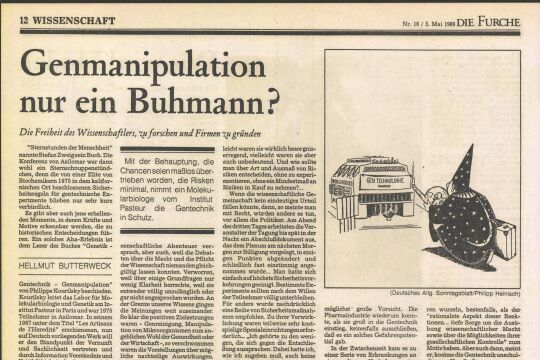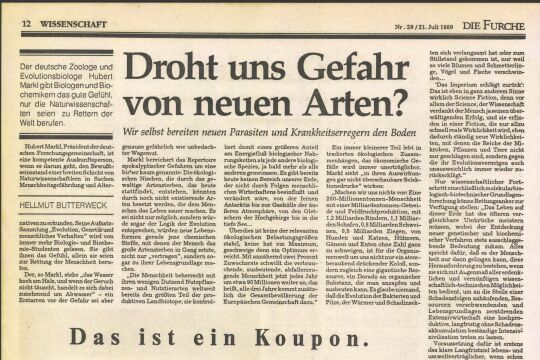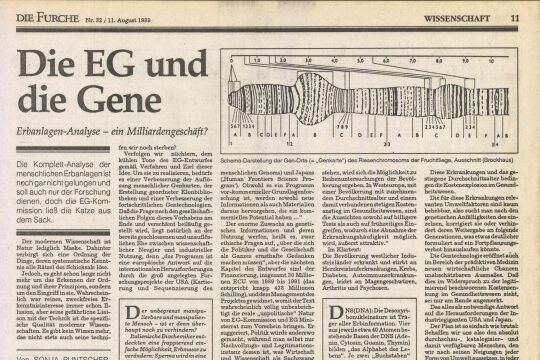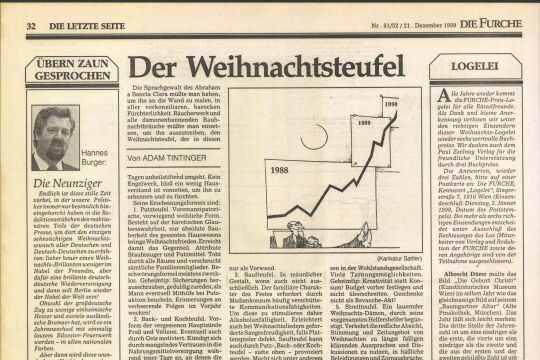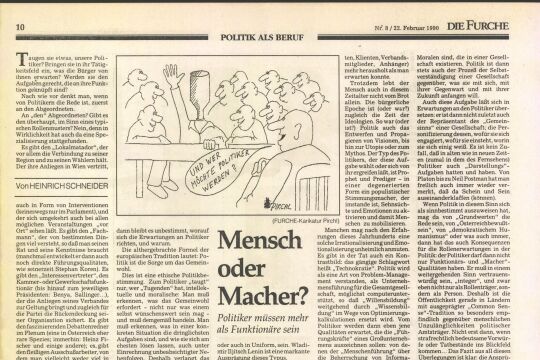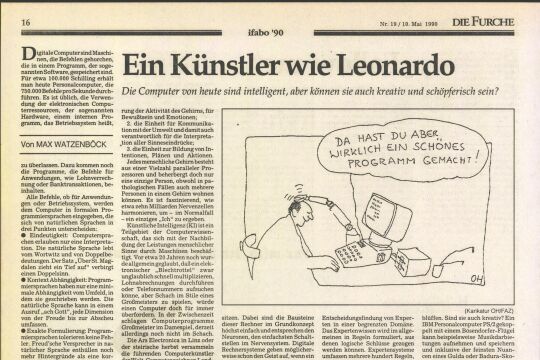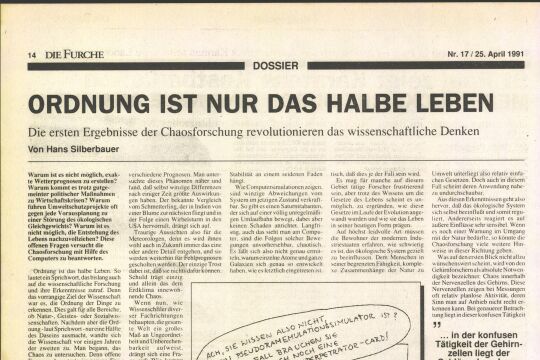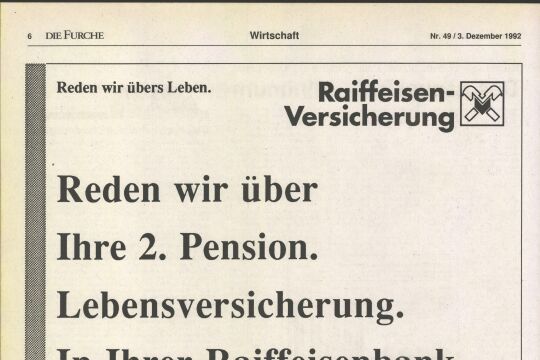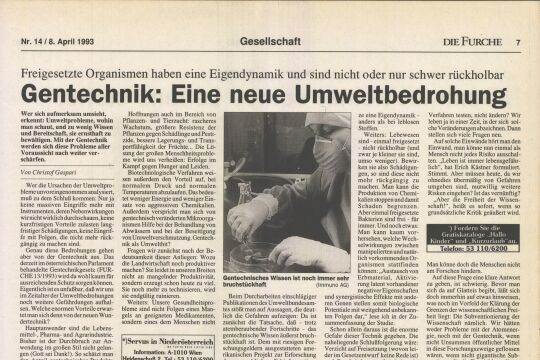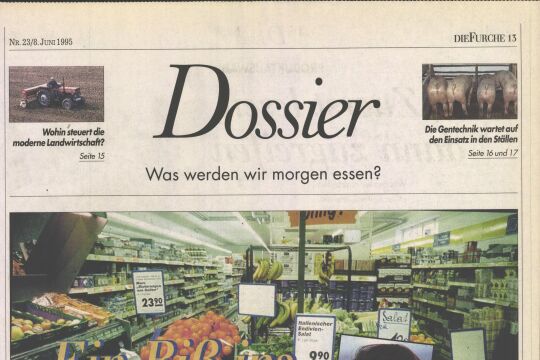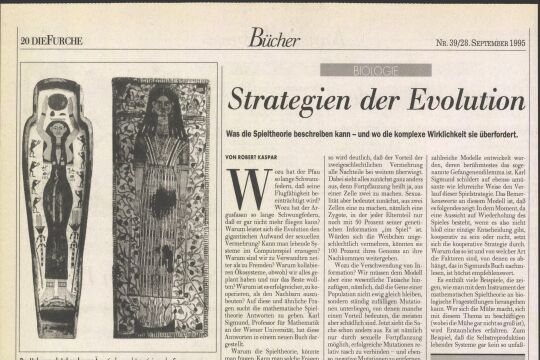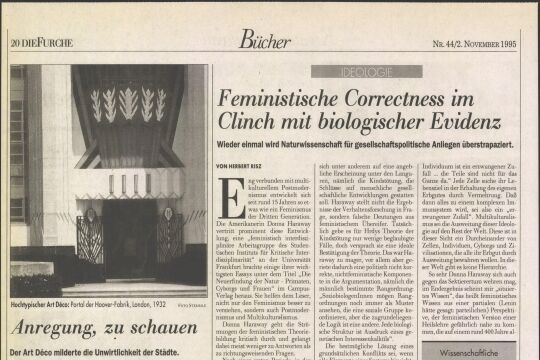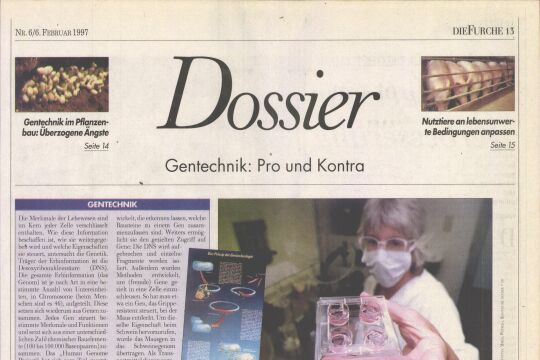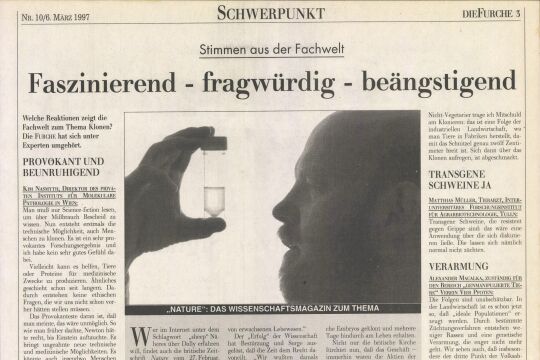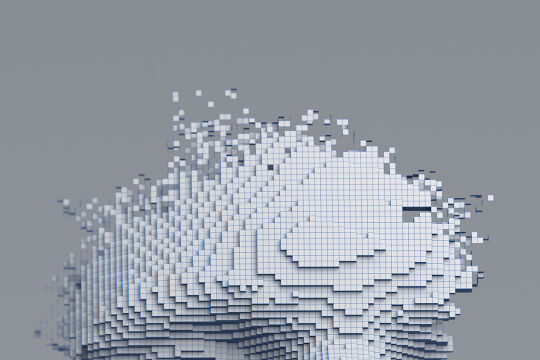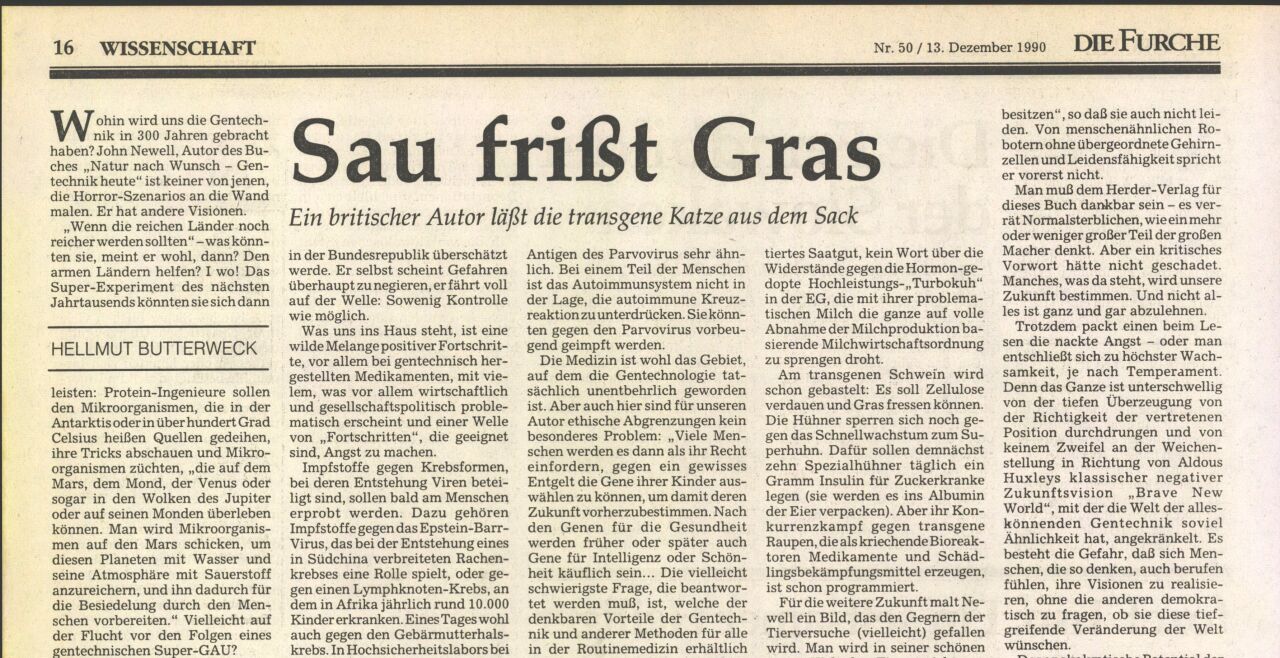
Wohin wird uns die Gentechnik in 300 Jahren gebracht haben? John Newell, Autor des Buches „Natur nach Wunsch - Gentechnik heute" ist keiner von jenen, die Horror-Szenarios an die Wand malen. Er hat andere Visionen.
„Wenn die reichen Länder noch reicher werden sollten" -waskönn-ten sie, meint er wohl, dann? Den armen Ländern helfen? I wo! Das Super-Experiment des nächsten Jahrtausends könnten sie sich dann leisten: Protein-Ingenieure sollen den Mikroorganismen, die in der Antarktis oder in über hundert Grad Celsius heißen Quellen gedeihen, ihre Tricks abschauen und Mikroorganismen züchten, „die auf dem Mars, dem Mond, der Venus oder sogar in den Wolken des Jupiter oder auf seinen Monden überleben können. Man wird Mikroorganismen auf den Mars schicken, um diesen Planeten mit Wasser und seine Atmosphäre mit Sauerstoff anzureichern, und ihn dadurch für die Besiedelung durch den Menschen vorbereiten." Vielleicht auf der Flucht vor den Folgen eines gentechnischen Super-GAU?
Das mögliche Gefahrenpotential der Gentechnik blendet Newell ebenso aus wie die grausige Vision einer in Richtung Konformismus und Beherrschbarkeit manipulierbaren Menschheit.
Er zitiert die Botschaft, welche die Präsidenten der deutschen Wissenschaftsorganisationen vor der letzten Lesung des deutschen Gentechnikgesetzes an die Fraktionsvorsitzenden richteten, daß die Gefährlichkeit der Gentechnologie in der Bundesrepublik überschätzt werde. Er selbst scheint Gefahren überhaupt zu negieren, er fährt voll auf der Welle: Sowenig Kontrolle wie möglich.
Was uns ins Haus steht, ist eine wilde Melange positiver Fortschritte, vor allem bei gentechnisch hergestellten Medikamenten, mit vielem, was vor allem wirtschaftlich und gesellschaftspolitisch problematisch erscheint und einer Welle von „Fortschritten", die geeignet sind, Angst zu machen.
Impfstoffe gegen Krebsformen, bei deren Entstehung Viren beteiligt sind, sollen bald am Menschen erprobt werden. Dazu gehören Impfstoffe gegen das Epstein-Barr-Virus, das bei der Entstehung eines in Südchina verbreiteten Rachenkrebses eine Rolle spielt, oder gegen einen Lymphknoten-Krebs, an dem in Afrika jährlich rund 10.000 Kinder erkranken. Eines Tages wohl auch gegen den Gebärmutterhalskrebs. In Hochsicherheitslabors bei Salisbury, Australien, wird ein Impfstoff gegen das gefürchtete Lassafieber entwickelt.
Auch gegen die infektiöse rheumatoide Arthritis ist für einen Teil der Patienten gentechnologische Hilfe in Sicht. Bei ihnen ist nach neuen Erkenntnissen sehr wohl ein Virus im Spiel. Bei dessen Bekämpfung durch das Immunsystem wird zugleich das körpereigene Gewebe der Gelenke angegriffen Antigene der Gelenkknorpel sind dem Antigen des Parvovirus sehr ähnlich. Bei einem Teil der Menschen ist das Autoimmunsystem nicht in der Lage, die autoimmune Kreuzreaktion zu unterdrücken. Sie könnten gegen den Parvovirus vorbeugend geimpft werden.
Die Medizin ist wohl das Gebiet, auf dem die Gentechnologie tatsächlich unentbehrlich geworden ist. Aber auch hier sind für unseren Autor ethische Abgrenzungen kein besonderes Problem: „Viele Menschen werden es dann als ihr Recht einfordern, gegen ein gewisses Entgelt die Gene ihrer Kinder auswählen zu können, um damit deren Zukunft vorherzubestimmen. Nach den Genen für die Gesundheit werden früher oder später auch Gene für Intelligenz oder Schönheit käuflich sein... Die vielleicht schwierigste Frage, die beantwortet werden muß, ist, welche der denkbaren Vorteile der Gentechnik und anderer Methoden für alle in der Routinemedizin erhältlich sein sollten und welche als Luxus betrachtet werden müßten, für den der einzelne voll und ganz aus eigener Tasche bezahlen muß."
Newell über Jeremy Rifkin, der in den USA durch eine Klage erreichte, „daß alle zukünftigen gentechnischen Versuche am Menschen öffentlich diskutiert und von der Öffentlichkeit gebilligt werden müssen, bevor man weiterarbeiten darf: Das hört sich gut an, aber es könnte zu endlosen Verzögerungen bei medizinischen Fortschritten führen."
Selbstverständlich sieht Newell Leistungssteigerungen in der Landwirtschaft mit gentechnologischen Methoden kritiklos positiv. Kein Wort über die negativen gesellschaftlichen Veränderungen in der Dritten Welt, etwa in Südostasien (FURCHE 33/1990) durch patentiertes Saatgut, kein Wort über die Widerstände gegen die Hormon-ge-dopte Hochleistungs-„Turbokuh" in der EG, die mit ihrer problematischen Milch die ganze auf volle Abnahme der Milchproduktion basierende Milchwirtschaftsordnung zu sprengen droht.
Am transgenen Schwein wird schon gebastelt: Es soll Zellulose verdauen und Gras fressen können. Die Hühner sperren sich noch gegen das Schnellwachstum zum Su-perhuhn. Dafür sollen demnächst zehn Spezialhühner täglich ein Gramm Insulin für Zuckerkranke legen (sie werden es ins Albumin der Eier verpacken). Aber ihr Konkurrenzkampf gegen transgene Raupen, die als kriechende Bioreaktoren Medikamente und Schädlingsbekämpfungsmittel erzeugen, ist schon programmiert.
Für die weitere Zukunft malt Newell ein Bild, das den Gegnern der Tierversuche (vielleicht) gefallen wird. Man wird in seiner schönen neuen Welt den Tieren nicht nur diese Leiden ersparen können, sondern auch das Gegessenwerden -und somit gleich die ganze Existenz: „In beiden Fällen könnte die Gentechnik das Leiden von Tieren beenden. Zuchttiere, die zur Fleischgewinnung getötet werden, könnten und sollten durch Zellkulturen von Säugerzellen, denen zusätzlich Gene für Geschmack und Konsistenz eingeschleust wurden, ersetzt werden... In Rindfleisch könnte Meerrettich- oder Senfgeschmack, in Lammfleisch Pfefferminzgeschmack eingebaut werden."
Wenn schon für Tierversuche ganze Tiere nötig sind, könnte man sie, so Newell, in der Weise verändern, daß die Versuchstiere „keine übergeordneten Gehirnzellen, die für das Bewußtsein zuständig sind, besitzen", so daß sie auch nicht leiden. Von menschenähnlichen Robotern ohne übergeordnete Gehirnzellen und Leidensfähigkeit spricht er vorerst nicht.
Man muß dem Herder-Verlag für dieses Buch dankbar sein - es verrät Normalsterblichen, wie ein mehr oder weniger großer Teil der großen Macher denkt. Aber ein kritisches Vorwort hätte nicht geschadet. Manches, was da steht, wird unsere Zukunft bestimmen. Und nicht alles ist ganz und gar abzulehnen.
Trotzdem packt einen beim Lesen die nackte Angst - oder man entschließt sich zu höchster Wachsamkeit, je nach Temperament. Denn das Ganze ist unterschwellig von der tiefen Überzeugung von der Richtigkeit der vertretenen Position durchdrungen und von keinem Zweifel an der Weichenstellung in Richtung von Aldous Huxleys klassischer negativer Zukunftsvision „Brave New World", mit der die Welt der alles-könnenden Gentechnik soviel Ähnlichkeit hat, angekränkelt. Es besteht die Gefahr, daß sich Menschen, die so denken, auch berufen fühlen, ihre Visionen zu realisieren, ohne die anderen demokratisch zu fragen, ob sie diese tiefgreifende Veränderung der Welt wünschen.
Das apokalyptische Potential der Gentechnologie wird teils wegdisputiert, teils verschwiegen. Newell verbittet sich Vergleiche zwischen Gentechnologie und Kernenergie, operiert aber mit der Logik, die bei der Kernenergie so lang funktioniert hat, wonach das Ausbleiben eines Unglücks beweist, daß es sich auch in Zukunft nicht ereignen wird. Nun ist der gentechnische Super-GAU, das Entstehen und Entweichen irgendeiner mörderischen Lebensform, zwar vielleicht unwahrscheinlich, vielleicht fast unmöglich, aber keinesfalls total auszuschließen.
Sollten eines Tages vermehrungsfähige neuen Lebensformen freigesetzt werden, käme es möglicherweise zur chemischen Kontamination aller irdischen Lebensräume durch eine durchsetzungsfähige neue Flora und Fauna, der kein Regen- und kein sonstiger Wald, kein Wattenmeer, kein Korallenriff und auch nicht die Artengemeinschaft einer Wiese standhält. Ein Naturwissenschaftler, der behaupten wollte, das dadurch gegebene Gefahrenpotential auch nur annähernd quantifizieren oder die indirekten, irreversiblen Auswirkungen „korrigierender" Eingriffe in komplexe Ökosysteme abschätzen zu können, würde sich belügen, oder die anderen, oder beides.
Den Menschen gefährdet weniger die Unmöglichkeit, die Folgen seiner Eingriffe in das Ökosystem Erde in ihrer ganzen Komplexität durchschauen oder gar „planen" zu können, als vielmehr seine Unfähigkeit, zu einem Konsens über die Verringerung dieser Eingriffe zu gelangen.
NATUR NACH WUNSCH? Gentechnologie heute. Von John Newell. Herder Verlag, Freiburg 1990.222 Seiten, Fotos, Pb., öS 310,40.