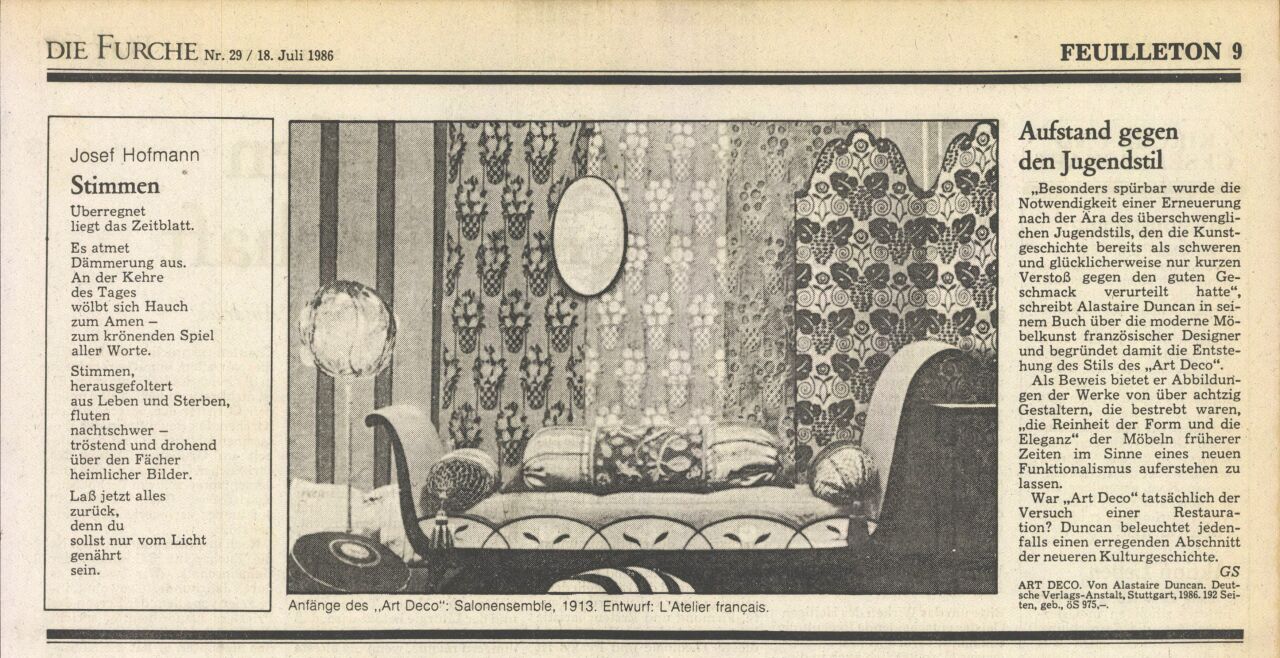
Es würde lohnen, amtliche Verordnungen daraufhin durchzugehen, wieweit in jeder von ihnen verborgene und in der Geläufigkeit aufgelöste Vergleiche enthalten sind. Man sagt das so und schreibt es einfach hin, ohne sich Rechenschaft abzulegen, ja, zu einem Teil, ohne auch nur zu ahnen; wieviel Elemente der Kunstsprache man unbesehen anwendet — wenn etwa ein Urteil „erfließt“. Aber man sollte den kleinen Ausflug ins Innere der Sprache nicht scheuen, der dadurch besonders interessant wird, daß er eigentlich in die Prähisto-
rie und nicht so sehr in die landschaftliche Breite führt.
Man nehme die Alltagsworte „blühender Unsinn, schwindelnde Höhe, rasende Geschwindigkeit, sprechende Ähnlichkeit, beredtes Schweigen“. Das sind Wortfiguren, die wir ganz ohne Aufsehen gebrauchen; sie gehören teils in die Gruppe der Personifikation, teils stellen sie eine Metonymie (Vertauschung) dar oder sind als Oxymoron (Zusammenprall gegensätzlicher Begriffe) einzuordnen. „Nach Freiheit strebt der Mann, das Weib nach Sitte“, sagte Goethe unter Weglassung des Verbums für den zweiten Hauptsatz, und dieser mehr im Grammatischen beheimateten Figur folgt die Umgangssprache gern, weil ihr die Verkürzung entgegenkommt. „Die roten Gutscheine sind abzuliefern, die gelben nicht.“
Die als Hyperbel bekannte Redefigur endlich verkehrt mit Alltagssätzen wie unter ihresgleichen; eine „Welt in Waffen“ wird heute—leider - nicht mehr als hyperbolisch, übertreibend, empfunden.
Das also ist geläufig, es wird aber in der wissenschaftlichen Rhetorik ergänzt durch Redefiguren, die bei uns kaum mehr Einganghaben; so das Hysteron-Proteron („Laßt uns sterben, uns auf die Pferde stürzen“), wo das Wesentliche, das Sterben, vorweggenommen und damit die Vertauschung der Zeiten erreicht wird, die man von Paul Claudel gut kennt.
Nicht unwichtig ist die Synekdoche, die Veranschaulichung eines abstrakten Sachverhaltes durch ein Konkretum: etwa „Zepter“ statt „Macht“. Sie ist wohl zu unterscheiden von dem Pars pro toto: „Tausend Köpfe“ statt „Tausend Menschen“. Nun sind wir einer schwierigen Figur ganz nahe (schwierig nur in der Unterscheidung von einer andern) — dem Pleonasmus: „Ich habe den Tisch mit Geld gekauft“. Eine
Tautologie: „Ich habe den Tisch gekauft und erstanden“. Was ist da eigentlich verschieden, wo doch beide das Gleiche zweimal sagen? Im ersten Falle wurde nur eine Aussage verstärkt; „gekauft“, wie man eben kauft, „mit Geld“. Im zweiten ist aber zweimal das gleiche gesagt, „Kaufen“ und „Erstehen“. Der Pleonasmus unterstreicht, verstärkt; während die Tautologie zweimal das gleiche sagt. Und in beiden Fällen kommt eine Kunstwirkung heraus.
Wollten wir immer „nach der Schnur sprechen“, weil wir sonst „mit Silben zu Tode gestochen würden“, so stünde die Gefahr der Verarmung näher, als daß eine Reinigung der Sprache erreicht würde. Hingegen entbindet uns nichts von der Verpflichtung, den Worten ins Gesicht zu sehen und etwa zu erkennen, daß der Satz
„Seine Neigung schlug um“ eine geradezu komische Wirkung auf denjenigen ausübt, der in Bildern zu lesen gelernt hat, indem er einen sich neigenden Menschen plötzlich umschlagen sieht. Solches Einsehen in Worte ist stets ergiebig. Geht man mit einem Wort ins Gericht, kommt man meist mit mehreren heraus; ja, ein Wort fassen heißt, bereits ein anderes halten; man braucht ein Wort nur kurz zu fixieren, schon schickt es seine Zeugen.
Worte sind aber- Schatten der Wirklichkeit; es gibt keine Worte ohne Wirklichkeit. Sie bilden ab. Dabei kommt es wieder auf das Licht an, wie es trifft; sie sind unendlich ähnlich und unermeßlich verschieden. Dem Wortdenker wird es daher schwerer fallen, sich auszudrücken, als dem unbelasteten Menschen. „Man soll öfter dasjenige untersuchen“, sagt
Lichtenberg, „was so sehr als bekannt angenommen wird, daß es keiner Untersuchung mehr wert geachtet wird“. Man wird zu erstaunlichen Resultaten kommen. Man wird nicht mehr den Mut haben, einen Eindruck als aufgehoben zu betrachten, denn das Wort „Eindruck“ wird uns mit einer plastischen Vorstellung gesegnet haben, so daß er nicht „aufgehoben, emporgehoben“ werden kann. Wie hat doch Nestroy mit solchem Sprachblick, ja zweitem Gesicht begabt, in den Mantel eines Possenreißers gehüllt, wortzuspielen gewußt! Auf die Frage nach einem Abwesenden antwortet Titus im „Talisman“:
„Er betreibt ein stilles, abgeschiedenes Geschäft, bei dem die Ruhe seine einzige Arbeit ist; er liegt von höherer Macht gefesselt, und doch ist er frei und unabhän-
gig, denn er ist Verweser seiner selbst; er ist tot.“
Das Rätsel anderen Daseins tönt hier klingend aus einem Scherzwort.
Im Deutschen, als einer sehr rührigen Sprache, ist man unaufhörlich tätig, mit Vor- und.Nachsilben neue Analogiebildungen zu finden, und ist dabei keineswegs immer logisch korrekt, sondern oft sehr tolerant, ja mitunter ausgesprochen salopp, — so daß es am Ende nicht schaden kann, wenn dem Sprecher oder Schreiber auf die Finger gesehen wird. Es ist aber ein Phänomen, mit welcher Gereiztheit polemisiert werden kann, wenn es um Sprachfragen geht.
Man muß die Sache aber dennoch stets von zwei Seiten sehen. Im „Faust“ findet sich „Grün ist des Lebens goldener Baum“, scheinbar ein innerer Widerspruch, weil rein logisch der Baum entweder grün oder golden ist, dennoch aber von einer tiefen und wohl auch weithin erkannten Anschaulichkeit; denn in die statische Darstellung eines grünen Baumes bricht hier auch ihr Gegenbild, das herbstliche Gold, ein, es wird also ein Ablauf einbezogen, so daß, nicht zuletzt, die Herbstlichkeit des Baumgoldes als beherrschendes Symbol über dem Leben steht. Das Sprießen und das Vollenden, die Beständigkeit und die Vergänglichkeit, die Behäbigkeit und die Erhabenheit, Trost und Schwere des Daseins ist in sechs Worten eingefangen.
Das Wichtigste ist, wenn man schreibt, die Verantwortung. „Die Dinge ruhig auf sich wirken zu lassen und den gemäßen Ausdruck suchen“, hat Goethe empfohlen. Der Schreibende muß mit offenen Augen das ansehen, was er niedergeschrieben hat. Ihm einen Zaum anlegen zu wollen, wäre irrig. Wo bliebe denn das kühne Gedankenjenseits Hölderlins, die brave und innige Schreibtischlerei Hebels, wo die Redensartillerie Jean Pauls? Die Analogie ist ein Teil der Bildung der Sprache, der Doppelsinn ist vom Ubersinn nicht weit entfernt.
Antithesen stoßen Fenster auf, durch welche frische Luft hereindringt; oft sprengt ein Witz die Himmelsdecke und öffnet den Blick nach oben, wenn der Dunst zu drücken auf unserer Brust gelegen ist.
