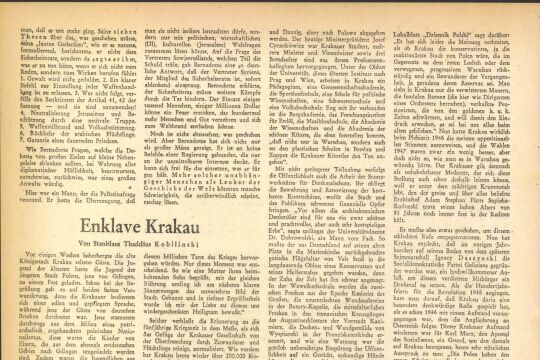Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Schluß mit dem Theater um Waffen: Amnestie muß endlich her!
Daß bei der Iran-Waffenaffäre Gesetze gebrochen wurden, bestreitet heute niemand mehr. Bis auf „Die ganze Woche“, für die die Strafverfolgung der Noricum-Manager der eigentliche Skandal ist.
Daß bei der Iran-Waffenaffäre Gesetze gebrochen wurden, bestreitet heute niemand mehr. Bis auf „Die ganze Woche“, für die die Strafverfolgung der Noricum-Manager der eigentliche Skandal ist.
Im Inventurverkauf der Republik gibt's derzeit Skandale mit Mengenrabatt Die „Iran-Waffenaffäre“ ist dabei ein Sonderangebot, wenn auch kein billiges. Sie hat das Unternehmen (und letztlich die Steuerzahler) Milliarden gekostet und überdies, so meint beispielsweise der „Rheinische Merkur“, „nicht nur die damalige VOEST-Spitze, sondern auch eine entweder blinde oder kompli-zenhafte politische Führung des Landes in Zwielicht gebracht“.
So weit, so schlecht, denkt der Bürger. Aber die Zeitungen versichern ihm, in der Justiz gehe es — dank dem neuen Minister Egmont Foregger - wieder mit rechten Dingen zu. Prominenz schützt nicht mehr vor hochnotpeinlicher Untersuchung und Bestrafung, zumal auch die „vierte Gewalt“, die Presse, nach Kräften mitwirkt, Sümpfe trockenzulegen.
Doch weit gefehlt — manchmal tut sie das Gegenteil: „Die ganze Woche“ rührt in ihrer letzten Nummer kräftig die Trommel für die „Noricum“-Verantwortlichen, die doch „als tüchtige Manager“ nur „ihre Pflicht taten“. Eigentlich sei deren „Kriminalisierung“ und „Skandalisierung eine schlimme Sache“. Früher hätten Leute, die im Interesse der Gemeinschaft bestehende Vorschriften nicht befolgten, sogar Orden bekommen. Die Manager hätten auch gar nicht „in die eigene Tasche gearbeitet“, sondern ,4m Interesse ihrer Unternehmen“ gehandelt; die Gesetzestexte seien halt „unklar“. Das Innenministerium selbst habe doch Waffenexporte nach Libyen genehmigt —in ein Land, das in Konflikte verwickelt ist und „als internationales Ausbildungszentrum für Terroristen gut“. Das soll offenbar heißen: wie kann man den Noricum-Leuten — oder den VOEST-Spitzen, auf die sie sich berufen — gram sein, wenn sie daraufhin das Gesetz erst recht nicht ernst nahmen... ?
Der umgekehrte Schluß, daß. die Exportbewilligung nach Libyen dem Sinn des Gesetzes widersprach und Anlaß zum Einschreiten geben mußte (oder: hätte geben müssen), liegt der „ganzen Woche“ fern; hingegen zitiert sie einen Zentralbetriebsrat: „Das Waffengesetz wurde stets übersensibel ausgelegt...“
Dazu einige Klarstellungen: Das 1977 (nach dem Start der ersten größeren Waffenexporte und nach der Affäre Lütgendorf) beschlossene Gesetz macht Ein-, Aus- und Durchfuhren von Kriegsmaterial genehmigungspflichtig. Weder völkerrechtliche Pflichten noch außenpolitische Interessen Österreichs dürfen verletzt werden. Seit 1982 dürfen Aus- oder Durchfuhren überdies nicht in Gebiete erfolgen, wo ein bewaffneter Konflikt stattfindet, auszubrechen droht, oder wo gefährliche Spannungen herrschen.
Gleiches gilt in bezug auf Länder, in denen schwere und wiederholte Menschenrechtsverletzungen befürchten lassen, daß die Waffen zur Unterdrückung verwendet werden. Schließlich sind auch Lieferungen in Länder unzulässig, die von Embargobeschlüssen der Vereinten Nationen betroffen sind.
Darüber waren Rüstungsunternehmer und -händler schon damals nicht begeistert. Zufrieden waren jedoch nicht nur jene, die sich für die Verschärfung von 1982 stark gemacht hatten; also zum Beispiel .Amnesty international“, die Katholische Aktion, aber auch sozialistische Gruppen. Ob-schon es auch damals Arbeitslose und rote Zahlen der Verstaatlichten gab, wurde die von beiden Großparteien beschlossene Novelle positiv kommentiert. Das Verbot, Waffen in Konfliktgebiete und an Gewaltregime zu liefern, erschien als ein Akt moralischer Selbstdisziplin.
Doch Moral beiseite - der „ganzen Woche“ ist es um etwas anderes zu tun: um die Tüchtigkeit der Manager, die nur ihre Pflicht getan haben. Nun hat es mit dem „Nur-die-Pflicht-Tun“ und den Standards dafür eine eigene Bewandtnis; darüber ist jüngst viel diskutiert worden, doch das gehört nicht hierher.
Daß bei der Iran-Waffenaffäre Rechtspflichten gröblichst mißachtet wurden, wird außer der „ganzen Woche“ hoffentlich niemand bestreiten. Was aber die rühmenswerten Verdienste der Gesetzesbrecher und ihrer Mitwisser betrifft, so weiß ÖIAG-Chef Hugo Michael Sekyra ein Lied davon zu singen, was sie dem Konzern (und uns allen) eingebrockt haben: einen „schrecklichen Rückschlag“ habe man durch „die Waffengeschichte“ erlitten, zumal so etwas „die ganze VOEST wieder um Jahre in der Motivation zurückwirft“, bekannte er in einem Interview.
Erfreulich ist aber seine Aussage, die Umstellung auf Zivilproduktion müsse jetzt konzentriert noch einmal untersucht werden. Das haben Sachkenner schon oft gefordert, weil das Waffengeschäft für Osterreich auf Dauer wenig Chancen bietet: der Markt ist labil, und was wir zu bieten haben, können Länder wie Brasilien oder Argentinien demnächst oder schon heute weit kostengünstiger liefern.
Dem wird zwar immer wieder entgegengehalten: Muß Osterreich nicht der Neutralität zuliebe Waffen für den Eigenbedarf produzieren? Zwingt das nicht zum Export, weil erst Großserien rentabel sind, die ein Vielfaches des Eigenbedarfs umfassen? Dieses Argument hinkt. Die Selbstversorgung des Bundesheers ist eine Utopie; höchstens die Hälfte seiner Waffen- und Munitionsausstattung stammt aus heimischen Fabriken, Auslandsabhängigkeit wird es immer geben.
In Wirklichkeit ist schon der „Made in Austria“-Anteil von 50 Prozent manipuliert: Kaufte man die besten Systeme zum günstigsten Preis, dann wäre der Anteil an Fremdmaterial noch größer. Nicht wenige Militärs würden sich lieber die beste Ausrüstung wünschen, die man für das vorhandene Geld bekäme. Stattdessen wurden dem Bundesheer schon Produkte aufgedrängt, die dem wirklichen Bedarf nur mit Ach und Krach entsprechen, jedenfalls aber nicht der militärischen Dringlichkeitsliste. Das von den Rüstungsproduzenten so gern verwendete Argument des Eigenbedarfs ist also mit äußerster Vorsicht zu genießen.
Sicher, eine ausschließliche Fremdausstattung der Armee wäre problematisch, vor allem psychologisch: der österreichische Soldat sollte ein Gewehr in die Hand bekommen, das weder ein amerikanisches noch ein sowjetisches Typenschild trägt. Aber die Aufrechterhaltung einer heimischen „Basisproduktion“ dieser ( Art ist etwas anderes als die Forcierung einer exportorientierten Rüstungsindustrie, für die der Bundesheerbedarf womöglich nur vorgeschoben wird und die den Wettbewerb am Weltmarkt nicht durchstehen könnte.
Es ist Zeit, aus dem allem Konsequenzen zu ziehen; aber die richtigen - nicht jene, die „Die ganze Woche“ ihren Lesern einreden will. Dabei geht es nicht um drakonische Strafen für Unter-weger & Co., wohl aber um die Selbstachtung des Rechtsstaates Osterreich. Zugleich aber auch um eine Unternehmenspolitik, die das Recht achtet und zugleich den Interessen der VOEST-Arbeiter und der Steuerzahler gerecht wird. Diese Interessen an den Rüstungsmarkt zu binden, wäre unseriös.
Es ist höchste Zeit, die Realität zur Kenntnis zu nehmen und den moralischen Inventurverkauf zu beenden.
Der Autor ist Professor für Politikwissen-ichaft an der Universität Wien.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!