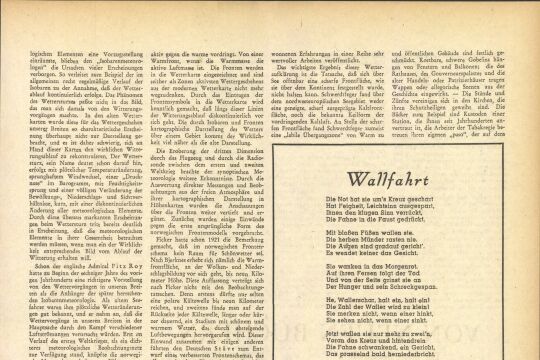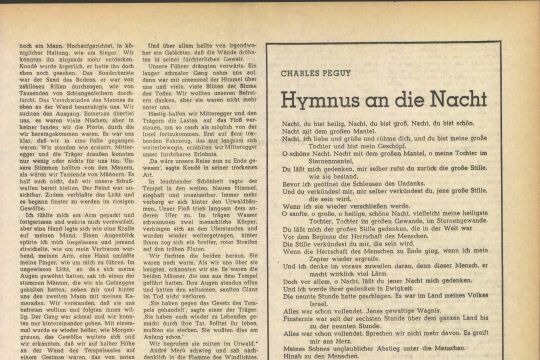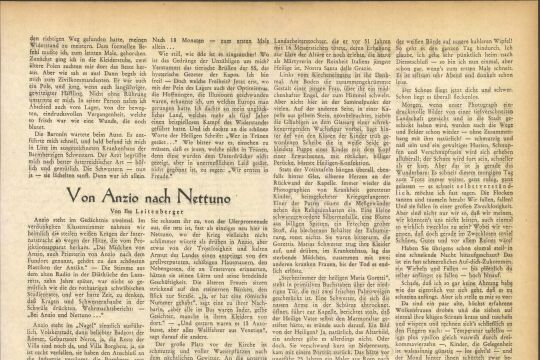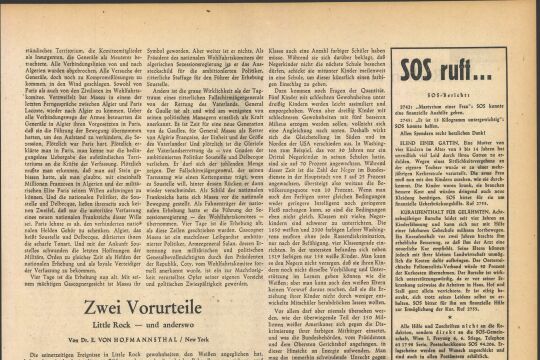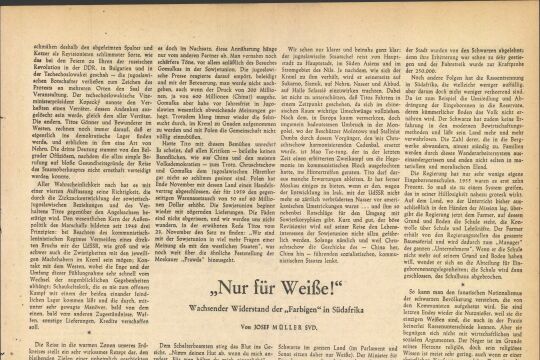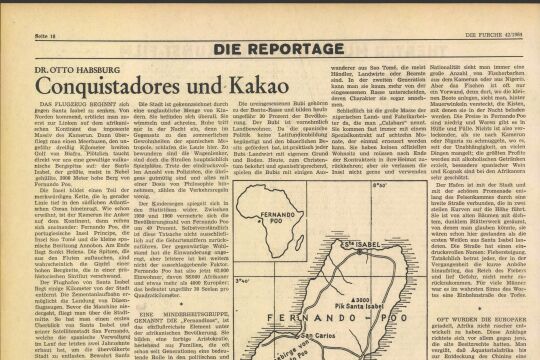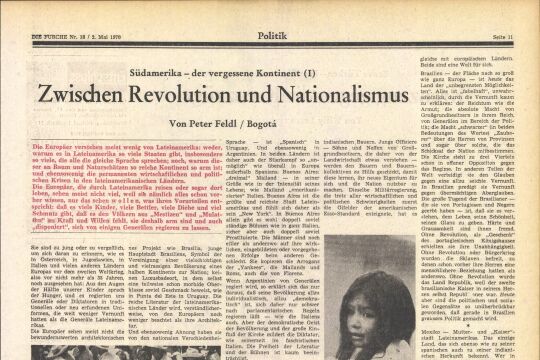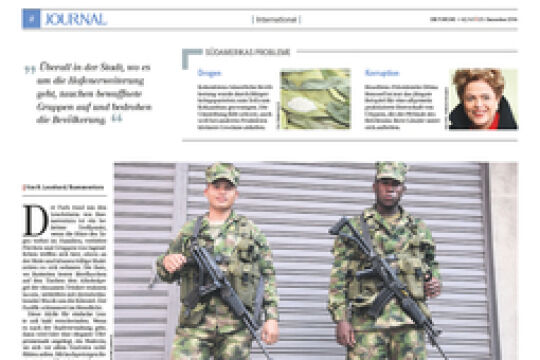Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Schnaps und Gebete
Wie in anderen Ländern Lateinamerikas stehen auch in Mexiko die Indianer auf der niedrigsten sozialen Stufe. Vom sogenannten Fortschritt profitieren sie am allerwenigsten. Hilflos sehen sie sich behördlichen Übergriffen ausgeliefert, der Staat vermarktet seine Ureinwohner als billige Arbeitskräfte und begehrte Touristenattraktion.
Wie in anderen Ländern Lateinamerikas stehen auch in Mexiko die Indianer auf der niedrigsten sozialen Stufe. Vom sogenannten Fortschritt profitieren sie am allerwenigsten. Hilflos sehen sie sich behördlichen Übergriffen ausgeliefert, der Staat vermarktet seine Ureinwohner als billige Arbeitskräfte und begehrte Touristenattraktion.
Chiapas ist der südlichste Bundesstaat Mexikos, zugleich einer der ärmsten mit einem der höchsten Indio-Anteile in der Bevölkerung. Seine heimliche Hauptstadt ist San Cri-stöbal de las Casas, das 1528 von den Spaniern nach blutigen Kämpfen mit den heute noch ansässigen Chamula-Indianern gegründet wurde.
Das Zentrum der 100.000-Einwoh-nerstadt ist blankgeputzt, der Autoverkehr hält sich in erträglichen Grenzen, allenthalben rufen Schilder die Einheimischen auf, ihre Stadt sauber zu halten. San Cristöbal will attraktiv bleiben für die Tausenden Touristen, die Jahr für Jahr kommen, für die vielen Indianerforscher, die ihren Studien nachgehen und für die große Zahl westlicher Aussteiger, die sich hier für einige Zeit oder für immer niedergelassen haben.
Beim Frühstück kann man wählen zwischen Ham-and-Eggs, huevos rancheros, Obstsalat mit Joghurt, Cornflakes oder Müsli; die Buchhandlungen bieten nicht nur Kulturführer über Maya-Pyramiden, sondern auch englisch- und französischsprachige Literatur an und in manchen Hotels liegt neben der „Time" und der „Newsweek" auch der „Spiegel" auf. Ein geschmackvoll eingerichtetes Literaturcafe bringt abends Live-Musik oder im dazugehörigen Cine-Club einen anspruchsvollen Film; an den strahlend weißen Wänden hängen prachtvoll fotografierte Porträts mexikanischer Frauen. Auch eine Indianerin ist darunter. Sie trägt ihr pechschwarzes Haar offen und lacht über das ganze Gesicht. Der Sänger, der ohne viel Temperament bolivianische Protestlieder vorträgt, macht eine Pause, und ein kleiner schmuddeliger Indio-Junge schlüpft bei der Tür herein. Er will seine buntbestickten Püppchen verkaufen, das Stück um umgerechnet fünf Schilling. Die wohlgekleideten amerikanischen Gäste winken vornehm ab, die-eben-so wohlgekleideten - Mexikanerinnen und Mexikaner beachten den Buben nicht einmal. Die Kellnerin stellt ihm an einem unbesetzten Tisch einen Teller mit Avocadobrei und einem Stück Tortilla hin, was der Kleine genüßlich verputzt.
Die Pause ist zu Ende, und der blutleere Barde von vorhin besingt wieder das Elend der Unterdrückten. Vor dem Lokal wird der kleine Indianer bereits von seiner Mutter und etwa einem halben Dutzend Geschwistern erwartet, eine Schwester trägt das Jüngste in einem Tuch am Rücken.
Überall in San Cristöbal begegnet man Indianerkindern und älteren Indianerfrauen, die Gürtel, Brillenetuis, Armbänder oder Kaugummis verkaufen. Die meisten laufen barfuß, einige tragen Plastiksandalen, die aus einem Stück gegossen sind. Allesamt sind sie nach europäischen Maßstäben mehr oder weniger schmutzig, die
Hosen, T-Shirts oder Kleider zerschlissen.
Vor der Kathedrale Santo Domingo sitzen die besser situierten Indios. Auch sie fahren jeden Morgen aus den umliegenden Dörfern in die Stadt, aber sie verfügen über einen fixen Platz, an dem sie Blusen, Wandteppiche, Tischdecken und Taschen feilbieten.
Vom Handeln - wie sonst auf Märkten üblich - halten sie nichts: Die Waren haben ihre fixen Preise, zumindest für die Gringos, und sind verhältnismäßig teuer. Die Geschäfte werden fast ausnahmslos von Frauen abgewickelt - verkaufende Indio-Männer sind eine absolute Rarität. Sie streifen zwar unaufhörlich in ihren schwarzen Ponchos und weißen Hüten durch die Straßen, viel zu tun scheinen sie jedoch nicht zu haben. Kein Wunder, beträgt doch die Arbeitslosenrate im Süden Mexikos etwa 25 Prozent und bei den Indianern noch einiges mehr als bei den übrigen Mexikanern. Die Indio-Männer treten dafür an den Sonntagen in Erscheinung: Da halten sie in den Dörfern der Umgebung, wie etwa in San Juan de Chamula oder in Zinacantan, ihre traditionellen Versammlungen ab, bei denen vor allem juristische und politische Fragen behandelt werden. Die Indianergemeinden besitzen eine begrenzte politische Autonomie und Rechtssprechungsgewalt, welche von gewählten Vertretern wahrgenommen werden.
Der Kirchgang folgt - für europäische Begriffe - recht eigenwilligen Ritualen. Der Boden des Gotteshauses ist mit langen, grünen Föhrennadeln ausgelegt, vor kleinen Kerzen stehen, sitzen oder knien Gruppen von Indios über den ganzen Raum verteilt. Sessel gibt es fast keine, und die Betenden unterhalten sich teils stumm, teils in lauten Gesprächen mit ihren Heiligen. Dies sind sowohl christliche Märtyrer als auch Götter ihrer präkolumbianischen Vorfahren: Die mexikanischen Indios haben sehr vielfältige Arrangements mit dem Christentum geschlossen.
Zwischen den Gebeten nehmen sie ein paar kräftige Schlucke aus den Pepsi- oder Coca-Cola-Flaschen, die jungen Männer und Erwachsenen sprechen häufig dem Schnaps zu.
Das zeigt auch außerhalb der Kirche seine Folgen: ab dem frühen Nachmittag liegen etliche Indio-Männer betrunken auf dem Boden.
In den Städten trifft man zwar allenthalben auf die Schilder anonymer Alkoholiker-Gruppen - unter den Indianern auf dem Land scheint es einstweilen noch kein geeignetes Instrument im Kampf gegen den Alkoholismus zu geben. Vielfach ist es wohl die Mutlosigkeit, die die Indios zur Flasche greifen läßt. Sie wissen, daß sie von ihrer Regierung in Mexico-City ebensowenig zu erwarten haben wie ihre Väter von den spanischen Eroberern.
Sie sind nach wie vor die billigsten Arbeitskräfte, was sich auch mit der Freihandelszone zwischen Kanada, den USA und Mexiko nicht ändern wird. Sie gehören seit jeher zu den Entrechteten, die aufgrund mangelnder Spanischkenntnisse und durch Analphabetentum der Willkür der Behörden schutzlos ausgeliefert sind. Immer wieder werden Indios, aus ihren Häusern, von ihren Grundstücken ohne Entschädigung und Begründung vertrieben, oft und oft werden Indios von der Polizei verschleppt und tauchen nie wieder auf, weil sie für Delikte geradestehen sollen, die sie nicht begangen haben.
Der 12. Oktober, der 500. Jahrestag der Landung Kolumbus', wurde in ganz Mexiko unter dem beschönigenden Motto „Die Begegnung zweier Kulturen" begangen. Dieser Titel drückt recht deutlich die ewige innere Zerrissenheit der Mexikaner aus, die sich einerseits ihren spanischen Eroberern, andererseits aber ihren indianischen Vorfahren verhaftet fühlen. Für die Indios gibt es diese Gespaltenheit nicht: Sie demonstrierten landauf, landab gegen Europa, gegen die USA und vor allem gegen ihren Präsidenten Carlos Sahnas de Gorta-ri, von dem sie sich verraten und betrogen fühlen.
In San Cristöbal skandieren indianische Sprechchöre minutenlang Protestparolen gegen die mexikanische Regierung und marschieren in nicht enden wollenden Kolonnen über den Hauptplatz. Da ist nichts mehr zu merken von bettelnden Lumpenkindern und folkloristischem Markttreiben - teils selbstbewußt und teils verzweifelt schreien die Männer und Frauen ihre Vorwürfe in den Himmel: „Wir werden seit 500 Jahren verraten, bestohlen und getötet. Von Europa und von unseren Regierenden." Auf einem maschinegeschriebenen Flugblatt listet eine Indio-Organisation auf, wie die Behörden mit der Urbevölkerung verfahren: Verweigerung der Ausstellung von Geburts- und Sterbeurkunden, Plünderung von Häusern, Zerstörung des Lokals der Organisation, ungerechtfertigte Haft- und Geldstrafen für Indianer.
Die Atmosphäre ist heiß, die endlosen Demonstrationszüge wirken bedrohlich. Beim Absingen der mexikanischen Hymne pfeifen viele Indios. Die Sicherheitskräfte stehen bereit, greifen jedoch nicht ein. Die Behörden setzen darauf, daß die lautstarken Unmutsäußerungen bald wieder einer dumpfen Resignation weichen.
Ein anderes Flugblatt ruft zwar alle mexikanischen Indianer - nach offiziellen Angaben sind es etwa sieben Millionen, nach anderen Zählungen mehr als dreimal so viele - zur Fortführung des Kampfes um Arbeit, Nahrungsmittel, Bildung und politische Unabhängigkeit auf, aber ein paar Zeilen weiter oben gesteht der Autor bereits die bittere Realität ein: „Die Politik der Modernisierung wird uns mehr Hunger, mehr Ausbeutung und mehr Elend bringen."
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!