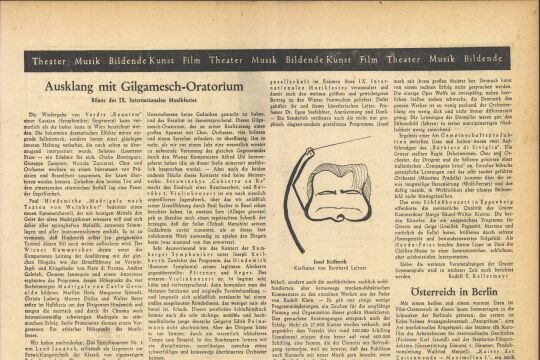Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Schönberg, Roussel, Kelemen, Berio
Nach Beethovens Egmönt-Ouver-türe folgte, als Hauptwerk des Abends, im letzten Sj/mphontfcer-konzert am vergangenen Donnerstag im Konzerthaus (Zyklus I) Schönbergs einziges Violinkonzert op. 36, im ersten Jahr seiner Emigration begonnen, 1936 fertiggestellt, aber erst 1940 unter der Leitung von Stokowski in Philadelphia uraufgeführt. Woraus man ersieht, welch geringen Ansehens sich der Wiener Zwölftöner damals in den USA erfreute. Das hat sich inzwischen geändert. Aber gerade dieses eine gute halbe Stunde dauernde Stück gehört, trotz der Kühnheit seiner Tonsprache, der akribisch gearbeiteten Partitur und dem knifflig-virtuosen Solopart, zu jenen Werken, die man sehr respektieren muß, aber nicht lieben kann. — Zvi Zeitlin, ein hervorragender Techniker und Musiker, der sich des in jeder Hinsicht schwierigen Stückes immer wieder annimmt (in Wien allein spielte er es zum drittenmal) sagte auf die Frage „warum?“: „Weil eben Dinge getan werden müssen, die andere nicht tun.“ Genau das ist es. — In Schönbergs früheste Zeit führte dann ein Fragment aus den „Gurre-Liedern“, 1900 bis 1901 begonnen, 1910 bis 1911 vollendet: Margarita Liloiua sang mit angenehmer Stimme und intensivem Ausdruck das „Lied der Waldtaube“, ein prächtiges Stück Musik der Spätromantik. Was für ein Weg bis zu dem Violinkonzert, das 25 Jahre später beendet wurde! — Danach war Roussels 2. Suite aus „Bacchus et Ariane“ der Beweis dafür, daß man noch zu Beginn der dreißiger Jahre mit den alten Mitteln Neues schaffen konnte. Was nun Roussel betrifft, der als Marineoffizier zu komponieren begann und erst 1937 gestorben ist: Er gehört zu den bedeutendsten französischen Komponisten der ersten Jahrhunderthälfte — und ist trotzdem bei uns so gut wie unbekannt. Wenigstens einer seiner vier Symphonien würden wir gerne in unseren Konzertprogrammen begegnen. —Martin Turnowsky, in Prag geboren und ausgebildet, seit 1968 in Wien lebend, nachdem er in verschiedenen östlichen Musikzentren leitende Funktionen ausgeübt hat und demnächst als Chefdirigent an die Osloer Oper geht, erwies sich als in allen Sätteln gerecht. Ebenso die brillant spielenden Symphoniker.
In dem 'gemeinsam von der Musikalischen Jugend mit dem ORF veranstalteten Orchesterkonzert am vergangenen Freitag (im Großen Musikvereinsaal) gab es zu Beginn „Sko-
lion“ von Milko Kelemen. Der kroatische Komponist, Jahrgang 1924, hat in vielen Schulen — zwischen Zagreb, Freiburg und Paris — studiert und war an vielen Orten als Lehrer und Organisator von Studios und Musikfesten tätig. Auf diese Weise wußte er immer ganz genau, was die Uhr geschlagen hat. Aber man' sott “nicht ungerecht nein: Was 1959 für Hans Rosbaud und die Teilnehmer des IGNM-Festivals in Köln, wo die Uraufführung des Achtminutenstückes erfolgte, brandneu und vom Komponisten „originell“ erfunden war, ist inzwischen zur Masche geworden. Doch schlägt immer wieder auch echtes Feuer aus diesem „Reigen“ von im Zickzack hin und her geworfenen Motiven, die sich am Ende zu einem chaotischen Haufen auftürmen und lärmend zerschellen. — Luciano Berio, nur ein Jahr älter als Kelemen, wurde zwar ausschließlich von italienischen Lehrern ausgebildet, ist darnach aber viel in der Welt herumgekommen, wo er, fast immer mit Erfolg, aufgeführt wurde. Denn er ist nicht nur ein phantasiereicher Musiker, sondern auch ein heller Kopf, auf alle Fälle kein Dickkopf, der sich einem bestimmten System jemals verschrieb. Er behandelt die angebotenen Methoden und Mittel „dialektisch“, d. h., er nimmt sich, was ihm zur Realisierung seiner Ideen am ■geeignetsten erscheint. Dies alles aufzuzählen würde einen ganz hübsch langen Katalog ergeben. In dem erst 1972/73 im Auftrag der New Yorker Philharmoniker entstandenen „Konzert für zwei Kla- < viere und Orchester“ hat er wieder eine Probe seines Könnens und seines verfeinerten Geschmacks gegeben. Das 25-Minuten-Werk beginnt mit leisen Passagen der beiden Soliinstrumente, denen ein drittes Klavier aus dem Orchester, eine Elektroorgel und Saxophone antworten. Es klingt zunächst nach Neoimpressionismus und überrascht aufs angenehmste durch seinen orchestralen Wohlklang. Freilich kommt es bald zu gewaltigen Ballungen und Explosionen, bis das Geschehen, in einer Art Dekomposi-tion, wieder zur zart kolorierten Anfangsstimmung zurückgeführt wird. — Diese beiden Stücke sowie die das Konzert beschließende „Petruschka“-Suite von Straioinsky musizierten die Pianisten Bruno Canino und Antonio Ballista sowie das Rundfunkorchester unter Milan Horvats Leitung mit bemerkenswerter Akuratesse und, wenn gefordert, auch mit Intensität und Klanggewalt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!