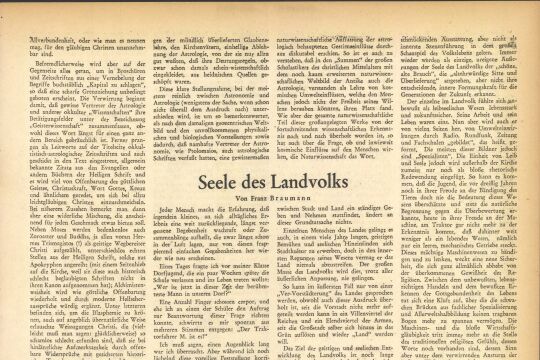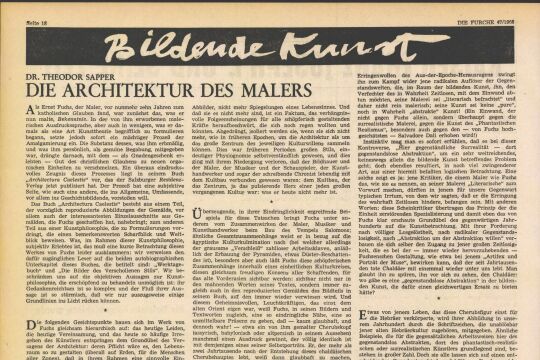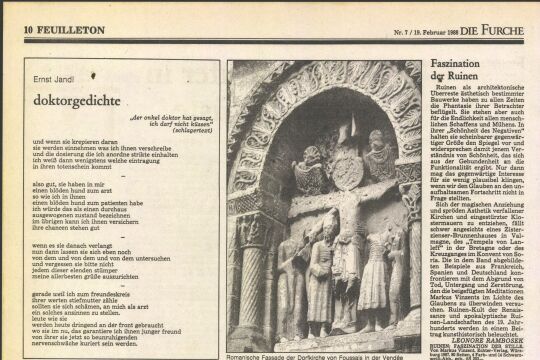Das japanische Schönheitsideal unterscheidet sich wesentlich vom westlichen. Im europäischen Bewußtsein spielt die Zeit als allgemeiner Vorstellungsrahmen eine große Rolle. Obwohl im modernen technisch-wissenschaftlichen Weltbild Zeit als gleichartiger, linearer und vertauschbarer Faktor materialisiert und verwendet wird, nimmt im europäischen Denken der Zeitbegriff auch ganz andere Formen an: Utopien werden herausgebildet, die sozusagen als Gravitationszentren den geschichtlichen Raum um sich herum strukturieren. Zeit ist dabei keineswegs eine selbständige Kategorie, die an und für sich existiert, sondern ein integraler Faktor des utopisch strukturierten Raumes. Die vorgestellte Verwirklichung der Utopie läßt die geschichtliche Evolution vollständig zur Ruhe kommen und würde somit auch die zeitliche Struktur menschlicher Verhältnisse von Grund auf ändern. Gemeinsam ist den europäischen Utopien die Erkenntnis, daß ihre Erfüllung ein Zustand der freien Entfaltung allen Lebens ist — ein Glückszustand also. Oft genug wurde jedoch die Utopie selbst nicht als ein Moment des immer gegenwärtigen Bewußtseins aufgefaßt, sondern als Moment der geschichtlichen Evolution in die Zukunft verlegt.
Das bewußte europäische Denken kann demnach als Prozeß gesehen werden, der Kenntnis von einer Utopie vermittelt und in dem alle konstituierenden Faktoren der Utopie einschließlich deren Zeitstruktur auf das Genaueste wiedergegeben werden. Kunst und Literatur als Teile dieser Denkbewegung vermitteln ebenfalls Erkenntnis, und zwar geschieht dies weder durch einen an den Leser weitergegebenen apriorischen Musenkuß noch befindet sich die Erkenntnis in der letzten Zeile des Gedichts. Die Erkenntnis ist nichts anderes als der mühevolle und verworrene Prozeß des Erkennens, der untrennbar an jedes einzelne Element des Kunstwerks und an ein komplexes System von Beziehungen gebunden ist.
Mit dem Epithet „schön“ bezeichnen wir einen Aspekt der Kunst, in dem die Utopie bereits direkt — nicht über den dialektischen Umweg einer Ablehnung der deformierten Wirklichkeit — verwirklicht ist. Lionardo etwa oder Giorglone stellten aus bestehenden und als ideal erachteten Beziehungen ein äußerst diffiziles und labiles System her, welches die Utopie in allen Einzelheiten reproduziert. Zwar könnte dieses System höchstens einen Augenblick lang existieren, denn es würde sofort wie Spinnweben von den Deformationen der Realität zerrissen. Deshalb könnte man auch sagen, daß gerade diese Maler die Unmöglichkeit malen, Schönheit zu malen.
Japan kennt keine geschichtlichen Utopien im europäischen Sinne, es kennt auch nicht den gefräßigen Schlund der Zukunft, dem wir ununterbrochen soviel Energie, Arbeitskraft — und Menschenleben — opfern. Die japanische Utopie ist schon immer die einfache und naheliegende Utopie der erfüllten Gegenwart gewesen. Diese Utopie bringt natürlich auch eine eigene Zeitstruktur mit sich. Dem reißenden Strudel des vieldimensionalen europäischen Raum-Zeit-Konti-nuums steht eine Zeitstruktur gegenüber, die mit einer Dimension, dem gegenwärtigen Hier und Jetzt, Genüge zu finden scheint. Japan kennt keine Vergangenheit, denn diese existiert entweder als Gegenwart weiter oder sinkt blitzschnell in Nichtexistenz ab und wird vergessen. Unsere europäische Zukunft sinkt zu völliger Bedeutungslosigkeit herab. Die Gegenwart bläht sich also auf Kosten dieser beiden fast fehlenden Dimensionen ungeheuer auf und entwickelt' einen übergroßen Formenreichtum an psychischen und physischen Lebenserscheinungen.
Die natürliche Form dieser überreichen, prall gefüllten Gegenwart wäre das Chaos, welches je und je eine ihm gemäße Struktur entwickelt. Dieses freie Gewoge der chaotischen Gegenwart fürchten die Japaner jedoch wie die Pest. Sie sahen sich deshalb gezwungen, ein überaus komplexes System von Ritualen zu erfinden, welches von allen Mitgliedern der japanischen Gesellschaft ununterbrochen angewendet werden muß, um das Chaos zu domestizieren. Dieser Angst vor dem Chaos entsprang sowohl die hochdifferenzierte japanische Bürokratie wie auch ein äußerst diffiziles Regelsystem, das fast alle zwischenmenschlichen Beziehungen formalisiert und welches gemeinhin als japanische Höflichkeit bezeichnet wird. Es ist jedoch der durch biblische Optik getrübte Blick des Europäers, der diese sogenannte Höflichkeit mit Rücksichtnahme gegenüber dem Nächsten verwechselt. Die japanische Höflichkeit ist sogar für Japaner nur sehr schwer zu ertragen und nützt ihre Nerven oft bis zur blanken Hysterie ab. Dieselbe Angst sieht auch in der Zukunft nichts anderes als potentielles Chaos, dessen schreckliche Fülle oder, mit japanischen Augen gesehen, Leere an die mit so großem Aufwand organisierte Gegenwart anbrandet. Diese Leere muß also unaufhörlich vernichtet, mit geschäftiger Betriebsamkeit und Ritual überzogen werden.
Nun ist aber dem japanischen Denken die Erkenntnis nicht fremd, daß eine im Formalen erstarrte Utopie, wie sie sich im japanischen System entwickelte, immer einen kleinen, aber entscheidenden Schritt von der erfüllten Utopie entfernt ist und daß die hierarchisch und rituell formalisierte Utopie eine entfremdete Utopie ist. Das japanische Denken zieht aber interessanterweise daraus nicht die zu erwartende Schlußfolgerung, daß sich die erfüllte Utopie nur dann realisieren kann, wenn die Gegenwart nicht durch formale Systeme an ihrer freien Entfaltung und damit an ständiger und voller Identität mit sich selbst gehindert wird. Es geht den entgegengesetzten, schwierigeren Weg, der darin besteht, die vorhandene formale Struktur ganz bewußt zu höchster Perfektion weiterzuentwickeln und ihr eine solche Biegsamkeit zu verleihen, daß sie dem jeweiligen Stand der Dinge in der Gegenwart exakt entspricht. Japanisches Denken ist deshalb nie schwebende, von der Wirklichkeit mehr oder weniger entfernte Reflexion wie in Europa, sondern immer rituelles Handeln in ausgeklügelter Perfektion.
Wenden wir nun unsere Definition, nach welcher Schönheit ein Teilaspekt der Erkenntnis und Erkenntnis ein zielbezogener Prozeß ist, der zur Bewußtwerdung der Utopie führen soll und sich gemäß der zeitlichen Struktur dieser Utopie entwickelt, auf das japanische System an und wir erhalten folgende Resultate: die Utopie besteht im hic et nunc der sich frei entfaltenden Gegenwart. Diese überreiche Gegenwart entwickelt ständig eine unendlich große Zahl neuer Elemente (diesen Prozeß würden wir Zukunft nennen) und scheidet ständig eine unendlich große Zahl von Elementen aus (unsere Vergangenheit). Die zeitliche Struktur der Utopie ist also, allgemein gesehen, absolute Präsenz, die, konkret gesehen, die Form absoluter Vergänglichkeit annimmt. Japanische Schönheit ist also nichts anderes als der Erkenntnisprozeß, der in der absoluten Vergänglichkeit die allgemeine Fülle der Gegenwart darstellt und dabei dient ihm zwangsläufig gerade die formale Struktur, in welcher die Entfremdung begründet ist, als Mittel zu ihrer Uberwindung.
Das Interessante und Auffällige an diesem Prozeß ist sein quantenhaftes, diskretes Auftreten, oder, anders gesagt, sein Nichtauftreten. Es ist zwar nur ein kleiner Schritt zur Verwirklichung der Utopie, aber es sind unendlich viele kleine Schritte — die momentane Schönheit der Kirschblüte, von allen Japanern empfunden, ist solch ein kleiner Schritt — aber rundherum türmt sich grimassierende Häßlichkeit. Da für den Japaner Schönheit immer ein ganz konkretes Erlebnis darstellt, ist er imstande, sie überall zu finden, zu sehen, zu hören oder zu fühlen — im harten Knall des Aufschlagens eines Tennisballes, in der jeweiligen Färbung des Himmels, in der geschwungenen Form eines Maschinenteils, in der Biegung eines Zweiges vor seinem Fenster. Für den Ausländer, der in den grünlichgelben Smog von Tokio hinabgetaucht, ist diese Stadt wohl ein Inferno der Häßlichkeit, für den Japaner kann sie voll von Schönheit sein. Der Ausländer muß nach Kyoto oder Nara fahren oder mindestens einem Zen-Tempel von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, um einen schwachen Abklatsch dieser Schönheit zu empfinden, im Getümmel einer japanischen Riesenstadt wird ihm dies kaum gelingen.
Das siebzehnsilbige Haiku ist — zeitlich — fast ein Nichts, gesprochen umfaßt es gerade nur den Zeitraum zwischen zwei Atemzügen: „Tiefe Stille, Laut der Zikaden nur sinkt zitternd in den Felsen.“ Eine universelle Situation wird konstituiert und blitzartig in eine kaleidoskopische Fülle konkreter Erscheinungen aufgebrochen. Dieser Fülle wird jedoch nicht gestattet, sich — wie in europäischen Gedichten — in evolutionärer Interaktion zu entwik-keln, sie wird ebenso schnell wieder in die nunmehr mit der Vergänglichkeit konkreter Details angereicherte Ausgangssituation aufgelöst. Das Haiku ist besonders typisch für den japanischen Schönheitsbegriff. Nicht nur durch seine Kürze und seine Negation jeglicher Evolution, die ein Zeitgefühl erst gar nicht aufkommen lassen oder durch seine strenge syl-labische Gesetzmäßigkeit, sondern auch durch die besondere assoziative Beschaffenheit des konkreten Details. Dieses ist nämlich immer jahreszeitlich oder geographisch genau lokalisiert (der Zikadengesang ist typisch für den Spätsommer) und ruft deshalb beim japanischen Leser automatisch ein Heer entsprechender Empfindungen und Erinnerungen hervor. Da der Japaner natürlich über einen ganzen Schatz solcher detailliert ausgearbeiteter Assoziationsketten verfügt, ist für ihn das Haiku eine unerhört reiche Literaturgattung, während es der Europäer eigentlich nur abstrakt genießen kann.
+
Die große Bedeutung formalisierten Handelns im japanischen System wurde bereits betont. Diese Rolle der Form kann so weit gehen, daß sie, sofern ausreichend perfektioniert, eigenständigen Erkenntniswert erhält und dadurch ein Mittel zur Realisierung der Utopie wird. Die sprachliche Kommunikation der Japaner etwa besteht fast ausschließlich im Austausch von Formeln — ein Vorgang, der dem auf individuelle Information bedachten Europäer ärgerlich, langweilig oder einfach dumm erscheint. Die Formeln dienen natürlich vor allem der lückenlosen Strukturierung einer Situation — etwa einer Hochzeit oder der Vorbereitung einer Reise, beides ungeheuer komplizierte Unternehmungen in Japan. Ihre Aufgabe ist es aber auch, die alltäglichen menschlichen Kontakte in eine angenehme Atmosphäre zu tauchen. Da es nun aber eine sehr große Zahl von Formeln und auch reiche Variationsmöglichkeiten gibt, und da der konkrete Anlaß, abgesehen von seiner Auslösefunktion, oft fast keine Bedeutung hat, kann eine gekonnte sprachliche Formalisierung manchmal den Eigenwert absoluter Schönheit erzeugen.
In einigen japanischen Sportarten, im Fechten oder Bogenschießen, tritt das Ritual als Erkenntnisvermittler in noch reinerer Form auf. Ein kompliziertes System ritueller Bewegungen, das genau ausgeführt werden muß, soll dem „Sportler“ dazu verhelfen, die Entfremdung, die ihn von der Identität mit der Gegenwart trennt, stufenweise zu überwinden. Die Zielscheibe ist dabei nur ein Hilfsmittel, das bedeutungslos wird, wenn der Schütze den Zustand der Identität erreicht hat — er kann dann automatisch nur ins Schwarze treffen. Auch in der japanischen Architektur und Musik findet der eigenartige Schönheitsbegriff der japanischen Utopie mannigfaltigen Ausdruck. Weder entwickelte die Architektur den Rundbogen — im zarten Schwung des Daches ist er nur angedeutet und zugleich aufgehoben — noch kam es in der Musik zur Entfaltung einer Melodie im europäischen Sinne.
Ausschweifung kennt der Japaner nur in einer Form — der Nostalgie.