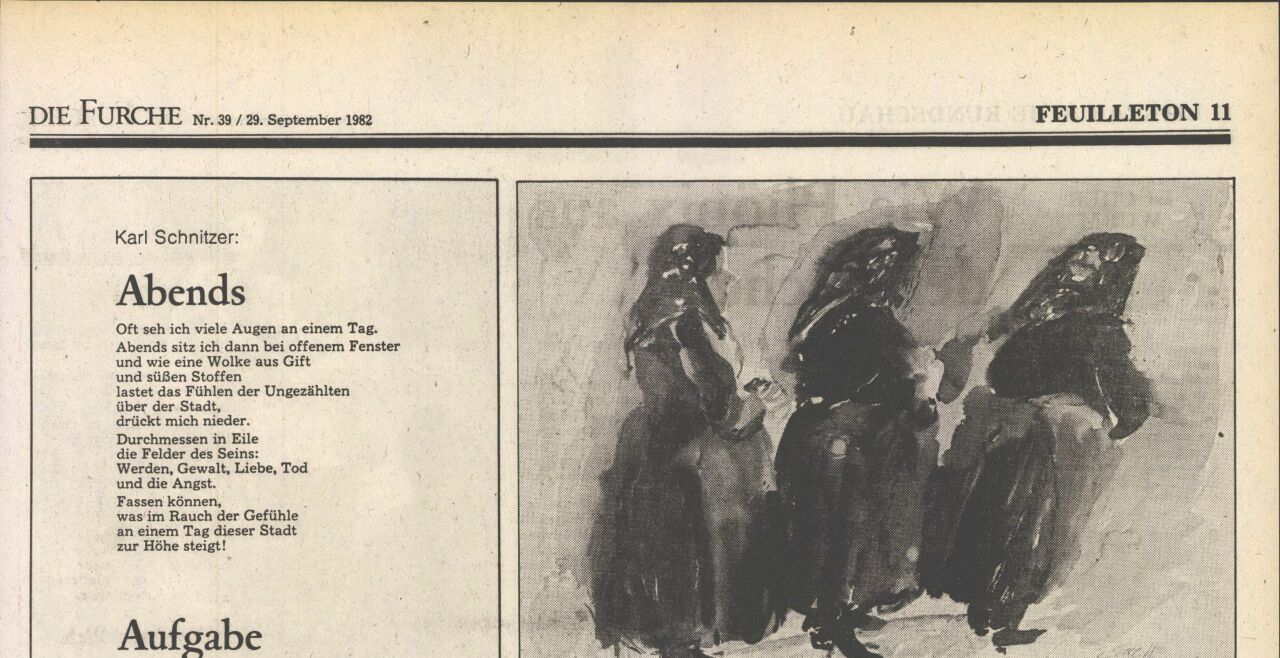
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Schon vermarktet, Herr Poet?
Der autobiographische Juckreiz gehört zum halb fertigen Menschen; er ist zu lokalisieren in der Diskrepanz zwischen dem biologisch Gewordenen und dem geistig und sittlich Werdenden. Er gehört zum Ubertritt aus der Jugend in das Erwachsensein, eben so wie der suizidale Juckreiz: beides als ein Zu-wichtig-Nehmen der eigenen Person und des eigenen Schicksals: hier es vernichten wollend, und dort es verewigen wollend. Selbst die später ganz Großen, dann ganz Objektiven, sind der Versuchung direkter Darstellung ihrer selbst nicht entgangen, Goethe als „Werther” mag da als Beispiel stehen; und was da recht ist, muß einem Musü und auch einer Frischmuth billig sein.
Wenn man sagt, daß ein Autor sich erst einmal freischreiben müsse, beziehungsweise, daß er mit einem bestimmten Buche sich freigeschrieben habe, dann liegt darin sehr viel tiefere Einsicht, als diese Phrase aufs erste vermuten läßt: eigentlich meint sie, daß einer zuerst einmal sich von sich selber befreien müsse, ehe er fähig sei, Welt in sich aufzunehmen und diese im Wort zu reproduzieren: bekannte Objekte im Durchgang durch ein Subjekt in bisher noch nicht bekannte Objekte umzugestalten: dem uns vertrauten Bilde vom Menschen ein winziges, aber es deutlicher, deutbarer machendes Strichlein hinzuzufügen.
Mit zwanzig, mit fünfundzwanzig hat man noch keine Objektwelt, denn man hält sich und seine Probleme für erstmalig, ja für einmalig. Auch mit dreißig mag das noch hingehn, vielleicht; denn es wachsen nicht alle im selben Zeitmaß: Trakl und Gütersloh, gleichen Jahrgangs, reiften nicht unter den selben Gesetzen. Nur, wenn einer sein Leben lang eben dies Leben, anstatt es zu leben, zum Gegenstand eines Fortset-zungs-Romanes nimmt, hinter den erst der biologische Tod einen Schlußpunkt setzt, dann muß man zumindest ein Thomas Wolfe sein, um das mit einigem Anstand, sprich: ohne den Leser wie sich zu langweilen, überhaupt absolvieren zu können. Aber wer ist schon ein Thomas Wolfe?
Wer erzählt uns denn noch, wenn auch von sich selber sprechend, von Zeit und Strom, von Geweb und Fels? Natürlich spricht jeder' Dichter durch sich hindurch; den Unterschied macht nur, ob er durch sich hindurch von der Welt spricht — vom Elternhaus, von der Schule, von Hochzeit und Ehe und Scheidung, von Arbeit am Feld, im Büro, am Hochofen, von der Philosophie und der Religion, vom Tode —, oder ob er von sich spricht: von seinen eigenen Lehr- und Wanderjahren, von seinem eignen Beruf, von der eigenen Familie, von den eigenen Krankheiten.
Buchstäblich alles Eigene wird verwurstet: der Grant auf den all zu strengen (wahlweise all zu milden) Vater wie der auf den all zu ungetreuen (wahlweise all zu getreuen) Liebes- oder Ehepartner, auf das all zu bürgerliche (wahlweise all zu proletarische) Milieu, auf die all zu puritanische (wahlweise all zu liberalistische) Erziehung ... kurz, alles, was einem während der Pubertät einmal über die Leber gelaufen ist... ich... ich... ich... und wenn dieses Minimum an Substanz einmal aufgezehrt ist, bleibt doch immerhin noch der Selbstmord; wenigstensder der eigenen Mutter. Es liest sich so gut? Nein, es schreibt sich so leicht.
Und das wissen nun, leider, nicht bloß die Autoren, sondern genau so auch die Verleger, die obendrein noch das andere wissen: daß man zwar Bücher, nicht aber ein literarisches Werk kalkulieren kann. Käme ein Goethe heute zu einem Suhrkamp, um diesen für seinen geplanten „Faust” zu gewinnen, würde Herr Unseld - die Namen sind wie die Personen beliebig austauschbar— durch seine Vorzimmerdame dem Dichter ausrichten lassen, er könne ihn das, wodurch er- berühmt werden würde.
Jetzt, wenn ein junger Autor vor einen Verleger hintreten darf, geht das so: Der Autor stottert noch etwas von einer Idee und dergleichen, doch der Verleger hat schon die Seiten gezählt, und er hat auch schon einen Bearbeiter bei der Hand (den der Autor bezahlen muß), und er hat auch schon mit den Rezensenten gesprochen, und dann ist der Erstling da und in aller Munde; und der Autor gilt als die große Hoffnung. Und der Autor glaubt das, natürlich, auch selber, denn ein Kritiker hat ihn vielleicht „einen Mozart der Wörter” genannt (dem Gerd Jonke ist das passiert).
Und dann sagt der Verleger: „Jetzt schreiben Sie gleich noch ein eben so gutes Buch, Termin ist der 15. Mai, Sie wissen: die Buchmesse. 200 Seiten, dann bleiben wir noch unter 20 Mark.” Der Autor murmelt noch etwas von einer Idee und dergleichen, doch der Verleger sagt ihm: „Es sollte mehr positiv sein. Sie haben doch Kinder?” Und so schreibt denn der Autor von seinen Kindern.
Das Buch wird gelobt von allen denen, die den Erstling gefeiert hatten: man will sich ja nicht getäuscht haben in dem Genie. Und dann sagt der Verleger: „Sie sind doch ein Bergbauernkind? Das würde grad passen. Soziales einerseits, Umwelt anderseits.” Zwar, die Kritik klingt nun nicht mehr begeistert, aber der Autor ist eingeführt, quasi ein fixer Posten beim Sortiment. Der Autor hat einmal seine „Bovary” unter dem Herzen getragen, seine „Ae-neis”, oder zumindest doch seinen „Knill”; doch nun wird nur noch abgehakt: „Scheidung? Das haben wir schon.”
Der Autor: „Ich war in Paris.”
Der Verleger: „Das haben wir auch schon.”
DeV Autor: „Die Klosterschule?”
„Das war schon längst.”
„Mein Elend mit Salzburg?”
„Besseres fällt Ihnen wirklich nicht ein? Sie müssen doch irgend wann einmal ernstlich erkrankt gewesen sein! Hoffnungslos krank. Einen Titel hätte ich schon: ,Die Krankheit zum Tode.' Das war noch nicht. Da sehe ich eine Marktlücke.”
„Kierkegaard”, möchte der Autor einwerfen, aber dann legt er sich hin und wird krank, um zur nächsten Buchmesse voll wieder da zu sein.
Er hat einmal seinen „Raskolni-kow” unter dem Herzen getragen, seinen „Nachsommer”, oder zumindest doch seinen „Graf Luna”; aber jetzt darf er nicht schreiben, sondern er muß erleben, um schreiben zu können: muß, was man Leben nennt, simulieren, um schreiben zu können. Bis er dann endlich einmal vergessen hat, daß er einst seinen „Don Quixote” unter dem Herzen getragen; und das geht ja so leicht, was man jetzt von ihm fordert: Man plaudert ein bisserl so für sich hin, man sinniert ein bisserl, man beichtet ein bisserl: es tropft einem von der Seele direkt aufs Papier.
Und dann ist man vierzig, und die Kritiker schweigen; und dann ist man fünfzig, und längst sind die Posten im Sortiment von arideren fix für die nächsten paar Jahre besetzt; und dann ist man sechzig, und der Verleger kümmert sich um sein Häuserl in Nizza und um sein Häuserl auf den Azoren und um sein Häuserl im Schwarzwald; und dann ist man siebzig und fast schon tot, und kann nun nicht einmal sagen, wie Wilhelm Raabe: „Meine Bücher gewonnen, ein Leben verloren”; denn aus den Büchern, vergilbt und eingestampft, werden längst andere Bücher gemacht, die gleich unhaltbar sind, und so fort bis ans Ende der Tage von Literatur.
Ein paar alte Leute werden sich noch erinnern daran, daß da irgend jemand, den man vom Wirtshaus gekannt hat oder vom Greißler, an irgend etwas gelitten hat - am despotischen Lehrer? an Furunkulose? an Nachbars lärmenden Kindern? egal: es war ein recht netter, wenn auch konfuser Kerl; es war ein recht nettes, wenn auch extravagantes Frauenzimmer. Sie hat Obst nicht vertragen. Er hat einen Bruder gehabt, in Amerika. Nein, in Kanada.
War sie nicht Lehrerin? Also, vom Sport hat er überhaupt nichts verstanden. Sie hat sich die Haare gefärbt. Wenn er was getrunken hat, habidjehre! Sie hat keinen Vater gehabt. Sie war verheiratet. Nie im Leben war die verheiratet. Viel getrunken. Ein Großer, Blonder. Sie war aus Tirol. Na ja. Damals ist noch die Tramway gefahren, der Hundert-dreiunddreißiger. Ja. Der Hun-dertzweiunddreißiger war es. Ja ja. Wo die Schrebergärten gewesen sind. Ja. Wie die Zeit vergeht, schrecklich!
Das ist, was bleibt. Der Rest, also eigentlich alles, ist Schweigen. Nicht einmal von neuen „Leiden des jungen Werthers” die winzigste Spur; und schon deshalb von einem „Faust” erst recht nicht.
Daß die Verleger von ihren Autoren leben, versteht sich von selbst. Aber daß sie vom Leben ihrer Autoren leben: sie aussaugen buchstäblich bis aufs Blut: das macht sie schuldig nicht bloß vor der Literatur, sondern schuldig zuerst schon am Schicksal lebendiger Menschen—was mit keinem Prozentsatz, mit keiner Auflagenhöhe je wird verantwortbar sein.
Ich grüße die letzten noch lebenden Ausnahmen, gleichsam von Fossil zu Fossilien.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!




































































































