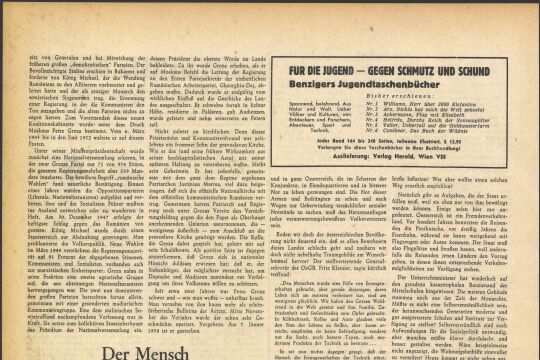Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Schriftsteller und Potentaten
ber die miserable Situation der Literatur hierzulande sowie der Menschen, die sie produzieren, ist schon eine ganze Menge gesagt worden. Ich werde mich darauf beschränken, über meine Erfahrungen zu berichten, die ich als Mitbegründer, Mitarbeiter und zeitweiser Leiter der Interessengemeinschaft österreichischer Autoren gemacht habe.
Die Erfolge unserer deutschen Kollegen, die sich in ihrem Schriftstellerverband zusammengeschlossen hatten, / machten uns klar, daß uns in Österreich eine Organisation fehlte, die uns alle zusammen erfassen und vertreten könnte.
So gründeten Hilde Spiel, mein verstorbener Freund Reinhard Federmann und ich die Interessengemeinschaft österreichischer Autoren, die als Dachverband gedacht war, in dem alle Schriftstellervereine und Autorenvereinigungen vertreten sein sollten, ohne Rücksicht auf ihre literarische oder politische Richtung.
Dabei passierten zwei für Österreich sehr untypische Dinge: Schriftsteller verschiedener Generationen und verschiedener Auffassungen von ihrem Metier saßen plötzlich unter einem Dach und sprachen zum ersten Mal ganz unumwunden von Geld, das man ihnen allenthalben vorenthielt …
Die Vertreter der Verlage, der Zeitungen und des ORF bei unserem ersten Gespräch vor zehn Jahren waren geradezu beleidigt, als wir ihnen vorhielten, daß sie uns für unsere Arbeit, von der sie alle eigentlich lebten, mehr als schäbig entschädigten.
icht viel anders erging es uns bei unserem Umgang mit den Vertretern des Staates. Natürlich fanden wir unter ihnen auch Verbündete, aber die Kultursprecher der SPÖ und der ÖVP, Lupto- vits und Busek, redeten vor leeren Bänken im Parlament. Das Gesetz überden sogenannten Bibliotheksgroschen, das auf Betreiben des Justizministers Dr. Broda und des Unterrichtsministers Dr. Sinowatz nach fünfjährigem Hin und Her vorbereitet wurde, scheiterte an einem klaren Nein des damaligen Finanzministers Androsch.
Wir hatten nämlich gleich zu Anfang unserer Tätigkeit, also vor zehn Jahren, eruiert, daß in Österreich zwanzig Millionen Bücher pro Jahr entlehnt werden, und verlangten nach dem deutschen Muster siebzig Groschen pro Entlehnung. Das machte 14 Millionen Schilling aus, plus zwei Millionen für die Präsenzbände, also insgesamt 16 Millionen Schilling.
Die Hälfte davon sollte einem Sozialfonds der Autoren zufließen, aus dem wir unseren alten Kollegen oder deren Hinterbliebenen Pensionen zahlen, Arbeitsunfähige oder Kranke unter uns unterstützen und anderen Kollegen wieder aus einer augenblicklichen Notlage oder Pechsträhne heraushelfen wollten.
Die 16 Millionen Schilling waren dem Finanzminister zu viel. Man handelte uns auf die Hälfte herunter. Aber auch das war ihm zu viel. Um uns nicht alle zu Feinden der Regierung zu machen, gab man uns schließlich vier Millionen für einen Sozialfonds. So bekamen wir anstelle der Gelder, die uns zustehen, nur ein Almosen in Form einer Subvention, auf die wir keinen gesetzlichen Anspruch haben. Die feudalen Strukturen sind in unserem Land offenbar stärker als alle Argumente. Diese -Strukturen treten besonders in unserer Steuergesetzgebung zutage. Sie unter
scheidet nämlich strikt die Staatsdiener von den übrigen Untertanen. Ein Staatsdiener zahlt, wenn er sich nebenberuflich literarisch oder künstlerisch betätigen will, einen begünstigten Steuersatz für Einkünfte, die ihm aus dieser Tätigkeit zufließen.
Als wir verlangten, mit unseren nebenberuflichen Kollegen gleichgestellt zu werden, stießen wir auf taube Ohren, ja man fand unser Begehren geradezu unschicklich. Anstatt uns irgendwelche Erleichterungen zu gewähren, die den spezifischen Bedingungen unseres Berufs entsprechen, schickt man uns in der letzten Zeit Steuerüberprüfer ins Haus, damit sie unsere „Betriebe“ unter die Lupe nehmen und uns auf Vordermann bringen.
In einer Zeit, in der die meisten unserer Mitbürger ihre Schäfchen ins trok- kene gebracht haben, sind wir auf der Strecke geblieben. Wir sind zu spät dran. Die großen Gelder sind schon verpulvert. Während wir zum Beispiel zusammen mit den Filmemachern um ein Filmförderungsgesetz stritten, hatte die Stadthallenfilm einen Verlust von vierhundert Millionen Schilling mit läppischen Kommerzfilmen erwirtschaftet, der prompt gedeckt wurde.
Während wir um die paar Groschen pro Buchentlehnung rangen, stiegen die Defizite der Staatstheater auf das Drei- bis Vierfache, das heißt auf weit über eine Milliarde hinaus. Die kostenlosen Schulbücher verschlingen Milliarden. Da kann doch nichts mehr für uns übrigbleiben.
.^^.ngesichts dieser desolaten Situation kann ich durchaus den dringenden Wunsch vieler Kollegen verstehen, alle ihre Sorgen und Nöte einer übergeordneten, mächtigen Organisation anzuvertrauen und ihr eine Blankovollmacht auszustellen; sie haben schließlich etwas Gescheiteres zu tun als sich mit Vertragsbedingungen, Honorar- und Steuerfragen sowie anderen bürokratischen Kalamitäten herumzuschlagen.
Nach der alten österreichischen Devise „Der Papa wird’s schon richten“ soll sich ab sofort die Gewerkschaft darum kümmern. Ich verstehe, wie gesagt, diesen Wunsch sehr gut. Ich finde ihn nur reichlich naiv. Der einstige kulturelle Impetus dieser Organisation hat schon lange nachgelassen. Aus den ehemaligen Vorkämpfern für die Rechte der Erniedrigten und Beleidigten sind fette, selbstzufriedene Teilhaber des Staates geworden, die, wie alle Potentaten, nur der Scheinkultur der glitzernden und sehr lauten Spektakel huldigen.
Als es vor kurzem darum ging, nach zehnjähriger Verspätung ein Gesetz über die Gebühr für private Überspielungen auf Ton- und Bildträger zu beschließen, war es nicht nur die Wirtschaftskammer, die sich dagegen aussprach, sondern auch die Arbeiterkammer, mit der Begründung, daß durch
die Erhöhung der Preise - als fiele diese lächerliche Gebühr wirklich ins Gewicht - die Arbeitsplätze gefährdet werden könnten. Schließlich wurde von den beiden Kammern ein Gesetz vorbereitet, das den Musikern und deren Interpreten den Löwenanteil an der stark herabgesetzten und pauschalierten Gebühr sichert; die Autoren müssen sich mit dem zufriedengeben, was man ihnen gnädig zuweist.
Dieses Gesetz wäre nie zustande gekommen, hätte die Gewerkschaft nicht dafür Sorge getragen, daß die, in ihren Augen, einzigen Künstler, das heißt die Musiker, und damit meine ich die Interpreten der Musik, auf ihre Rechnung kommen…
Die Gewerkschaft unternahm also bei ihrem letzten Vorstoß auf dem Gebiet des Urheberrechtsgesetzes nichts zu Gunsten der Autoren. Ich werde den Verdacht nicht los, daß man uns, wenn wir einmal in der Gewerkschaft sind, in einen Winkel abschieben und uns dann ab und zu einen mageren Knochen hinwerfen wird, damit wir endlich einmal aufhören zu winseln.
So hat uns bisher auch jede andere Obrigkeit in diesem Land behandelt, seitdem es bestem, unu es giot wenig Aussicht, daß sich daran etwas Grundlegendes ändern wird.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!