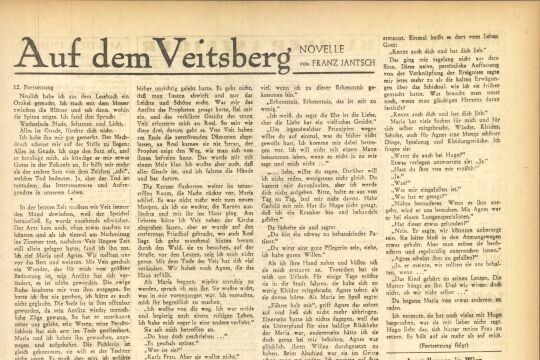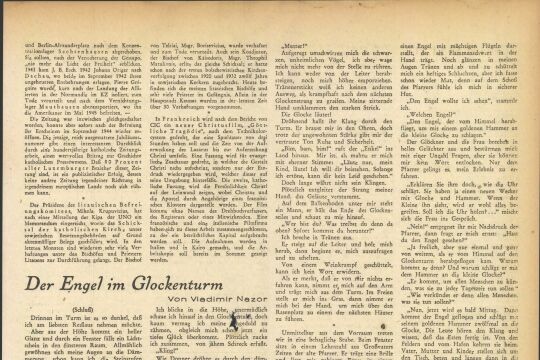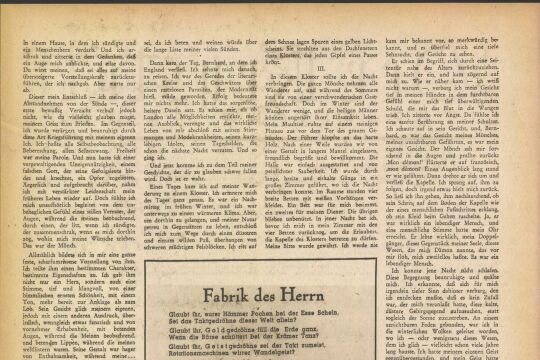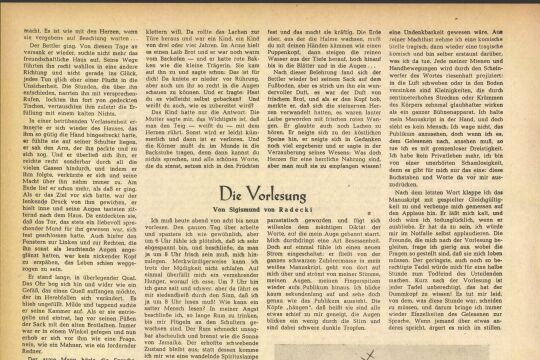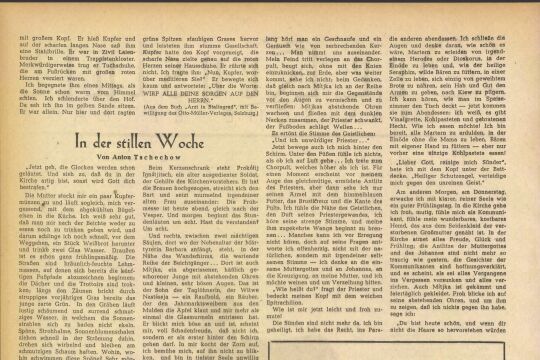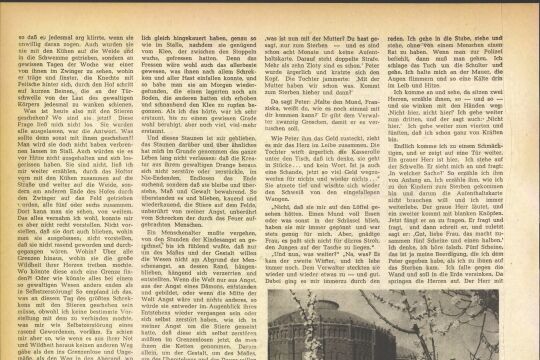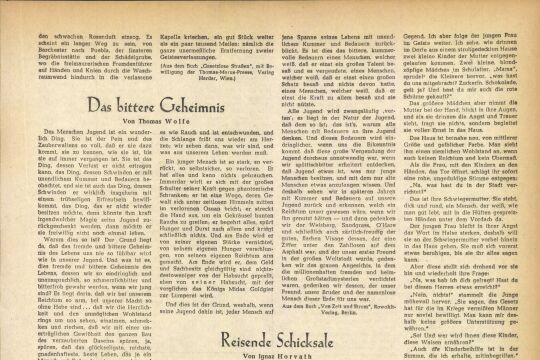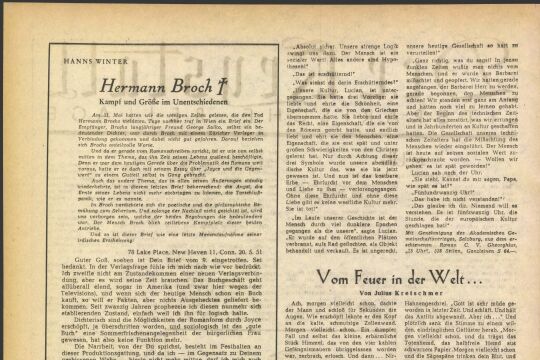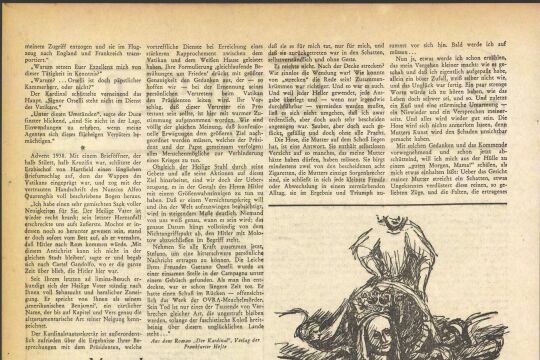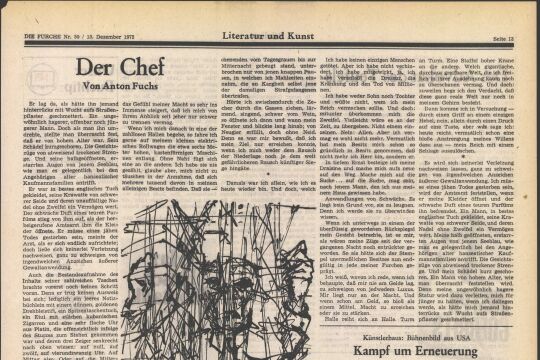Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Schule, Traum, Erwachen
Die Schule besteht aus langen Gängen, deren Anordnung und Verlauf kein Schüler verstehen kann. Diese Gänge sind verwirrender als die Welt, ihre Ordnung ist komplizierter als das ganze in der Schule zu erwerbende Wissen. Diese Schule quillt über von breiten und langen, geraden und gewundenen Gängen. Obwohl wir in einer Schule sind, sieht man in diesen Gängen nie Menschen, vor allem niemals ein Kind. Es gibt keine Kinder in diesen Gängen, es gibt keine Lehrer, es gibt nichts als versperrte Türen.
Ich gehe, allein, durch den langen Gang. Vor mir, neben mir, hinter mir gibt es keine Kinder, es ist still. Wo eine Schulstunde vorüber ist, müßten auch andere Kinder sein, aber hier ist niemand. Ich bin acht, oder gar schon neun, aber doch eher acht. Ich bin ein Junge und weiß, daß ich ein Junge bin.
Aber langsam, obwohl ich ein Junge bin, kriecht Angst in mir hoch. Ich fürchte mich in diesen Gängen, wo ich allein bin, und horche, ob jemand kommt. Wenn nur jemand hier wäre - ein Kind, ein Lehrer, auch ein gefürchtetes Kind, auch ein gefürchteter Lehrer —, der meine Angst zerstreute... Ich schaue mich um und sehe den weiten Gang hinter mir. Aber vor mir liegt dieselbe Unermeßlichkeit. Nirgends sind Kurven oder Kreuzungen, ich höre nur Stille, die man mit acht Jahren sehr deutlich hört. Das Schweigen zerrt an meiner Haut. Ich bin acht, kinderhäutig, leicht verletzbar, obwohl ich ein Junge bin.
Die Angst wird größer, der Gang hört nicht auf, wieder bleibe ich stehen und schaue, ob jemand hinter mir ist. Ich zucke zusammen, ich schreie, da ist ein Gespenst, weit hinten im Gang im schwarzen Umhang eine Gestalt, die grinst mich an und läuft auf mich zu. Sie ist noch weit, die Gestalt, aber läuft so schnell, wird mich erreichen, mich unter den schwarzen Mantel ziehen. Ich bin allein, es gibt keine Menschen, ich schreie, ich stehe gelähmt.
Jetzt gerate auch ich in Bewegung, ich schreie nicht länger, weil ich Luft zum Laufen brauche, zum irren Laufen, den Kopf halb nach hinten gewendet. Ich kann besonders gut laufen, habe den ersten Platz meiner Klasse erreicht, aber was soll das.j'etzt muß ich laufen, muß ich der Schnellere sein. Aber ich trage Blei in den Füßen, ich fühle mich plötzlich so schwer, und der Gang ist länger geworden. Ich laufe und fühle, wie langsam ich bin, daß ich noch nie so langsam war. Die Gestalt kommt näher, ist mir schon so nahe gekommen, daß der Saum des Mantels mich fast berührt.
Ich fühle am ganzen Körper, wie langsam ich bin, wie schnell ich sein könnte, ich glühe jetzt vor Geschwindigkeit, die mir möglich wäre, aber ich trage Blei an den Füßen, ich bin tödlich gebremst und verstehe es nicht. Es ist nicht nur die Angst, es ist vielmehr die Wut, nicht laufen zu können, die mich verzweifeln läßt. Ich kann doch laufen und möchte laufen, fühle meine Gedanken laufen, während mein Körper langsamer wird, während ich endlich zu Boden stürze.
Ich habe den Traum so oft geträumt. Ich bin ein Junge von acht oder von neun Jahren, ich kann kaum mehr lachen vor lauter Furcht, diesen Traum zu träumen. Ich zittere schon beim Mittagessen vor der kommenden Nacht, vor dem möglichen Traum, den ich auswendig kenne, besser als alle Wirklichkeit, und dessen Kenntnis mich dennoch nicht retten wird, wenn ich ihn träumen muß. Sobald die Gestalt mich eingeholt hat, dann und nie früher, erwache ich wimmernd und finde mich nur mühsam zurecht. Zugleich aber bin ich befreit für den Rest dieser Nacht.
Am Morgen laufe ich froh zur Schule, beachte die langen Gänge kaum, die zwar schlimm, aber meßbar sind. Ich weiß mich unantastbar von Träumen. Aber mittags schon, wenn die Sonne am wirklichsten ist, beginne ich den Abend zu fürchten, weil er vielleicht meinen Traum verbirgt. Ich träume den Traum bis ich vierzehn bin. Mit vierzehn verliebe ich mich in Sibylle und träume seither den Traum nicht mehr. Ich warte auf Sibylle und leide um sie, will für sie leben und auch für sie sterben, und meine Sibylle spielt die Narrheit mit.
Neulich habe ich sie gesehen. Ich bin jetzt vierzig oder tausend Jahre, und Sibylle sitzt drüben im Postamt beim Schalter. Sie ist häßlich und irdisch geworden, ich verlange von ihr eine Briefmarke, und Sibylle erkennt mich nicht. Durch das Schaltergitter will ich der Postbediensteten sagen, daß sie schön war, daß ich sie liebte. Ich will ihr von unserem Juni erzählen, von der Mauer im Park, und wie vollkommen das Leben war. Ich wärme die alte Suppe nicht auf, ich wärme ja auch den Traum nicht auf. Ich klebe die Briefmarke mit Widerwillen schräg auf den Briefumschlag. Sibylle, du wolltest Sängerin werden, du hattest die schönste Stimme, die weichste Haut Ich verlasse das Postamt Nur von dir fühlte ich mich damals verstanden. Nur für dich lebte ich. Und heute erkennst du mich nicht mehr.
In den furchtlosen neuen Nächten sehne ich mich nach den unendlichen Gängen, nach der bedrohlichen Gestalt, nach dem Glück der Angst. Aber ich habe die Angst verlernt und den Schrecken zum Haustier gemacht, und ich träume den Traum nicht mehr.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!