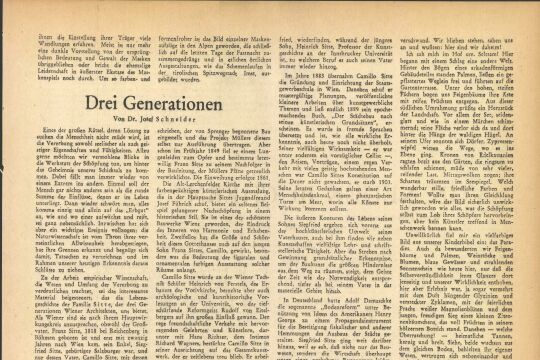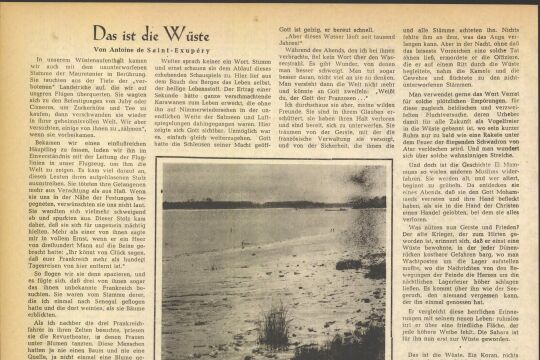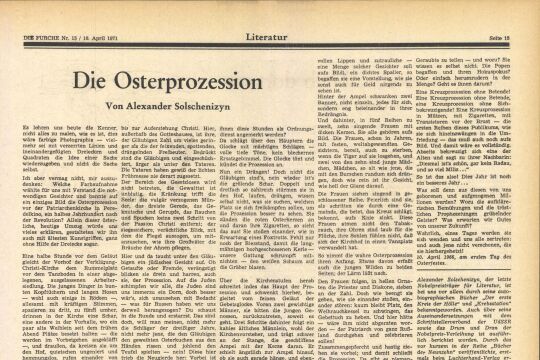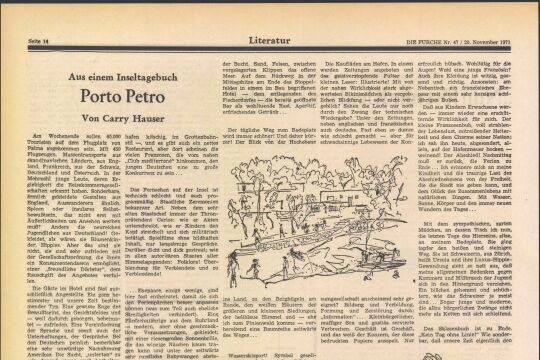Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Schwajje, schwajje, mein Freund
El-Moallaka heißt die kleine Kirche aus dem 4. Jahrhundert. Sie steht, von zwei viel später — erst von den Römern — erbauten Türmen gestützt, im Hintergrund eines von Mauern und Bauwerken gesäumten länglichen Gartens, ist offenbar gut besucht und nicht nur von Touristen. Im unruhigen Licht der vielen Kerzen scheinen sich die dunklen Heiligenbilder wie lebendig zu bewegen. Aus dem Lautsprecher tönt die archaische Melodie eines monotonen Gebets in koptischer Sprache.
Jenseits der Kirchenmauer, jenseits der Stadtmauer von Alt-Kairo spielen Kinder im Mist, sitzen alte Frauen bewegungslos vor elenden Hütten, gehen elegant angezogene Herren — Kaufleute? Beamte? — mit Aktentaschen umher, waschen Mädchen im Wasserstrahl des Hydranten die bunten Gewänder; das Wasser steht, von grauen Schaumflocken bedeckt, in den Vertiefungen der un-gepflasterten Straße; ein Auto fährt durch den Schlamm, fährt langsam, für die Verhältnisse von Alt-Kairo trotzdem offenbar zu schnell: ein alter Mann blickt dem Fahrer in die Augen, hebt die rechte Hand, preßt Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger aneinander, was „schwajje" bedeutet, „schwajje", nur schön langsam, wozu hasten, Zeit hat angesichts der Kürze eines Menschenlebens, angesichts der vielen tausend Jahre, die hinter uns liegen, die vielleicht noch vor uns stehen, wenig Bedeutung.
Man hat Pyramiden errichtet, man hat blühende Städte gegründet, man baut zwanzig Stockwerke hohe Häuser, ganze Stadtviertel, aber während das Neue aufgetürmt wird, verfällt hundert Meter weiter das Alte, der große Bauplan, nach dem all das zu geschehen hat, bleibt ein Geheimnis, also „schwajje", mein Freund, wohin eilst du?
Während des Symposions an der Al-Azhar-Universität sagte ein junger Mann das gleiche, wenngleich mit anderen Worten. Er studiert Germanistik und absolviert gegenwärtig seinen Militärdienst. Für den Tag des Symposions ist er beurlaubt worden und nun steht er da, schlank, dunkelhäutig, in das vorbereitete Manuskript vertieft. Er spricht über das Buch eines österreichischen Autors; sein Deutsch ist tadellos, aber die Sprachmelodie erinnert an den Singsang alter Choräle; und auch der vorgelesene Text selbst klingt mitunter wie eine Predigt. Glück sei wie Bekleidung, sagt der junge Mann, kleine Menschen brauchen ein Glück, das ihrer Kleinheit entspräche, das Glück der Größeren müsse größer sein. Ich denke: Goethe hat über diesen Gegenstand dieselbe Meinung gehabt, vielleicht aufgrund seiner Studien arabischer Dichter. Wer hört bei uns auf Goethe? Wer würde diesem Studenten ruhig zuhören? Bei uns gilt nur das im Augenblick allgemein als Glück anerkannte Glück als wirkliches Glück, diesem einen Glück müssen sich alle beugen; wenn sie dieses eine Glück nicht besitzen, hält man sie für unglücklich und man beglückt sie aus staatlichen Mitteln, ob sie es wollen oder nicht.
Der Student gehört übrigens zu den Träumern und Kämpfern; wir haben Gelegenheit zu einem kurzen Gespräch; er schreibt Gedichte und will einen Zustand herbeiführen, in dem es keine Kriege gibt. Nein, er ist weder enttäuscht, noch resigniert, er weiß allerdings manches, was wir nicht mehr wissen. Was er weiß, ist nicht irgendeine exotische „Weisheit des Orients" und auch nicht nur die Lehre des Islam, sondern die Erfahrung einer alten Kultur, die unzählige mörderische Illusionen überlebt hat.
Europäer haben, wenn auch aufgrund einer wesentlich jüngeren Kulturgeschichte, die gleiche Erfahrung, aber sie sind offenbar nicht mehr in der Lage, auf ihre innere Stimme zu hören. Die Ägypter hören sie. Hören sie noch. Werden sie eines Tages auch von der europäischen Krankheit erfaßt, von diesem blinden Streben nach unpersönlichen, für alle gleichermaßen verpflichtenden Mitteln einer obligatorischen und uniformen Selbstbeglückung?
Vor sechzehn Jahren bin ich einmal bereits in Kairo gewesen. Ich habe Präsident Nasser gesehen; sein schwer bewachter Autokonvoi fuhr gerade vorüber, und in einer der mächtigen Limousinen saß halb liegend, einem ruhenden Raubtier gleich, der Präsident, den Schädel wie lustvoll, einen möglichen Gegner witternd, emporgehoben. Er versuchte, seinem Volk ein Stück jenes materiellen Glückes, das die Europäer so hoch schätzen, zu verschaffen. Mit Gewalt. Damals waren die Straßen der Stadt voll von Bettlern.
Präsident Sadat hat dem selben Glück andere Türen und Tore geöffnet; der Erfolg seiner Friedfertigkeit wird durch eine grandiose Bautätigkeit bezeugt, und Bettler sind nicht mehr zu sehen. Dennoch vergessen die Ägypter die Lehren ihrer mehr als fünftausend Jahre alten Kultur nicht: ihr Alltag, ihr Lebensgefühl, ihre heitere Ruhe inmitten des chaotischen Straßenverkehrs ist von dieser Kultur durchdrungen. Sa-dats Mörder, die islamischen Fundamentalisten, begingen nicht nur ein Verbrechen, sondern auch einen Irrtum. Schießende Kulturpessimisten haben selten recht.
Den geheimnisvollen Zusammenhang zwischen Geburt und Tod, Entstehen und Vergehen haben die Menschen von Kairo täglich vor Augen.
In ihrer für zwei Millionen Einwohner angelegten Stadt leben heute neun oder vielleicht sogar zwölf Millionen Leute; die genaue Zahl der Einwohner ist niemandem bekannt, aber man weiß, daß sie in jedem Jahr um eine Million zunimmt.
Man sagt, mehr als die Hälfte dieser Menschen hat noch niemals in einem Bett genächtigt. Viele ziehen sich für die Nacht in einen Winkel zurück, in eine selbstgebaute Hütte öder auf den Friedhof, in eines der quadratischen, dem Totenkult dienenden Häuser, aber morgens verlassen sie dann ihre Elendsquartiere'frisch gewaschen, in sauberem Gewand und anscheinend heiter, gehen arbeiten, suchen eine Beschäftigung, versuchen Geld zu- verdienen. Kleine Ziegenherden ziehen an der Universität vorbei, suchen im Abfall nach Nahrung, und die alte Frau, die die Tiere hütet, hat vor den Autos offenbar keine Angst raquo; An den großen Straßen stehen neue Wohnhäuser ohne Zahl; gewaltige Rohbauten säumen die breiten Boulevards. Inmitten dieser Stadt der lärmenden, geschäftigen, mit den Nerven erfaßbaren Vitalität liegt aber Fustät.
Eine Totenstadt? Nein, auch eine Totenstadt ist eine Stadt. Fustät ist eine kahle, von kniehohen schmutziggrauen Mauerresten bedeckte Öde, über der schwer und übelriechend der Rauch verbrannten Mistes steht. Wilde Hunde sonnen sich in Schutt und Unrat. In der Ferne, vor Hochhäusern, Moscheen und Palästen, fahren unzählige Autos die Straße entlang: kleine quadratische Schatten auf einer geraden Linie.
Und das hier, dieses Fustät, ist noch vor siebenhundert Jahren ein Ort des Luxus gewesen, „die schönste Stadt Ägyptens mit bis zu sieben Stockwerken hohen Häusern, mit Gärten, Terrassen und öffentlichen Bädern", so steht's im Reiseführer zu lesen. Was man sieht, wurde ausgegraben. Bis zur Ankunft der Archäologen war Fustät verschollen. Wohin sind die Gärten verschwunden? Wer Fustät gesehen hat, weiß, daß Dantes Inferno kein Fiebertraum ist, sondern die realistische Schilderung des in dieser Welt Möglichen, und daß auch das Schöne vergeht, elend, in Schmutz, ohne Würde. Und es hilft kein Glauben, keine Besessenheit, kein Streben nach Größe.
Die Pyramiden und Grabmäler von Sakkara und Gizeh sind nur dank des trockenen Klimas und des Sandes erhalten geblieben, und da sie für ein kriegführendes Heer wertlos erschienen. Nur zum Spaß schössen Napoleons Artilleristen auf die große Sphinx. Fustät aber wurde „als die Kreuzfahrer von Almarich I. im Jahre 1168 anrückten, auf Befehl des Großwesirs Schahwar in Brand gesteckt, um sie nicht in die Hände der Christen fallen zu lassen".
Wer weiß heute, ob Almarich I. ein guter oder böser Mensch, ob der Großwesir Schahwar ein dummer Befehlsempfänger oder ein genialer Stratege war? Schwajje, schwajje. Wozu soll man alles wissen?
Die Menschen in Kairo leben, leben immer noch, vermehren sich, heiter, genügsam, pfiffig, geistig wach — trotz allem. Ja, auch trotz des Schicksals von Fustät. Ich glaube, in diesem Trotz liegt das Geheimnis ihrer Vitalität.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!