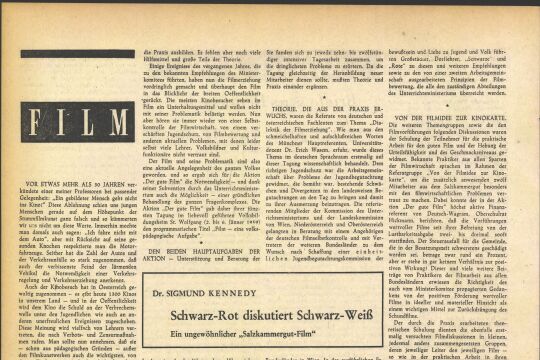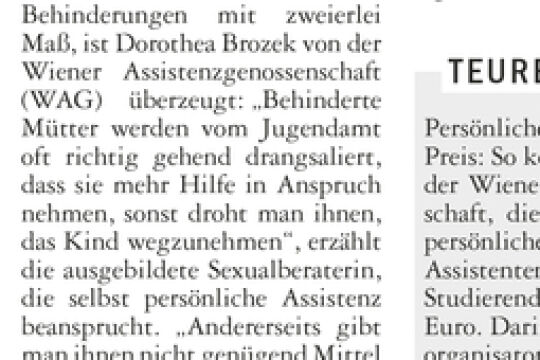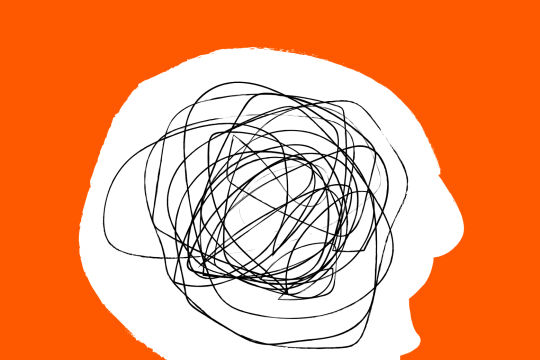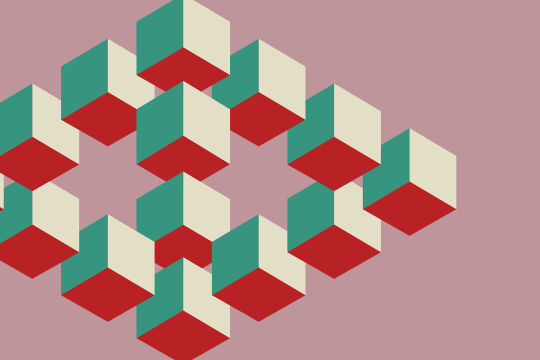Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Selbsthilfe der Eltern Geldmangel behindert
In der „Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation“ sind zahlreiche Selbsthilfeverbände Behinderter oder ihrer Angehörigen vertreten. Einer davon ist die Wiener „Vereinigung zugunsten körperbehinderter Kinder und Jugendlicher“, die gerade den Ausbau eines Therapiezentrums für Kinder in der Märzstraße 122 betreibt
Dr. Christoph Lesigang, Oberarzt an der Wiener Universitäts-Kinderklinik, der das Unternehmen medizinisch betreut betont, daß es sich keineswegs um einen Elternverein der Kinderklinik handelt, sondern um eine spontan gebüdete Selbsthilfeorganisation der Eltern behinderter Kinder, die zu einem großen Teü an der Kinderklinik in Behandlung stehen. Die Klinik gab zwar durch eine Elternversammlung den Anstoß, liefert auch die wissen-schaftlichen Grundlagen, nahm aber auf die Bildung des Vereins keinerlei Einfluß.
Mit Hüfe der Ersten österreichischen Spar-Casse erwarb der Verein im Frühjahr 1976 ein Souterrainlokal und begann nach besten Kräften, begünstigt durch zahlreiche Spenden, mit der Ausgestaltung. Ein Flohmarkt und Weihnachtsmärkte brachten weiteres Kapital für das Therapiezentrum. Die Planung besorgte ein Architekturstudent der Meisterklasse Prof. Rainer, als Bauführer fungiert ein Elternvertreter. Aus Geldmangel gehen die Arbeiten nur schleppend voran. Subventionsansuchen beim Gesundheitsministerium und bei der Stadt Wien wurden abgelehnt, aber nicht, weil den Verantwortlichen die Probleme nicht bewußt sind, betont Dr. Lesigang, sondern wegen der schlechten Budgetsituation in den zuständigen Ressorts. Wenn zwei Millionen Schilling zur Verfügung stünden, könnte das Therapiezentrum in drei Monaten einsatzbereit sein.
Die intensive Frühbehandlung behinderter Kinder ist ja erst wenige Jahre alt, trotz, aber auch wegen der medizinischen Fortschritte ist die Situation nicht einfacher geworden. Wirkt sich die besser Früherkennung von Behinderungen (nicht zuletzt auf Grund des Mutter-Kind-Passes) günstig für die Therapiechancen aus, werden anderseits immer mehr Kinder geboren und aufgezogen, die in früheren Zeiten kaum lebensfähig gewesen wären. Für Dr. Lesigang ist der nach wie vor nicht eindeutig definierbare Terminus „Behinderung“ „ein Zustand, der die Möglichkeiten eines Kindes beschränkt, einen fraglosen Platz in der Gesellschaft einzunehmen“.
Genügt für das Erkennen einer Behinderung kaum eine Stunde, so erfordert die Behandlung eine Stunde pro Woche durch ein ganzes Jahr. Hier könnte das geplante Therapiezentrum, in dem zwei Physiotherapeutinnen, je eine Sprach- und Beschäftigungstherapeutin, ein Psychologe und ein Arzt tätig sein sollen, wertvolle Arbeit leisten. Vorgesehen wäre eine ambulante einstündige Behandlung pro Woche, zu der das Kind mit der Mutter oder, noch besser, den Eltern in das Therapiezentrum kommt, ist doch ein wesentliches Anliegen der Mediziner die Elterninstruktion, damit die Arbeit in der Familie fortgesetzt wird.
Dr. Lesigang räumt ein, daß derzeit der therapeutische Bedarf für behinderte Kinder nur zu etwa einem Drittel gedeckt werden kann, daß es dem Laien auch schwerfallen mag, große Fortschritte durch die Behandlung zu erkennen: „Aber es ist schon sehr viel gewonnen, wenn ein Kind ein bißchen gehen kann, statt im Rollstuhl zu sitzen, wenn es lernt, statt schlecht zu gehen, etwas besser zu gehen.“ Zur Behebung von Bewegungsstörungen wird die vor etwa dreißig Jahren in England entwickelte Bobath-Methode angewendet. Oft fehlen leider, speziell auf dem Gebiet der Sprachtherapie, geeignete Therapeutinnen, denn viele gehen wegen der besseren Verdienstmöglichkeiten ins Ausland.
Ziel jeder Behandlung behinderter Kinder ist die Verwirklichung des höchstmöglichen Maßes an Integration, Ziel der Eltern ist die Fertigstellung des Therapiezentrums Märzstraße, das den ebenso selten wie wichtig gewordenen Willen zur Selbsthüfe dokumentiert.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!