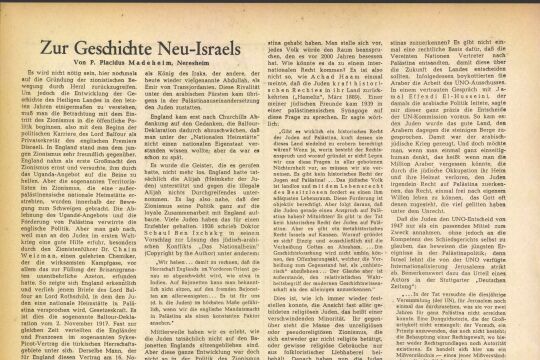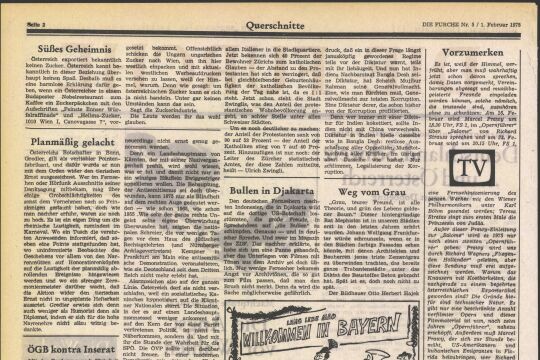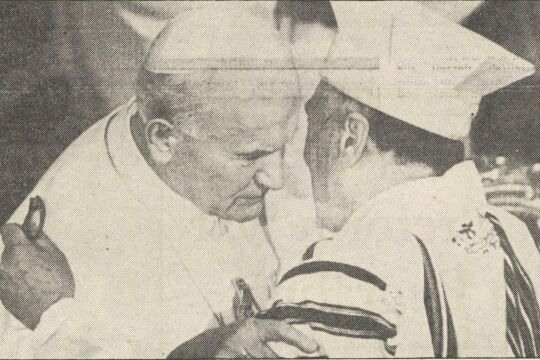Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Sind die Juden normale Menschen?
1965 verfaßte der französische Soziologe Georges Friedmann — selbst Jude — ein Buch von verblüffender Dummheit: „Das Ende des jüdischen Volkes?“ (deutsch 1968 bei Rowohlt). Er traktiert darin die nicht eben neuen Thesen, daß durch die Existenz eines Judenstaates die Judai-zität verlorengehe: in Israel selbst durch „Normalisierung“, und in der Diaspora durch totale Assimilation — Thesen, die zwei Jahre später, im Juni-Krieg 1967, eklatant widerlegt worden sind. Immerhin kann man aus diesem Buch erfahren, was in Israel wirklich übel ist, denn nur dieses findet des Autors Beifall: von den so arroganten wie brutalen Autobuslenkern bis zu dem undemokratischen und asozialen Komplex, in den die einst segensreiche Hista-druth sich verwandelt hat.
Die innere Dynamik hingegen, das oft tief ins Mißverständnis reichende Selbstverständnis des Judenstaates beschreibt und deutet Arnos Elon in „Die Israelis, Gründer und Söhne“ (deutsch 1972 bei Molden). Ja mehr noch: Elon liefert selber einen engagierten Beitrag zu dem faszinierenden Dialog, den das israelische Judentum mit seiner Gegenwart führt, und das heiß aber, sehr viel mehr als bei anderen Völkern, mit seiner Geschichte, letztendlich also mit seinem Gott.
Schlicht eine Darstellung dessen, was man gemeinhin „Land und Leute“ nennt brachte termingerecht zur 25-Jahr-Feier der Piper-Verlag in seiner Panorama-Reihe: „30mal Israel“ von Willy Guggenheim. Auch dieser Autor kann, wie Friedmann, seine Herkunft aus der Soziologie nicht verleugnen; aber er weigert sich strikt, endgültige Schlüsse zu ziehen aus Zahlen, die nächstes Jahr schon nicht mehr stimmen. Denn nichts in Israel hat seine Grenzen, nicht einmal der Staat selbst; und die in Quantität wie Qualität stets wechselnde Immigration verändert natürlich nicht nur die demographische Statistik, sondern auch die ökonomische und soziale Struktur, auch die Besiedlung, auch die Wehrkraft, auch die Ideologie, und nicht zuletzt auch die Position der Kirche im Staat. In diesem ständigen Wechsel das Bleibende zu entdecken, aus lauter Imponderabilien das Charakteristische herauszulesen: das muß wahrlich keine leichte Arbeit gewesen sein. Guggenheim hat sie mit wahrscheinlich optimalem Erfolg geleistet.
Bewunderung verdient schon seine Komposition. In den Grenzen vom Mai 1967 — und Guggenheim bewegt sich, mit Ausnahme eines Kapitels, nur innerhalb dieser Grenzen — war Israels Staatsgebiet nur halb so groß wie das der Schweiz. Im nicht bloß geographischen Sinn hingegen ist Israel das größte Land der Welt, da in diesem Raum die Epochen und die Kulturen sich drängen wie nirgendwo sonst. Wann also beginnen, und wo, und wie? Mit Jerichos neuntausendjähriger Stadtgeschichte, oder mit dem Idealkommunismus im Kib-butz? Mit der Zerstörung des Tempels anno 70 oder mit Auschwitz? Mit Moses oder mit Herzl?
Nun: Guggenheim hatte den glücklichen Einfall, die Eigentümlichkeiten von Volk und Staat Israel an dem Beispiel gewisser Städte oder Regionen sichtbar zu machen: Jerusalem — das ist die Idee des Judentums „zwischen Archäologie und Endzeit“, die Religion als Staatsersatz, der Messianismus als politische Aktion. Galiläa — das Ist die „ideologische Landschaft“, von Jesus von Nazareth über die Kabbalisten von Safed bis zu den ersten Kibbutzniks von De-gania. Tel Aviv — das ist die Vierte und Fünfte Alijah, die Einwanderungswellen der zwanziger und der dreißiger Jahre, Kapital statt Ideal, Intelligenz statt Enthusiasmus. Ne-gev — das ist der Sieg der Technologie über die Wüste, aber auch über das französische Waffenembargo, das ist auch der Sieg von Erziehung und Regionalplanung über innerjüdische Diskriminierung. Masada — das ist Erinnerung an jüdisches Heldentum vor neunzehnhundert Jahren, das ist die heute wohl beste Armee der Welt, und das ist auch die Politik, in der UNO wie im Gazastreifen, die eine neue Masada-Situation gar nicht erst entstehen lassen will. Durch alle Kapitel aber zieht sich die Absicht des Verfassers, die Juden von den Klischees zu befreien, und zwar auch von denen des Philosemitismus, da ja auch dieser die Juden ins Ghetto zwängt. Sein Buch ist ein klares Ja auf die Frage, ob die Juden „normale“ Menschen seien.
Diese Frage stellt freilich keineswegs nur der Antisemitismus, sondern zuerst schon das Judentum selbst; und diese Frage lautet in letzter Konsequenz, ob Auserwählt-heit und „Normalität“ sich vereinen lassen. Martin Buber hat diese Frage verneint: „Wenn Israel weniger will, als was mit ihm gemeint ist, wird es auch das Wenigere verfehlen“; es wird dann nicht „das Zentrum der Menschlichkeit“, sondern „ein jüdisches Albanien“ sein. Guggenheim hingegen sieht, völlig richtig, „das Auseinanderklaffen einer ursprünglich sozio-religiösen Kultur in ihre soziale und religiöse Komponente“ und darin die Ursache eines Kulturkampfes, der ja unterirdisch bereits im Gange ist und voraussichtlich erst mit der völligen Trennung von Staat und Kirche beendet sein wird. Der liberale Jude Guggenheim hat, laut eigenem Zeugnis, „wenig Verständnis für religiösen Fanatismus“, erkennt aber ohne Vorbehalt die Rückbesinnung zumindest des israelischen Judentums auf die „religiösen Ur-kräfte“, die der von Sozialismus und Atomkraft faszinierten Gesellschaft scheinbar abhanden gekommen waren. Gläubigkeit und religiöse Gesetzestreue — so etwa resümiert er — mögen im Judenstaat prozentuell nicht größer sein als in christlichen Ländern; die religiösen Traditionen hingegen wirken in Israel, im Gegensatz zu Europa, ungebrochen bis in den Alltag sogar auch der Atheisten hinein.
Eine solche Haltung vor an sich unlösbaren Rätseln bekundet weit mehr als bloße Objektivität; sie zeugt von Redlichkeit — von einer Redlichkeit, die man dem sowieso fast pedantisch gründlichen Verfasser auch dort nicht wird absprechen wollen, wo man Gewichte anders verteilt oder wo man ein anderes Beispiel gesetzt sehen möchte: Der Christ, der vom Konfessionsgezänk angewidert aus der Geburtsoder aus der Grabeskirche flieht, findet nicht erst am See Genezareth die seinem Glauben gemäße Stimmung, sondern auch schon in Jerusalem selbst: in dem von Protestanten betreuten „Gartengrab“, gleich vi3-ä-vis vom Damaskus-Tor. Mea Schea-rim, jenes Viertel von Jerusalem, in dem das ostjüdische Getto fortexistiert, hätte mehr „Malerei“ verdient — wie auch Eilat, diese aus Po-fel und Luxus gemixte „Goldgräberstadt“ am Roten Meer. Man mag einen Tag an der Allenby-Brücke vermissen, dieser friedlichen Grenzstation zwischen zwei im Kriegszustand lebenden Staaten, mit der verglichen ein deutsch-deutscher Grenzübergang beinahe KZ-Assoziationen erweckt. Daß die Armee im wahrsten Wortsinn die „Schule der Nation“ ist, ließe sich durch eine Beschreibung ihres Erziehungssystems noch deutlicher machen; und als einen Kronzeugen für das Primat der Politik hätte Guggenheim etwa den Clausewitz-Forscher Jehuda L. Wallach („Das Dogma der Vernichtungsschlacht“) zitieren können. Sehr ausführlich schildert der Autor den Schmelztiegel Israel, die positiven und die negativen Aspekte der Integration von Menschen aus den verschiedensten Kulturen; aber erstaunlicherweise vermerkt er nicht, um wie viel stärker die Prägung vieler Juden durch ihr früheres „Gastland“ ist als das substantiell Jüdische: daß man, gewissermaßen, in Israel kaum dem „typischen“ Juden begegnet, um so öfter aber dem „typischen“ deutschen Professor, dem „typischen“ gemütlichen Weener, dem „typischen“ russischen Grübler und Zweifler, dem „typischen“ britischen Kolonialoffizier, dem „typischen“ ungarischen Feschak...
Je nun: wenn an einem Buch, das derart viel Information über ein derart komplexes Phänomen liefert, ein kritischer Leser nichts weiter zu mäkeln findet, dann muß das ein wirklich gutes Buch sein: ein Buch, jedenfalls, das Vertrauen verdient.
30MAL ISRAEL. Von Willy Guggenheim. Piper-Verlag, München 1973.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!