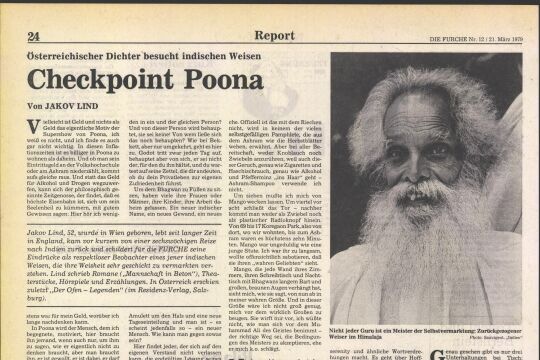Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Sing, Mariele, sing“
Wenn sie mit ihrem. Vater, dem königlich-bayerischen Bezirkstierarzt Johann Baptist Ehrle, im Wagen über Land fuhr, sagte er: „Sing, Mariele, sing.“ Und sie sang.
„Auf da Wasa / graset Hasa / in da Wässerla / gampat d' Fisch...“ Was man tunlichst nicht übersetzen sollte, weil es den Schmelz von den Worten streift.
Auf ihrem Kommunionbild sieht sie aus wie eine Prinzessin. Ein Kindergesicht, wie eine Gernme geschnitten, ein Kind, dessen natürliche Anmut die strenge Erziehung überblüht hat.
(Der Vater ließ eher etwas durchgehen. Die Mutter war streng.) Die natürliche Anmut und die strenge Erziehung sind ihr immer geblieben.
Manieren müssen sein. Das gilt wie das elfte Gebot. Aber wenn sie bei einer Vorstellung zur Begrüßung den Kopf neigt, eine leichte Verbeugung andeutet, dann ist das von jener Grazie, von jener natürlichen Anmut, die von keinem noch so sorgfältig geübten Hofknicks übertroffen werden kann.
Sie hat sich auf vielen Vorstellungen verbeugt, wenn der Beifall kein Ende nehmen wollte. Nicht in der „Met“ oder der Pariser Oper. In einer Marktgemeinde im Allgäuer Voralpenland, wo sie als Jüngste von sieben Geschwistern aufwuchs.
Sie hätte gern studiert, wäre eine gute Kinderärztin oder Lehrerin geworden, aber wo vier Brüder studierten, mußten die Mädchen zurückstehen.
Das junge Mädchen hat den samtenen Liebreiz eines Stiefmütterchens. Eines sehr entschiedenen Stiefmütterchens mit blitzenden Augen. Sie weiß, was sie will. Sie will einen Beruf. Die Verehrer müssen warten.
„Singen und Spielen zur Laute fein, ist leichter, als stolze Mädchen frei'n“, stickt sie einem aufs Lautenband. (Vier Jahre später führt er sie heim, wie man damals sagte.)
Sie lernt Schreibmaschine und Stenografie, arbeitet auf dem Landratsamt der Marktgemeinde, zu jener Zeit durchaus noch eine Seltenheit.
„Sing, Mariele, sing“, hatte der Vater zu der Fünfjährigen gesagt.
Als sie fünfzehn war, hatte man ihre Stimme entdeckt. Zum Schulunterricht kam die Ausbüdung in Gesang und Klavierspiel. In den zwanziger Jahren stand sie auf der Bühne jener Marktgemeinde, sang die Titelrollen von Operetten. „Das Glücksmädel“. Fünf ausverkaufte Vorstellungen waren keine Seltenheit. Mitunter verging ihr das Singen. Das Leben faßte sie nicht mit Glacehandschuhen an. Sie ließ sich nicht unterkriegen.
„Ich kann nicht“ gibt es nicht für sie. Nur „ich will nicht“. Und sie will.
Ihre kreatürliche Trauer geht sie körperlich an: sie arbeitet sich müde. Sie erstickt nichts und schon gar nichts im Keim. Raus damit.
Wenn es sein muß, und manchmal muß es sein, flucht sie leise und deutlich. Nichts, was die Kirche und ihre Heiligen kränken könnte. Nur Literarisches. Goethe lernt man im Internat.
Resignation haßt sie, weil sie ihre Gefahren kennt. Eine gute Tasse Kaffee liebt sie.
Um den Taoismus oder die Zen-Lehre hat sie sich nie gekümmert. Wenn man ihr sagen würde, daß auch in den kleinsten Verrichtungen und Begebenheiten des Alltags das Große liegt, würde sie ihr Was-du-nicht-sagst-Gesicht machen, das sie aufsetzt, wenn einer viel Aufhebens von etwas Selbstverständlichem macht.
Blut und Leben für die Familie ist ihr ungeschriebener Wahlspruch. Ich weiß, daß sie jeden Abend für uns alle betet. Für die ganze Sippe und für viele Freunde, für Tote und Lebende.
Nur wenn sie sehr viel Arbeit gehabt hat und sehr müde ist, macht sie's kurz, weil die höchste Instanz ohnehin allwissend ist.
Dann faltet sie die Hände und sagt: „... und für alle anderen -du weißt schon: Amen.“
Und stellt den Wecker auf fünf Uhr.
Sie betet aber auch für sich, denn was wäre, wenn es mit ihr nichts mehr wäre? Was hätten die anderen dann von ihr?
„Lieber Gott“, sagt sie, „erhalt' mir doch meinen Verstand.“
„Sing, Mariele, sing“, hat ihr Vater gesagt.
Sie singt noch immer, am liebsten und längsten zu Weihnachten, wenn die Kinder, die Enkel kommen, wenn der Sohn am Klavier sitzt, wenn ihr heller Sopran über den anderen Stimmen schwebt.
Was ihre Stimme an Kraft und Glanz verloren hat, das hat sie an Innigkeit und Wehmut gewonnen.
Wenn sie von früher erzählt, ist es, als blätterte sie in einem großen bunten Bilderbuch.
Während sie erzählt, ist sie nicht etwa untätig (das kommt nur „alle heilige Zeiten“ vor), sondern rollt den Nudelteig für die Krautkrampf en aus, die es zu Mittag geben soll.
Während sie das tut und erzählt, wirft sie mir einen aufmerksamen Blick zu, ob ich auch zuschaue, denn ich soll es lernen.
Die Brätknödel für die Suppe hat sie längst fertig, den Kuchen ohnehin, und um sechs Uhr hing schon die erste Wäsche auf dem Dachboden.
Ihre Schrift ist wie gestochen. Ihr Internats-Französisch klingt so elegant, als wäre sie in den Pariser Salons aus und ein gegangen.
Aber das ist sie nicht. Sie ist in der Welt überhaupt nicht aus und ein gegangen, ist über die Landesgrenzen kaum hinausgekommen, ist kein Weltkind, kennt die Welt, läßt sich nichts vormachen.
Ihr Wirklichkeitssinn ist der wirklichste, den ich kenne. Darum beneide ich sie.
Ihre Entscheidungen fallen immer zu Gunsten des Lebens. Ihre Spontaneität ist umwerfend.
In die Welt ist sie nicht gekommen. Seit es das Fernsehen gibt, kommt die Welt zu ihr. Sie kennt sie alle: die Ansagerinnen und Ansager, die Politiker und die Stars. Sie sieht und hört aufmerksam zu und spart nicht mit Kommentaren und Kritik.
„I sag's wie's is“, ein Satz, der mich geradezu überwältigt. Sie sagt, wie's ist. Das setzt voraus, daß sie weiß, wie's ist. Und ich bin sicher: sie weiß es.
„Les enfants du paradis“ sind für sie kein Grund, um ihre kurze Nachtruhe zu opfern.
„Gut's Nächtie“, sagt sie und geht schlafen, während wir erst gegen Mitternacht mit einem tiefen Atemzug der Bewunderung auf den Abstellknopf des Fernsehapparats drücken.
Wenn wir am Morgen unausgeschlafen in der Küche erscheinen, uns an den gedeckten Tisch setzen, begrüßt sie.uns mit liebevoller Nachsicht und gießt uns starken Kaffee ein. Am Abend war es an mir, nachsichtig zu lächeln, als sie „gut's Nächtie“ sagte, während Jean Louis Barrault im weißen Seidengewand des Pierrot über die Bühne wehte. Jetzt, über dem heißen Kaffee, komme ich ins Nachdenken. Ich sehe eben noch, daß sie meine aufgestützten Ellenbogen und meinen tief über die Tasse geneigten Kopf bemerkt und duldet.
Dann gehe ich in dem Duft des Kaffees unter. Zwischen den
Dampf schwaden taucht der Pierrot auf, weht mit seidenem Gewand flatternd aufwärts, ein Riesenschmetterling, wird gepackt, über die Wäscheleine gehängt, zappelt.
Ich fahre auf, weü die anderen laut lachen. Und worüber?
Weil sie erzählt (während sie den Salat putzt), daß sie schon in der Früh um halb vier, noch im Bett liegend, angefangen hat, das Einschlagtuch rund um sich herum abzuknöpfein, leise, um niemanden zu stören. Was sie um sechs Uhr auf der Terrasse aufgehängt und um sieben Uhr abgenommen hat, ist schon wieder fertig zum Bügeln.
Ich sehe sie an und denke, daß Vor-Bilder keine großen Namen zu tragen brauchen.
Es wird Zeit, daß ich die Zeit nutze, um meiner Schwiegermutter diese Zeilen zu schreiben. Im Mai feiern wir ihren achtzigsten Geburtstag.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!