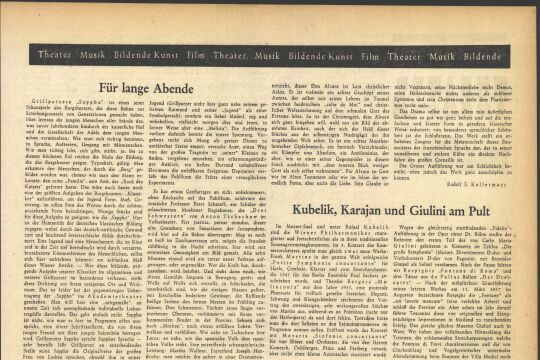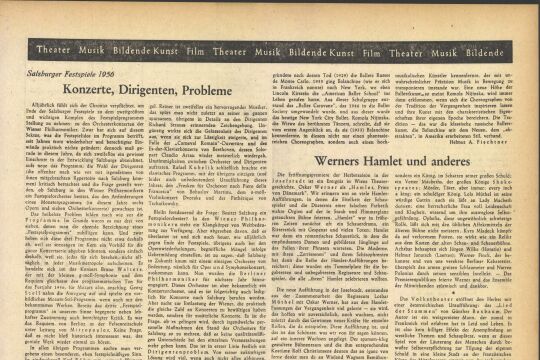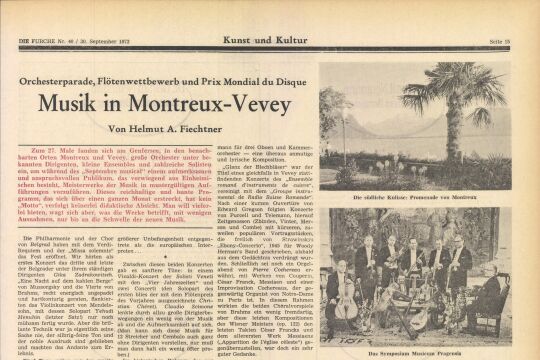Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Solti und Abbado
Am vergangenen Samstag und Sonntag gastierte unter seinem Ohefdirigenten Georg Solu im Großen Musikvereinssaal das Orchestre de Paris, über dessen Entstehung und Entwicklung wir bereits in der letzten Folge der FURCHE berichtet haben. Auf dem Programm standen die „Symphonie fantastique“ von Berlioz und die III. Symphonie von Albert Roussel, einem hierzulande fast unbekannten Komponisten. — Nach mehrjährigen Fahrten auf den Weltmeeren als Leutnant zur See war Roussel von 1898 bis 1914 zunächst Schüler, dann Assistent und Nachfolger von Vincent d'Indy. Sein Bestreben war es, Impressionismus und Symphonik zu verbinden und „absolute Musik“ zu schreiben, wozu er auch seine Ballette zählte. Dies ist ihm in einer ganzen Reihe von Meisterwerken gelungen, von denen man bei uns nur die Suite aus „Bacchus et Ariane“ kennt und zu denen auch die 1929 für das Jubiläum des Boston Symphony Orchestral geschriebene III. Symphonie gerechnet werden kann (Roussel ist schon 1937 gestorben). Das fünfund-
zwanzig Minuten dauernde Werk zeigt die vierteilige klassische Form, die Ecksätze sind durch eine sehr ausgeprägte Rhythmik und Ostinato-Motorik gekennzeichnet, die Mittelteile durch anmutige, weitgeschwungene Holzbläsermelodien und ausgedehnte Soli der 1. Geige. Jeder Satz zeigt eine solide musikalische Arcnitektur, plastische Einfälle und eine so eigene Handschrift, daß Roussel es sich leisten kann, zweimal auch ungeniert ein Tschaikowsky-Motiv zu zitieren. Das Orchester macht einen guten Eindruck, es hat Kraft und Delikatesse, Volumen und Schönklang. Mit seinem Leiter, der, bevor er die Doppeidirektion beim Chicago Symphony Orchestra und dem Orchestre de Paris antrat, zehn Janre lang Covent Garden geleitet hat und danach in den Adelsstand erhoben wurde (Sir), hat das Publikum die seltenen Gäste sehr lebhaft gefeiert.H. A. F.
Kurz vor ihrem Abflug zur großen Ostasientournee gaben die Wiener Philharmoniker unter ihrem derzeitigen Lieblingsdirigenten Claudio Abbado ein Extrakonzert mit einem Mozart-Programm. Vielleicht sollte es ein Beschwichtigungszuckerl dafür sein, daß sie jetzt die Staatsoper nur mit 48 zurückbleibenden Musikern (zuzüglich der Substituten) bespielen können. Jedenfalls ein schöner Abschied vor einer sicherlich strapaziösen, aber für die Intere Österreichs und seine Kunst werbenden Reise. Man hörte zwei, übrigens auch in das Reiseprogramm aufgenommene Mozart-Werke, die verhältnismäßig seltener aufgeführte „Konzertante Symphonie für Violine und Viola“, KV 364, und die das symphonische Schaffen des Meisters krönende „Jupiter-Symphonie“. Dem Solopart der Geige lieh Konzertmeister Gerhart Hetzel schönen, blühenden Ton, wurde aber von seinem Kollegen Rudolf Streng, dem Bratschisten, in der Wärme seiner Mozart-Interpretation übertroffen. Abbados Mozart-Auffassung ist eine andere als die unseres großen Mozart-Spezialisten Karl Böhm, das wurde in dem dem Italiener am besten liegenden Finale klar, während der seelenvolle Gesang des Andante einen voll mitgehenden Herzschlag nicht verspüren ließ, wenn auch die Philharmoniker viel aus eigenem dazugaben. Eine von Kurt Rapf eingangs gespielte Orgel-Partita von Joh. Nep. David hätte nach der im Programm enthaltenen Analyse sich weit erträglicher anhören lassen müssen, als dies in Wirklichkeit — und noch dazu in der Dauer einer halben Stunde! — der Fall war.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!