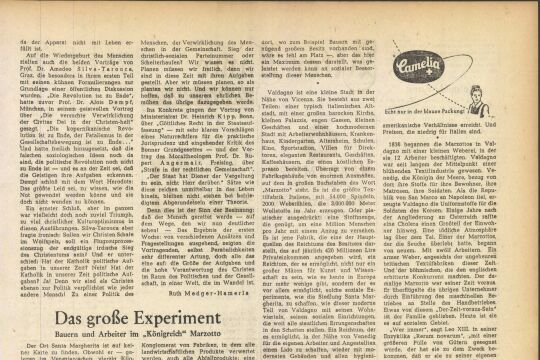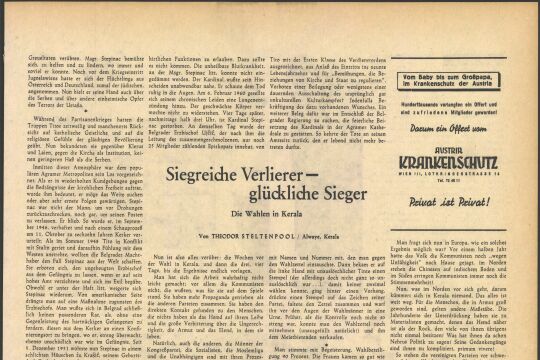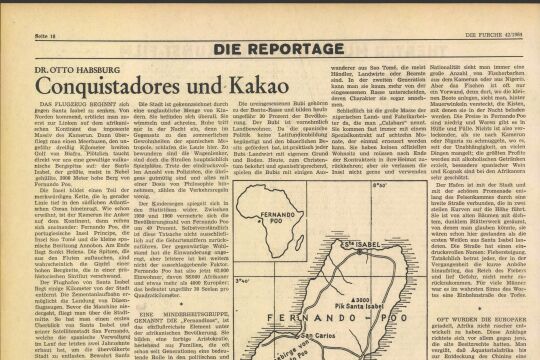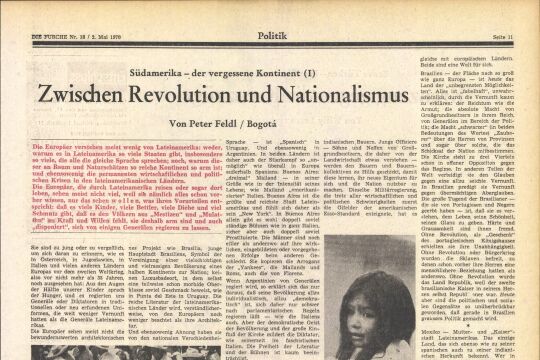Sozialarbeit auf einem Vulkan
Die Bilder vom Besuch des Papstes in Santa Cecilia, einem Slum der mexikanischen Stadt Guadalajara, gingen um die Welt. Der mit einer Mexikanerin verheiratete österreichische Physiker Gerhard Kunze hat in eben diesem Viertel jahrelang als Entwicklungshelfer gearbeitet und schrieb darüber für die FURCHE diesen Bericht.
Die Bilder vom Besuch des Papstes in Santa Cecilia, einem Slum der mexikanischen Stadt Guadalajara, gingen um die Welt. Der mit einer Mexikanerin verheiratete österreichische Physiker Gerhard Kunze hat in eben diesem Viertel jahrelang als Entwicklungshelfer gearbeitet und schrieb darüber für die FURCHE diesen Bericht.
Wir kamen 1973 als Entwicklungshelfer nach Mexiko. Wir sollten mit einer größeren Gruppe von Mexikanern an einem Entwicklungsprojekt in den Slums der zweitgrößten Stadt Mexikos, Guadalajara, mitarbeiten. Jenes Projekt war einige Jahre vorher im Anschluß an die letzte Lateinamerikanische Bischofskonferenz in Medellin begonnen worden, als die Kirche in Lateinamerika ernsthaft begann, sich den Armen zuzuwenden.
Eine Gruppe von Jesuiten betrieb damals in Guadalajara ein Jugendzentrum für die Kinder der Oberschicht. Sie beschlossen, diese Anlagen zu verkaufen, und mit dem Geld einen Fonds zu gründen, mit dem als Versuchsmodell ein Slumviertel, und zwar Santa Cecilia, gefördert werden
„Zerrüttete Familien, jeder mißtraut jedem“
sollte. Als technische Berater wurden eine Reihe von Laien herangezogen, die in dem Verein IMDEC (spanische Abkürzung für: „Mexikanisches Institut zur Förderung des Gemeinwesens“) zusammengeschlossen wurden. Es waren dies Sozialarbeiter, Architekten, Ingenieure, Ärzte, Rechtsanwälte und so weiter, insgesamt etwa 30 Personen.
Zunächst begann man mit der Gründung von Basisgruppen. Man ging davon aus, daß der Normalmexikaner zwar katholisch ist, von dieser Religion aber nicht viel mehr als das Vaterunser und das Glaubensbekenntnis kennt. In einer intensiven Evangelisierung wurden von drei Jesuiten und fünf Damen vom Sacr6-Coeur rund 70 Basisgruppen mit etwa 2000 Mitgliedern gegründet, die ein- bis zweimal in der Woche zusammentrafen, das Evangelium lasen und gemeinsam seine Bedeutung für ihr eigenes Leben diskutierten. Nach einiger Zeit wählten die meisten dieser Gruppen ihre eigenen Diskussionsleiter und die Promotoren konnten sich zurückziehen. Parallel dazu wurde eine umfangreiche Feldforschung durchgeführt, bei der die wesentlichen sozioökonomischen Faktoren ermittelt wurden.
Sodann wurde ein Zentrum gegründet, wo man Betreuung durch Arzt, Sozialarbeiterin, Rechtsanwalt oder Bauingenieur in Anspruch nehmen kann. Bezahlen muß dafür jeder nur so viel, wie ihm auf Grund seiner finanziellen Verhältnisse zugemutet werden kann. Außerdem
kann man dort Baumaterial zu Großhandelspreisen kaufen. In den übrigen Slumvierteln bekommt man Baumaterial nur bei Wucherern, was viele Leute daran hindert, sich ein Haus aus Ziegeln zu bauen. Der Slumbewohner, der in seiner Freizeit sein Haus selbst baut, kauft jedes Wochenende 100 Ziegel, und für die muß er beim Wuchererein Vielfaches des sonst üblichen Preises zahlen.
Als wir 1973 mit unserer Arbeit anfingen, war all diese Vorarbeit schon geleistet. Es gab sogar schon 20 Produktionsgenossenschaften, in denen alle möglichen Artikel vom Besen bis zum dekorativen Blumenbild hergestellt wurden. Santa Cecilia selbst war damals im raschen Wachsen. Die Bevölkerung von Guadalajara wächst um sieben Prozent jährlich. Die Hälfte dieses Zuwachses kommt von ehemaligen Bauern, die in die Stadt abwandern. Uberall schießen neue Elendsviertel aus dem Boden. Santa Cecilia war damals etwa erst zur Hälfte erbaut und hatte rund 20.000 Einwohner.
Die soziale Situation war die gleiche wie in den anderen Slumvierteln auch. Zunächst stechen die menschlichen Probleme ins Auge: Alkoholismus, Drogensucht schon bei kleinen Kindern (sie inhalieren Lackverdünner, was häufig zu Todesfällen führt), zahllose bettelnde Kinder auf den Straßen, zerrüttete Familien, jeder mißtraut jedem. Auf den zweiten Blick erkennt man, daß diese Probleme durch die Lebensbedingungen dieser Menschen verursacht werden.
Da ist einmal die Arbeitslosigkeit. Der gesetzliche Lohn für ungelernte Arbeiter (um solche handelt es sich ja fast ausschließlich) ist schon an sich sehr niedrig: rund 1600 Schilling im Monat. Aber im Durchschnitt findet man nur eine Woche pro Monat Arbeit. Als Folge davon sind die Be-
hausungen äußerst dürftig: oft nur ein Raum, 5x5 Meter, häufigstes Baumaterial ist Teerpappe. Die Familien haben selten weniger als zehn Mitglieder, und diese schlafen dann oft alle zusammen in ein oder zwei großen Betten. Wen wundert es, daß sich unter diesen Bedingungen die meisten Männer nur gelegentlich „zu Hause“ einfinden. Das erklärt anderseits wiederum die hohe Kinderzahl. Da fast jeder Mann mehrere Familien hat (und jede Familie mehrere Väter), fühlen sich die Männer nicht für ihre Angehörigen verantwortlich und steuern nur selten etwas zum Haushaltsbudget bei. Was Wunder also, wenn die Frauen ihre grö-
„Eine erzählte mir stolz, jedes ihrer zwölf Kinder habe einen anderen Vater“
ßeren Kinder zum Schuheputzen, Autowaschen oder Betteln auf die Straße schicken. Kinder mit vier bis fünf Jahren müssen oft schon zum Lebensunterhalt der Familie beisteuern. Nur ein Drittel der Frauen ist überhaupt verheiratet, eine erzählte mir stolz, jedes ihrer zwölf Kinder habe einen anderen Vater.
Aber erst, wenn man ganz genau nachforscht, erkennt man, wie sehr dieses Elend von gewissenlosen Geschäftemachern erzeugt und ausgenützt wird. Viele Männer sind nicht wirklich drei Wochen pro Monat arbeitslos. Sie sind in dieser Zeit nur nicht angemeldet, weil ihr Dienstherr ihnen gesetzwidrig nur einen Schandlohn bezahlt {manchmal 50 Schilling pro Woche und weniger)
mit der Begründung: „Wenn der Mann keine Arbeit hätte, würde er gar nichts verdienen!“
Die Slums von Guadalajara sind keineswegs wilde Siedlungen. Die Großgrundbesitzer, die den Slum-
bewohnern die Parzellen verkaufen, haben sich das Land allerdings ihrerseits meist mit Methoden am Rande oder jenseits der Legalität angeeignet. Von einem wird gemunkelt, rund ein Drittel der Stadtfläche sei irgendwann sein Eigentum gewesen.
Wie so vielen Slumbewohnern, wurden auch denen von Santa Cecilia die bei Parzellierungen gesetzlich vorgeschriebenen Infrastrukturen versprochen und schöne Einreichpläne gezeichnet, aber nie verwirklicht. Und es kam auch vor, daß Leuten, die ihr Grundstück fertig abbezahlt hatten, alle Einzahlungsbelege unter dem Vorwand, sie würden für Formalitäten benötigt, abverlangt wurden - die Quittungen verschwanden, und die Betroffenen mußten mit den Ratenzahlungen von vorne beginnen.
Die Hilfsorganisation hatte also alle Hände voll zu tun. Die religiösen Helfer wohnten in Santa Cecilia selbst. Die beiden Jesuiten Jose Luis und Alfredo bewohnten ein winziges Häuschen, mit zwei mal sechs Metern Grundfläche, fast noch kleiner als die übrigen, obwohl Jose Luis fast zwei Meter groß ist und sich in diesem Puppenhaus überall anstößt. Er ist schon ein älterer Herr und der „Chef des ganzen Projektes, aber er unterscheidet sich äußerlich durch nichts von den ärmsten Bewohnern des Viertels.
Auch in der Ideologie gab es sehr verschiedene Auffassungen zwischen den Ordensleuten und den Laien. Die ersteren waren sich zwar vollkommen darüber im klaren, daß ein Großteil des Elends durch die Ausbeutung und Unterdrückung hervorgerufen wird, aber sie glaubten trotzdem, daß allein durch die
Kraft des Evangeliums die schlimmste Not beseitigt werden kann, denn die liegt ihrer Meinung nach ja in der Zerrüttung der Familienverhältnisse und der Verantwortungslosigkeit vor allem der Männer. Die Laien hingegen strebten einen Bewußtma-chungsprozeß der politischen' Zusammenhänge und der Machtstrukturen an, um eine Vereinigung der Bürger zum gewaltfreien Widerstand zu erreichen. Bis zu einem gewissen Grad gelang es ihnen auch, die Jesuiten für diese Idee zu gewinnen, die Damen vom Sacra Coeur überzeugten sie jedoch nie.
Langsam konnte man beobachten, wie die Dinge in Bewegung kamen. Die Bewohner Santa Cecilias begannen selbst ihre Situation zu verbessert. In Guadalajara, wo seit der Revolution vor 40 Jahren absolute politische Ruhe geherrscht hatte, erregte das Aufsehen. Die Beunruhigung der Lokalpolitiker stieg noch, als sich die Bürger von Santa Cecilia, ohne dazu von der Regierung aufgefordert worden zu sein, eine demokratische Vertretung wählten (eine Art Parlament), und das in einem Land, wo Lokalpolitiker de facto nur von oben eingesetzt werden.
Nun geschah Merkwürdiges. Plötzlich konnte man im Radio und Fernsehen Politiker hören, die klagten, daß es in Guadalajara Elendsviertel gebe, und das ärmste von allen sei Santa Cecilia. Das stimmte aber gar nicht, denn in der Zwischenzeit war die Situation in Santa Cecilia etwas besser als in anderen Slums. Trotzdem beschloß die Stadtverwaltung -
„Die beiden Jesuiten bewohnten ein winziges Häuschen mit zwei mal sechs Metern Grundfläche“
als Zuckerl offenbar-, die erste Linie der zu bauenden Metro (ein unterirdisch fahrender Elektrobus) nach Santa Cecilia hinaus zu bauen, denn immerhin liegt dieses über zehn Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Auch eine neue elektrische Leitung wurde gebaut. So konnte jedermann sehen, was das Rathaus für die Ärmsten der Armen tut!
In den Jahren seit dem Beginn der Sozialarbeit in Santa Cecilia ist aber auch aus eigener Kraft schon einiges
erreicht worden. Die ökonomische Situation hat sich zwar nicht drastisch, aber doch merklich verbessert: Billiges Baumaterial und Beratung ermöglichten, daß heute fast alle der nunmehr 40.000 Bewohner in gemauerten Häusern leben. Das Familienleben hat sich wenigstens ein bißchen konsolidiert und man geht nun sogar zu weiteren Gemeinschaftsaktionen über: In allen Straßen werden Obstbäume gepflanzt, in den Höfen Gemüse. Die versprochene Wasserleitung gibt es allerdings noch immer nicht.
Man darf nicht übersehen, daß ein Teil des Erfolges nur durch eine kräftige Hilfe des Rathauses möglich war,
„In allen Straßen werden Obstbäume gepflanzt, in den Höfen Gemüse“
das schließlich sogar Rechtsanwälte und Bauingenieure als Beräter bezahlte. Insoferne ist es fraglich, wie weit das Modell Santa Cecilia wirklich nachvollziehbar ist. Da es sich nur um ein einzelnes Elendsviertel handelte, wich das Rathaus nach j ah-relangem Kampf schließlich dem Druck der Bürger. In anderen Städten Mexikos hatten ähnliche Auseinandersetzungen oft schon zu gewaltsamer Unterdrückung mit Einkerkerung, Folterung und Ermordung von „Aufrührern“ - darunter drei Patres-geführt.
Dennoch bereitet sich die Kunde von Santa Cecilia schon in ganz Mexiko aus, und erst vor wenigen Wochen fand in Santa Cecilia ein gesamtmexikanisches Treffen von Vertretern von 2000 christlichen Basisgruppen statt. Die Bewohner Santa Cecilias nahmen die Heerschar der Gäste in ihren Häusern auf, und teilten das Wenige, das sie hatten, mit ihnen.
So groß die Hoffnungen sein mögen, daß diese neue Bewegung tatsächlich das Elend in Lateinamerika lindern kann, so groß ist auch die Gefahr, daß eine derartige Massenbewegung in ein falsches Fahrwasser gerät, nämlich in das gewaltsamer Auseinandersetzungen. Auch Santa Cecilia stand einige Zeit im Verdacht, Sitz einer Guerillaorganisation zu sein, denn vielen Leuten ist das hier Erreichte noch lange nicht genug.