
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Soziale Wende in den USA
Die Inauguration von William (Bill) Clinton als 42. Präsident der Vereinigten Staaten auf den Stufen des Kapitels in Washington könnte sich zur historischen Zeitenwende für Amerika verdichten. Vorausgesetzt es gelingt ihm, mit seiner Vision vom „New Convenant” (dem neuen Bund) soziale Lebensgeister in den Amerikanern zu wecken, wie sie seit den Tagen von John F. Kennedy und Lyndon B. Johnson in den USA unbekannt gewesen sind.
Die Inauguration von William (Bill) Clinton als 42. Präsident der Vereinigten Staaten auf den Stufen des Kapitels in Washington könnte sich zur historischen Zeitenwende für Amerika verdichten. Vorausgesetzt es gelingt ihm, mit seiner Vision vom „New Convenant” (dem neuen Bund) soziale Lebensgeister in den Amerikanern zu wecken, wie sie seit den Tagen von John F. Kennedy und Lyndon B. Johnson in den USA unbekannt gewesen sind.
Den USA sei diese Zeitenwende und neue Vision einer „good society” gegönnt: Das ewig alte amerikanische Problem der Rassenungleichheit wurde zwar mit der Bürgerrechtsgesetzgebung der sechziger Jahre deutlich entschärft, geblieben ist jedoch die enorme soziale Ungleichheit im wirtschaftlich reichsten Land der Welt. Und die USA erleiden augenfälliger als andere westliche Industriestaaten eine komplexe Erosion traditioneller gesellschaftlicher Institutionen, mit all den damit verbundenen bitteren Konsequenzen. „Nichts funktioniert mehr richtig”, beschreibt der führende Soziologe Amitai Etzioni die amerikanische Wirklichkeit. „Es besteht ein Vakuum an Verpflichtung und Verantwortung. Von Gewalt zu Drogen, hin zu Kriminalität und inter-ethnischen Beziehungen, alles zerfällt. Genauso wie'die Brücken und Eisenbahnen und Straßen. Wir brauchen daher eine neue moralische Infrastruktur.”
Lyndon B. Johnson war von 1963 bis 1968 der letzte US-Präsident, der mit seinem Programm von der „Great Society” den politischen Anspruch erhoben hat, Rassismus, Armut und soziale Benachteiligung als politische Schande zu empfinden, die mit allen Mitteln der Staatskunst bekämpft werden müsse. Johnson, nach Franklin D. Roosevelt der wichtigste amerikanische Sozialreformer in diesem Jahrhundert, ist jedoch an seinen für Hunderttausende amerikanische Soldaten tödlichen Fehlern im Vietnamkrieg gescheitert; und sein ehrgeiziges Sozialprogramm ist mit dem politischen Machtwechsel 1968 auf halbem Weg steckengeblieben. Die sechziger Jahre waren für die USA die letzte Ära mit sozialpolitischem Reformeifer; sie waren aber gleichzeitig Jahre der tiefen politischen Irritation. Der Zyklus von Rassenunruhen und die Ermordung der großen Hoffnungsbringer, wie John F. Kennedy und Martin Luther King Jr., legten einen lähmenden Schatten über das Land. Robert Kennedy weckte in seinem Präsidentschaftswahlkampf 1968 das letzte Mal Hoffnung auf politische und soziale Gesundung. Roger Wilkins, Veteran der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, will in der Ermordung Robert Kennedys das tragische Ende dieser Ära der Sozialreform in den USA erkennen.
Locke'scher Individualismus
Richard Nixon wurde, trotz seiner Intelligenz und erfolgreichen außenpolitischen Programmatik, im Watergate-Skandal letztlich als Gauner am Präsidentenstuhl entlarvt. Und der geringe Erfolg der Sozialgesetzgebung von Johnson im Kampf gegen Armut und soziale Ungleichheit ließ Nixons nüchterne Pragmatik zur Staatsräson werden: Er erklärte den Staat für das Leid und die Not in der Gesellschaft für unzuständig, und beschränkte sich auf Stückwerk, ohne jemals weitreichende sozialpolitische Ziele zu formulieren.
Jimmy Carters Mission lag in der Versöhnung Amerikas mit sich selber. Und Ronald Reagan und sein Epigone George Bush redeten in den letzten zwölf Jahren weniger von sozialer Gerechtigkeit als vom finanziellen Glück des einzelnen: Niemals zuvor in der Geschichte der USA sind die sozialen Unterschiede zwischen den wenigen Superreichen und dem Rest der Bevölkerung in allen Lebensbereichen derart groß geworden. Mehr noch: 1992 waren die untersten 20 Prozent in der Einkommenspyramide - in inflationsbe-reinigten Dollarzahlen ausgedrückt - ärmer als 1977. Und niemals zuvor, meint der Soziologe Robert Bellah, wurde zu Lasten der Mehrheit der Bürger die Ideologie des Locke'schen Individualismus bestimmender als in der Reagan-Bush-Ära. Allein der Begriff „soziale Gerechtigkeit” wurde im Weißen Haus mit großer Rhetorik als „sozialismusverdächtiger” Eingriff in das Wohl der Reichen abgetan.
Bill Clinton ist im Vergleich zu Ronald Reagan und George Bush geradezu ein Sozialrevolutionär. Nur unterscheidet ihn von seinen demokratischen Vorgängern und Kollegen im Kongreß die Einsicht, daß Sozialreform in einem marktwirtschaftlichen System nicht zu Lasten der Wirtschaft, sondern nur in Partnerschaft mit allen sozialen Gruppen und Interessen möglich ist. Sein „Wirtschaftsgipfel” im Dezember hat selbst für alteingesessene Beobachter das eindrucksvolle Aha-Erlebnis gebracht, daß Industrielle und Arbeitnehmer gemeinsam konstruktiv über das Gemeinwohl „aller” Amerikaner, sprechen können.
Clinton ist ein Mann des Intellekts: Er ist, im Unterschied zum letzten demokratischen Präsidenten Jimmy Carter, kein Prediger der politischen Reform, sondern versucht, den USA die schwierige Lage des Landes durch Bildung und Überzeugung begreiflich zu machen. Mit der Methode Dialog und Begegnung ist er geradezu prädestiniert, die Machtpolitiker im Kongreß und die divergierenden Interessen der heterogenen US-Gesellschaft auf seine Seite zu ziehen.
Nur: Seit über zwanzig Jahren hat es in der Ausgestaltung des amerikanischen Sozialstaates keine wirklich neuen Reformansätze gegeben, außer Reagans Überzeugung, den Staat aus möglichst vielen sozialen Fragen herauszuhalten. Die Liste der zu lösenden Probleme ist daher lang und schwierig: Krankenversicherung, Bildungsreform, Lehrlings- und Facharbeiterausbildung, Karenz- und Pflegeurlaub sind mit Wirtschaftswachstum, Erweiterung der Infrastruktur und Budgetreform unter einen Hut zu bringen.
Das Faszinierende an Bill Clinton liegt aber in der Tatsache, daß am 20. Jänner erstmals seit Lyndon B. Johnson ein Politiker am Schreibtisch des Weißen Hauses Platz nehmen wird, der berechtigte Hoffnung auf eine erfolgreiche Sozialreform in den USA weckt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!






















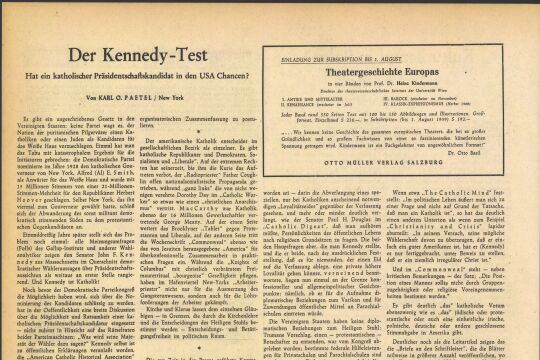














.jpg)




























































