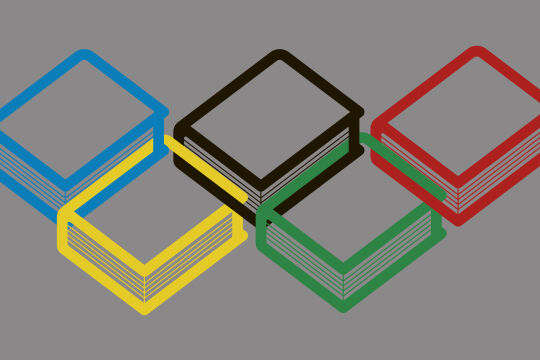Sport und Politik: Trennung gab es nie
Athen, 1896: Die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit. Im Marathonlauf beschert der 25jährige Briefträger Spiridon Luis den Griechen den erhofften Sieg. Für die Veranstalter ist es mehr als ein Sporttriumph. Es ist der „Beweis, daß im neugriechischen Stamm noch das gesunde und starke Blut fließt, das einst Griechenlands Größe und Unsterblichkeit geschaffen hat","sagt König Georg I., als er die Medaillen überreicht. Sport und Politik sind nicht erst seit Jimmy Carter miteinander verknüpft.
Athen, 1896: Die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit. Im Marathonlauf beschert der 25jährige Briefträger Spiridon Luis den Griechen den erhofften Sieg. Für die Veranstalter ist es mehr als ein Sporttriumph. Es ist der „Beweis, daß im neugriechischen Stamm noch das gesunde und starke Blut fließt, das einst Griechenlands Größe und Unsterblichkeit geschaffen hat","sagt König Georg I., als er die Medaillen überreicht. Sport und Politik sind nicht erst seit Jimmy Carter miteinander verknüpft.
Sport und Politik: Mexiko, 1968. Bei der Siegerehrung für den 200-rA-Lauf grüßen die US-Neger Tommy Smith und John Carlos die Zuschauer im Stadion und Millionen an den Fernsehgeräten mit der geballten Faust im schwarzen Handschuh: dem Black-Power-Zeichen. Das Olympische Komitee sperrt Smith und Carlos auf Lebenszeit- und auch Vincent Matthews und Wayne Colett, die vier Jahre später eine ähnliche Demonstration versuchen, während die amerikanische Fahne und Hymne die Siegeszeremonie zieren. Begründung des Ausschlusses: Die Athleten hatten die Olympischen Spiele für politische Zwecke mißbraucht.
Doch es waren nicht die Sportler, die die Politik nach Olympia brachten. 1916 hätte Berlin die Spiele haben sollen. Die Jugend Europas hatte andere Sorgen als den sportlichen Wettkampf. Als die Olympischen Spiele 1920 in Antwerpen wiedererweckt worden waren, fehlten die Kriegsverlierer. Deutschland, Österreich, Ungarn, Bulgarien und die Türkei waren nicht würdig, sich mit den anderen zu messen. Die olympische Idee vom friedlichen Wettstreit aller war schon vor 60 Jahren tot.
Deutschland kam zurück, Berlin kam zurück: 1936 mit den ersten „Gigant-Spielen", die all das noch übertreffen sollten, was Los Angeles vier Jahre zuvor geboten hatte. Berlin diente einer Idee: die Welt von der Kraft und Überlegenheit des Nationalsozialismus zu überzeugen. Das IOC, das Internationale Olympische Comitee, sprach heuchlerisch davon, daß Sport mit Politik nichts zu tun habe und duldete die NS-Propagan-da.
Die amerikanische Regierung wollte schon damals einen Boykott der Spiele, aber der nationale Sportverband setzte sich darüber hinweg. Adolf Hitler verließ vorzeitig die Ehrentribüne, um dem großartigen US-Neger Jesse Owens nicht gratulieren zu müssen. „Hoffentlich gibt es darauf eine Antwort in vier Jahren",
sagte der schwedische Radioreporter Sven Jerring in seiner Übertragung. Doch am Ende der nächsten Olympiade sprachen wieder die Waffen.
Nach dem Krieg standen die Olympischen Spiele nochmals auf: 1948 in London. Die olympischen Bosse, die sich zwölf Jahre zuvor unter Hakenkreuzfahnen im Berliner Olympiastadion im Beifall der Menge gesonnt hatten, verweigerten diesmal Deutschland die Teilnahmegenehmigung. Außerdem auch den Ja-
panern. Die Russen blieben freiwillig weg. Sie machten ihr olympisches Entre erst 1952, als sie sich sicher fühlten, einen Löwenanteil aller Medaillen gewinnen zu können. Der Gedanke vom „Dabeisein", das am wichtigsten sein sollte, hatte längst keine Gültigkeit mehr.
Wenn Jimmy Carter den Boykott der Moskau-Spiele durchsetzt, dann wird es im Sommer eine Rumpfolympiade in Moskau und danach nichts Olympisches mehr geben. Zu weit haben sich die Spiele von der ursprünglichen Idee des friedlichen Kräftemessens entfernt.
Ohne die USA, ohne Großbritannien, Kanada und Australien, ohne die
eil ?S .iVS. lab xk t ab iaaifiA sti islamischen Länder und einen Teil Westeuropas reduziert sich der sportliche Wert der Moskauer Spiele stark und ihr propagandistischer Wert völlig. Sowjetische Siege über Vietnam und Kuba freuen nicht halb so viel wie Erfolge gegen die USA und die Bundesrepublik Deutschland.
Folgt das IOC seinen Regeln, dann , müßte es die USA für ihren rein politisch begründeten Boykott mit dem Ausschluß bestrafen. Die Spiele von 1984 aber sind an Los Angeles vergeben. Selbst wenn das IOC sie erlaubt: Nicht einmal Jimmy Carter kann sich wohl vorstellen, daß der Ostblock nach Los Angeles kommt, nachdem der Westen Moskau die kalte Schulter gezeigt hat.
Aber kann man Olympische Spiele in einem Land abhalten, dessen Soldaten in einen Nachbarstaat einmarschiert sind?
Wenn man die Olympischen Spiele als Sportwettkämpfe sieht, dann schon. Was kann Nikolaj Adrianov, was Andrej Krylow und was Tatjana Kazankina für die Invasion in Afghanistan?
Sieht man die Spiele als Prestigeangelegenheit, dann wohl nicht. Wobei immer noch die Frage bleibt, ob Tod und Leid in Afghanistan in irgendeiner Relation stehen zu der Tatsache, daß nun in Moskau und auf den Fernsehschirmen in aller Welt keine Sportler laufen, schwimmen und boxen werden.
Wer für einen Boykott der Moskauer Spiele ist, der konstatiert damit, daß er den Sport als Mittel der Weltpolitik sieht. Das ist sicherlich eine berechtigte Auffassung. Sportlicher Erfolg wird bewußt zur Hebung des nationalen Selbstgefühls eingesetzt. Sportlicher Mißerfolg kann bis
zum Krieg führen, wie 1969 zwischen Honduras und El Salvador im Anschluß an zwei Fußballspiele um die WM-Qualifikation.
Sport und Politik: Daß etwa die DDR in ihrem Bestreben, eine Großmacht des Sports zu werden und auf diesem Weg ihren Bürgern zu zeigen, daß sie keine Minderwertigkeitsgefühle gegenüber dem Westen zu haben brauchen, so weit geht, Kinder mit Hormon- und Dopingkuren zu Sportstars zu züchten, ahnten Experten seit langem. Bestätigt hat es die Weltrekordschwimmerin Renate Vogel, nachdem sie in den Westen geflüchtet war.
Sport und Politik: Als die chinesische Führung die Annäherung an Washington suchte, benützte sie ein amerikanisches Tischtennisteam, um erste Kontakte zu knüpfen. Der Ausdruck „Ping-Pong-Diplomatie" wird noch lange an den Stellenwert des Sports in der Politik erinnern.
Sport und Politik: Während der Westen sich organisiert bemüht, eine Trennung zu ziehen, bekennt sich der Osten offen zum staatsgelenkten Sport. Das hat jahrelang die Lüge vom „sozialistischen Staatsamateur" leben lassen, der im Staatsdienst arbeitete, für den Sport freigestellt war und als Amateur profihaft trainieren und leben konnte.
Die USA stellten diesem Modell ihre Sportcolleges entgegen, deren Absolventen ebensowenig gewöhnlichen Studenten gleichen wie die sowjetischen Staatsdiener normalen Beamten. Neue Regeln für das Amateurstatut haben diese Heuchelei gemildert- abjr sie haben die Olympischen Spiele auch einen weiteren Schritt von ihrer ursprünglichen Idee entfernt. <>"rw/\rn..
Ob kommerziell oder staatlich unterstützt - Spitzensportler sind heutzutage Professionals des Showbusineß. Und staatliche Gelder für den Sport gibt's nicht nur im Osten. Auch in Österreich zahlt das Unterrichtsministerium für Skimedaillen Millionen.
Sport und Politik: Mit dem Erwachen der Länder der Dritten Welt drangen Probleme der Tagespolitik stärker als je zuvor in den Sport ein. Zum Beispiel im südlichen Afrika. Fand der Ausschluß Südafrikas aus der Olympischen Bewegung noch Deckung in den olympischen Gesetzen, die rassische Diskrimination im Sport verbieten, während Südafrika seine Sportler in Schwarze und Weiße trennte, so war der Ausschluß Rhodesiens vor den Spielen 1972 eine Kapitulation: Rhodesien war ohnehin mit einer gemischt-rassigen Mannschaft angereist. Sie wurde eliminiert, weil den anderen Afrikanern die Politik nicht paßte, die Sa-lisbury führte.
„Entweder wir oder Rhodesien", erpreßten die Afrikaner das Olympische Komitee. Das IOC dachte an die großen afrikanischen Läufer, deren Teilnahme gefährdet war, und wurde weich. Rhodesien mußte nach Hause fahren. Die Politik hatte einen entscheidenden Sieg über den Sport gewonnen.
Vier Jahre später blieb das IOC hart, als Afrikas Staaten den Ausschluß Neuseelands forderten, weil Neuseeland Sportverkehr mit Südafrika unterhielt. 28 Teams fuhren aus Protest wieder nach Hause. Wer in Montreal Filbert Bayi sah, den
1500-m-Weltrekordler aus Tansania, wie er weinend das olympische Dorf verließ, der weiß, daß bei Olympia die Sportler nichts mehr und die Politiker längst schon alles zu bestimmen haben.
Ausschluß Israels von den Asien-Spielen. Ausschreitungen gegen Ägypten bei den Africa-Games nach dem Friedensschluß mit Israel. Das Ende der gesamtdeutschen Mannschaft nach den Spielen von 1964. Taiwans Eliminierung aus einem Sportverband nach dem anderen, um Platz für China zu schaffen ...
Die Politik hat den Sport vergewaltigt.
Sind die Olympischen Spiele noch zu retten? Steht es sich überhaupt dafür, sie zu retten? Nun, immerhin ha-
ben sie doch alle vier Jahre Hunderte, Tausende junge Menschen aus allen Teilen der Welt zusammengebracht. Trotz allem war für viele von ihnen der friedliche Wettkampf das wichtigste. Trotz allem haben sie Freundschaften geschlossen, Meinungen ausgetauscht, Verständnis füreinander gefunden.
Die, die heute dabei sind, die Olympischen Spiele umzubringen, sollen erst einmal etwas Besseres finden. Was die Spiele bedeutet haben, an Positivem, trotz allem, das wird man wohl erst abschätzen können, wenn es sie nicht mehr gibt. Vielleicht schon im unheimlichen Jahr 1984.
Eine permanente Verlegung an ei-
nen bestimmten Ort - um Großmannssucht und Prestigedenken einzuschränken - könnte die Olympischen Spiele vielleicht retten. Athen böte sich an. Freilich haben dort erst vor wenigen Jahren Obri-sjen geputscht. München wollte es 1972 mit „fröhlichen Spielen" versuchen. Die Kugeln der palästinensischen Terroristen rissen die Veranstalter brutal in die Wirklichkeit zurück.
Der einzige gangbare Weg, Politik und Sport zu entflechten, wäre wohl ein Wettkampf von Menschen, nicht von Staaten. Von Sportlern, nicht von Systemen. Konkret: daß die besten aller Sportarten - und gerne auch ein paar weniger gute als Franz Klammer, als Marlies Göhr, als Marius Yifter und Alberto Juantorena -antreten könnten: nicht als Vertreter Österreichs, der DDR, Äthiopiens oder Kubas. Ohne Nationalhymnen. Ohne Fahnen.
Die Sucht, mit Sporterfolgen nationales Prestige gewinnen zu wollen, wird das verhindern. Die jungen Staaten aus der Dritten Welt haben sich auch bisher Versuchen widersetzt, die Siegesfeiern zu entstauben. Sie wollen sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, ihre Flagge aller Welt zu zeigen. Und man muß das akzeptieren. Lange genug hat die „Alte Welt" Gleiches getan.
Und außerdem: Nicht einmal das Olympische Komitee selbst ist zum Neudenken bereit. Als sich 1976 auch Guyana dem Boykott der Afrikaner anschloß, bat der schwarze Sprinter James Gilkes das IOC, unter dessen Patronanz starten zu dürfen - nicht als Vertreter seines Landes, sondern als Herr Gilkes, der seine Chance wahren wollte, weil er wußte, daß er ebenso schnell laufen konnte wie all die anderen, die sich dem Wettkampf stellten.
Das IOC wies James Gilkes ab und schickte ihn nach Hause.