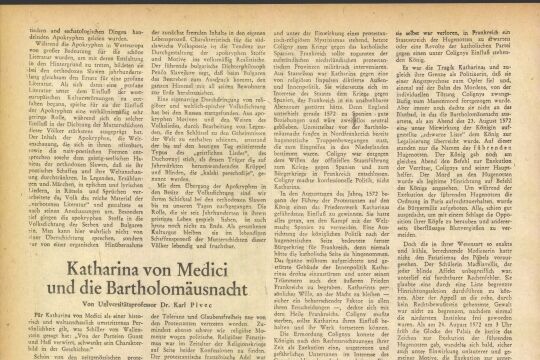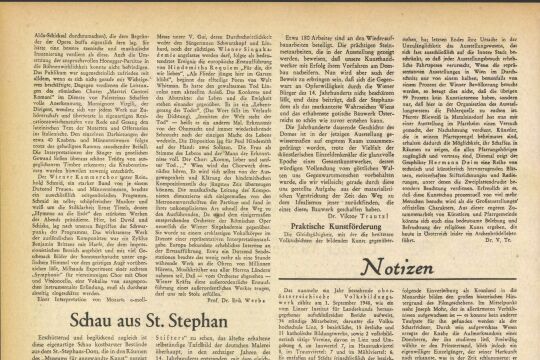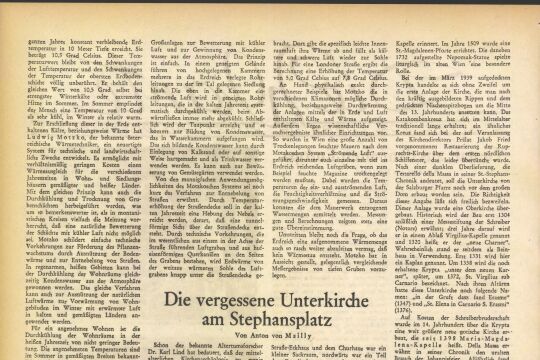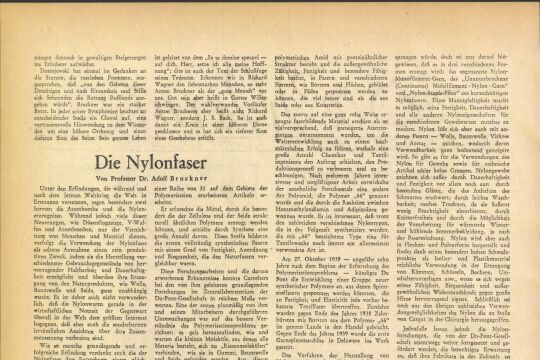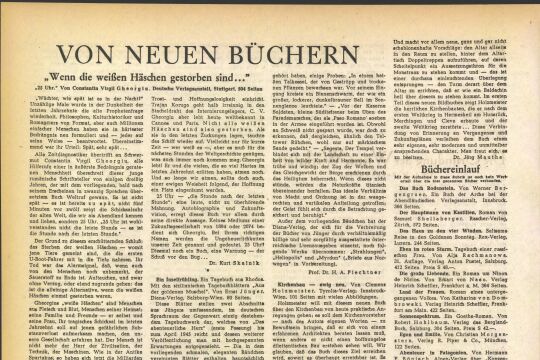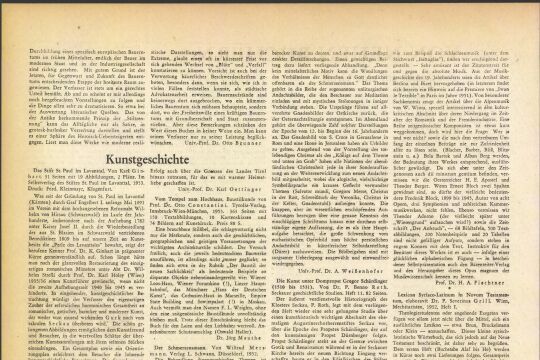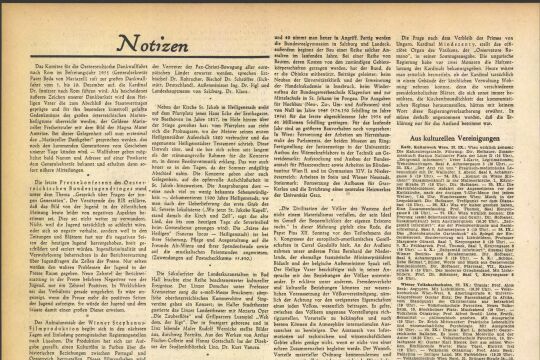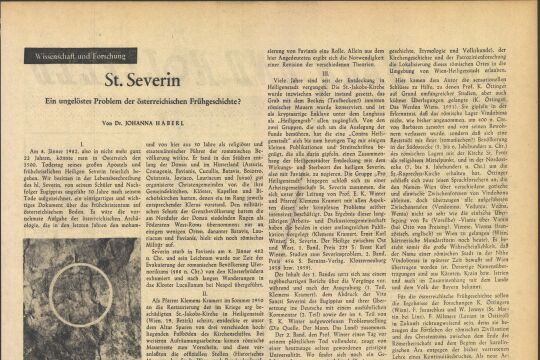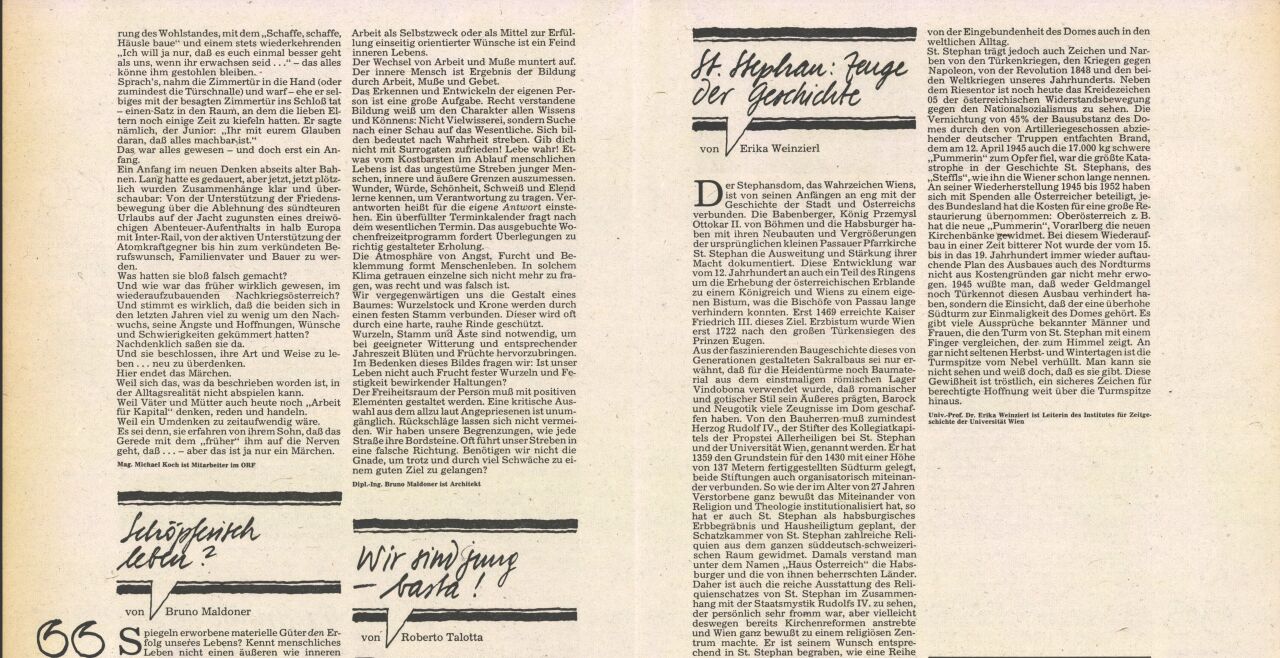
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
St Hephau: Zeuge der geschichte
Der Stephansdom, das Wahrzeichen Wiens, ist von seinen Anfängen an eng mit der Geschichte der Stadt und Österreichs verbunden. Die Babenberger, König Przemysl Ottokar II. von Böhmen und die Habsburger haben mit ihren Neubauten und Vergrößerungen der ursprünglichen kleinen Passauer Pfarrkirche St. Stephan die Ausweitung und Stärkung ihrer Macht dokumentiert. Diese Entwicklung war vom 12. Jahrhundert an auch ein Teil des Ringens um die Erhebung der österreichischen Erblande zu einem Königreich und Wiens zu einem eigenen Bistum, was die Bischöfe von Passau lange verhindern konnten. Erst 1469 erreichte Kaiser Friedrich III. dieses Ziel. Erzbistum wurde Wien erst 1722 nach den großen Türkensiegen des Prinzen Eugen.
Aus der faszinierenden Baugeschichte dieses von Generationen gestalteten Sakralbaus sei nur erwähnt, daß für die Heidentürme noch Baumaterial aus dem einstmaligen römischen Lager Vindobona verwendet wurde, daß romanischer und gotischer Stil sein Äußeres prägten, Barock und Neugotik viele Zeugnisse im Dom geschaffen haben. Von den Bauherren muß zumindest Herzog Rudolf IV., der Stifter des Kollegiatkapi- tels der Propstei Allerheiligen bei St. Stephan und der Universität Wien, genannt werden. Er hat 1359 den Grundstein für den 1430 mit einer Höhe von 137 Metern fertiggestellten Südturm gelegt, beide Stiftungen auch organisatorisch miteinander verbunden. So wie der im Alter von 27 Jahren Verstorbene ganz bewußt das Miteinander von Religion und Theologie institutionalisiert hat, so hat er auch St. Stephan als habsburgisches Erbbegräbnis und Hausheiligtum geplant, der Schatzkammer von St. Stephan zahlreiche Reliquien aus dem ganzen süddeutsch-schweizerischen Raum gewidmet. Damals verstand man unter dem Namen „Haus Österreich“ die Habsburger und die von ihnen beherrschten Länder. Daher ist auch die reiche Ausstattung des Reliquienschatzes von St. Stephan im Zusammenhang mit der Staatsmystik Rudolfs IV. zu sehen, der persönlich sehr fromm war, aber vielleicht deswegen bereits Kirchenreformen anstrebte und Wien ganz bewußt zu einem religiösen Zentrum machte. Er ist seinem Wunsch entsprechend in St. Stephan begraben, wie eine Reihe anderer habsburgischer Herrscher, der bedeutendste deutsche Humanist Celtis, der große Architekt Fischer von Erlach und Prinz Eugen.
Alle Nachfolger Rudolfs IV. haben das Staatsheiligtum St. Stephan weiter ausgestaltet. Viele Bilder und Kruzifixe sind mit frommen Legenden verbunden. Der Dom ist dadurch auch ein Monument der habsburgischen Pietas Austriaca mit ihrer bis in unser Jahrhundert reichenden besonders intensiven Eucharistie-, Kreuz-, Marien- und Heiligenverehrung.
Der Glaube des Volkes ist besonders nach der Gegenreformation im 17. Jahrhundert von dieser Frömmigkeit geprägt worden. Er hatte aber in St. Stephan auch seine eigenen Heiligen, wie z. B. den „Zahnwehherrgott“ und die „Dienstbotenmuttergottes“. Asylring, Richtmaße für Brotlaibe und Stoffellen an den Außenmauern zeugen von der Eingebundenheit des Domes auch in den weltlichen Alltag.
St. Stephan trägt jedoch auch Zeichen und Narben von den Türkenkriegen, den Kriegen gegen Napoleon, von der Revolution 1848 und den beiden Weltkriegen unseres Jahrhunderts. Neben dem Riesentor ist noch heute das Kreidezeichen 05 der österreichischen Widerstandsbewegung gegen den Nationalsozialismus zu sehen. Die Vernichtung von 45% der Bausubstanz des Domes durch den von Artilleriegeschossen abziehender deutscher Truppen entfachten Brand, dem am 12. April 1945 auch die 17.000 kg schwere „Pummerin“ zum Opfer fiel, war die größte Katastrophe in der Geschichte St. Stephans, des „Steffls“, wie ihn die Wiener schon lange nennen. An seiner Wiederherstellung 1945 bis 1952 haben sich mit Spenden alle Österreicher beteiligt, jedes Bundesland hat die Kosten für eine große Restaurierung übernommen: Öberösterreich z. B. hat die neue „Pummerin“, Vorarlberg die neuen Kirchenbänke gewidmet. Bei diesem Wiederaufbau in einer Zeit bitterer Not wurde der vom 15. bis in das 19. Jahrhundert immer wieder auftauchende Plan des Ausbaues auch des Nordturms nicht aus Kostengründen gar nicht mehr erwogen. 1945 wüßte man, daß weder Geldmangel noch Türkennot diesen Ausbau verhindert haben, sondern die Einsicht, daß der eine überhohe Südturm zur Einmaligkeit des Domes gehört. Es gibt viele Aussprüche bekannter Männer und Frauen, die den Turm von St. Stephan mit einem Finger vergleichen, der zum Himmel zeigt. An gar nicht seltenen Herbst- und Wintertagen ist die Turmspitze vom Nebel verhüllt. Man kann sie nicht sehen und weiß doch, daß es sie gibt. Diese Gewißheit ist tröstlich, ein sicheres Zeichen für berechtigte Hoffnung weit über die Turmspitze hinaus.
Univ.-Prof. Dr. Erika Weinzierl ist Leiterin des Institutes für Zeitgeschichte der Universität Wien
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!