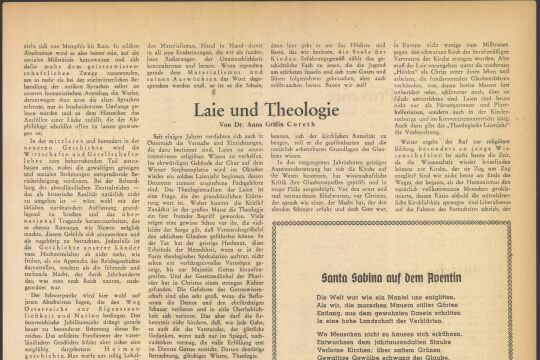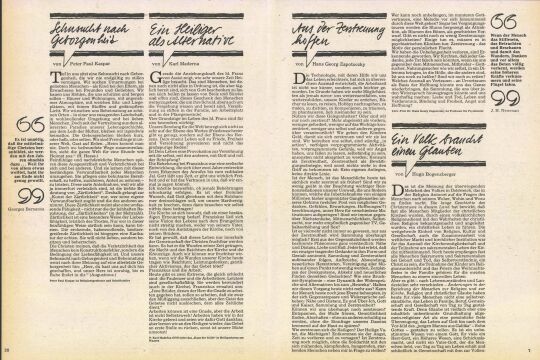Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Suche nach dem Sinn des Lebens ist Suche nach Gott
Die Salzburger Hochschulwochen : sind innerhalb der reichhaltigen Palette künstlerischer und kultureller Veranstaltungen zweifellos die älteste und traditionsreichste. Die rund 1500 Teilnehmer aus vielen Zentren der europäischen und außereuropäi sehen Welt stellen in der Geschichte der 1930 gegründeten Salzburger : Hochschulwochen einen bisher noch nie erreichten Besucherrekord dar. Ganz gewiß hängt die Anziehungskraft der diesjährigen Hochschulwo- chen mit der Wahl des Themas zu- sammen, von dem viele Menschen von heute in einer außerordentlichen Weise betroffen sind. Mag die Frage nach dem Sinn der Welt im allgemeinen und jenem des menschlichen Lebens im besonderen auch noch so oft als unerlaubt, weil logisch sinnlos, abgetan werden, so ändert das nicht das Geringste an der Tatsache, daß sie ge- radein den letzten Jahren immer mehr 1 in den Mittelpunkt des Interesses ins-besondere jüngerer Menschen gerückt ist.
Die deutsche Benektinerin Dr. Corona Bamberg, deren Vorlesungen über „Beiträge frühchristlicher Spiri- tualität zur Sinnfrage” bei den Hörern sehr starken Anklang fanden, versuchte sich über die Gründe und Hin- tergründe dieses erstaunlichen Phänomens Rechenschaft zu geben. Es ist symptomatisch, daß die Hauptrichtung der Sinnfrage in die Zukunft geht. Anders als in der frühchristli chen Zeit stellt man heute die typische, Frage „was hat das für eine Aus- sicht?”, „habe ich noch Aussicht zu überleben?”, „hat die Menschheit. Aussicht zu überleben?”. Es besteht eine allgemeine und sehr reale Sicht- und Orientierungslosigkeit, in der der Mensch heute leben muß. Die Frage nach der Bejahbarkeit des Daseins i und nach dem Sichlohnen des Lebens ist durchaus legitim. Nur sieht Dr. Bamberg darin ein Mangelsignal, ein Hungerödeih, eine allgemeine Krankheit, die die Menschheit befallen hat.
Eugen Biser, der Nachfolger Romano Guardinis an der Universität München, geht noch einen Schritt weiter und sucht die derzeit aufkommertde Sinneuphorie dadurch zu dämpfen, daß er sie in ein dialektisches Verhältnis zur pathologischen Depressivität setzt, von der heute die Gesellschaft weitestgehend befallen sei.
Einen Höhepunkt der ersten Woche stellte die dreistündige Vorlesungsreihe des Freiburger Philosophen Prof. Dr. Max Müller dar. Er gab einen sehr anspruchsvollen und streckenweise recht schwierigen Aufriß der geistes- und philosophiegeschichtlichen Hintergründe der Sinnfrage und kam schließlich auf den Tod zu sprechen, in dem heute viele Menschen die absolute Verneinung jeglichen Sinns sehen. Demgegenüber betone Prof. Müller, daß es ohne Tod überhaupt keinen Sinn gäbe - um das einzusehen, müsse man sich nur einmal einen Moment lang die Fiktion einer „todlosen Welt” vergegenwärtigen, in der nichts wirklich entschieden und alles ad infinitum verschoben wird. Paradoxerweise müsse man sagen, daß es der Tod ist, der uns zu unserem Glück zwingt Der Tod gibt aber nicht nur Sinn, er nimmt Sinn auch und darin liegt seine tiefe Ambiguität. Auf dem Hintergrund der prinzipiellen Unvollendbarkeit offenbare sich daher die Angst als die eigentlichste und tiefste Erfahrung. Den absoluten Sinn, dessen man momenthaft inne wird, kann man nicht behalten: weder die vom historischen Christentum zu Unrecht abgewertete Sphäre des reinen Genusses noch die des Glücks. „Wer rettet uns aus diesem Zwiespalt?” fragte Prof. Müller. „Nicht die Philosophie, die am Todesphänomen notwendig scheitert, noch irgendeine Weltanschauung, sondern einzig und allein der Glaube an das uns von Gott zugesagte Heil.”
Den bis jetzt nachhaltigsten Eindruck hinterließ aber der Freiburger Fundamentaltheologe und Rahner- Schüler Prof. Dr. Karl Lehmann mit seiner nicht nur theologisch, sondern auch religionssoziologisch äußerst interessanten Vorlesungsreihe über das Thema „Der Sinn christlicher Existenz im Spannungsfeld von Enthusiasmus und Institution”. Lehmann ging davon aus, daß im Zuge der in den letzten Jahren beobachtbaren Wiederentdeckung des Religiösen viele Menschen in ihrer Suche nach unmittelbaren religiösen Erfahrungen zu ihrer angestammten Kirche immer mehr in Distanz geraten. Im schroffen Dualismus werde oft der lebendige Geist zu der „geist- und lebenstötenden Institution Kirche” in einen unversöhnlichen Gegensatz gebracht. Genau darin sieht aber Lehmahn eine falsche Alternative. Denn im Grunde läßt sich die Wirklichkeit der Kirche nicht mit einem eindimensionalen Begriff von Institu- tionalität beschreiben. Es ist überhaupt theologisch unmöglich, Geist und institutioneile Erscheinung in der Kirche völlig voneinander zu trennen. Wenn heute „Amtskirche” oder „empirische katholische Kirche” als Gegenpol zu „Geist” erscheine, so sei das in dieser Zuspitzung eine sehr moderne Kategorie. Dahinter stehe auch die oft wenig artikulierte Grundüberzeugung, der Geist manifestiere sich nur im Augenblick, im Diskontinuierlichen, in eruptiven Explosionen und in spontanen Gruppen.
Angesichts des Wachsens einer außerkirchlichen Religiosität und einer nur partiellen Identifikation von Kirchenmitgliedern mit der Kirche, muß die Theologie in Theorie und Praxis sich mehr mit diesem Phänomen beschäftigen. Man muß aber auch den Gefahren des geistlichen Enthusiasmus nüchtern ins Auge sehen. Denn charismatisch-lebendige Kleingruppen können nicht schon alle Aufgaben einer Gemeinde im Vollsinn auf Dauer verwirklichen. Eine solche Gruppe ist erfahrungsgemäß von der Tendenz geprägt, nur von einer spontanen und in ihrer Richtung oft unbestimmten, informellen Selbstorientierung auszugehen. Eine völlig strukturlose Existenzweise der Kirche könnte sich schon aus soziologischen Gründen bei der hohen Organisationsbedürftigkeit und institutionellen Verfaßtheit der gegenwärtigen Gesellschaft auf die Dauer geradezu tödlich auswirken. Hier müsse stets eine Neuvermittlung zwischen Personal, orientierten Formen und einem Modell von Gemeinschaft gesucht werden, die nicht nur die Nestwärme Gleichgesinnter zum Inhalt hat, sondern etwas von der universalen Weite der Liebe Jesu Christi zu den Menschen aller Rassen und Klassen, Schichten und Zielsetzungen widerspiegelt.
Das Christentum sollte sich immer jenes unüberbietbaren, missionarischen Kanons erinnern, den Paulus der Kirche zwischen Ghetto und Konformismus, Enthusiasmus und Institution hinterlassen hat: „Denn als einer, der frei ist allem gegenüber, habe ich mich zum Knecht aller gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. Ich bin den Schwachen ein. Schwacher geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Allen bin ich alles geworden, um nur ja einige zu retten. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, damit ich seiner teilhaftig werde”.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!