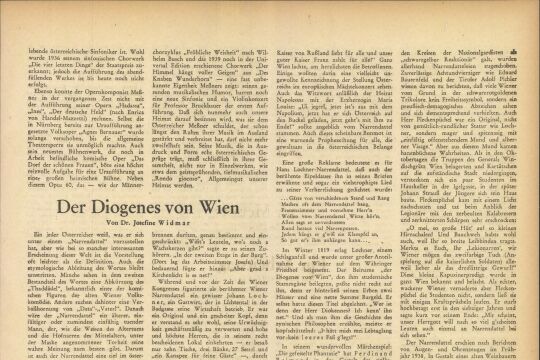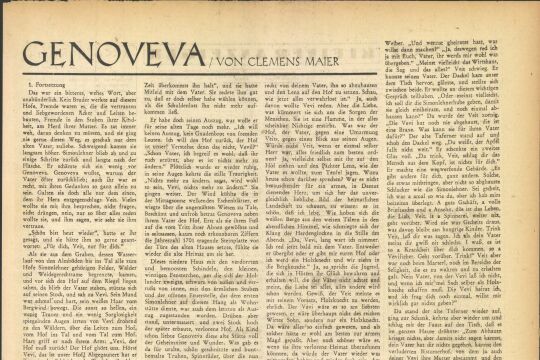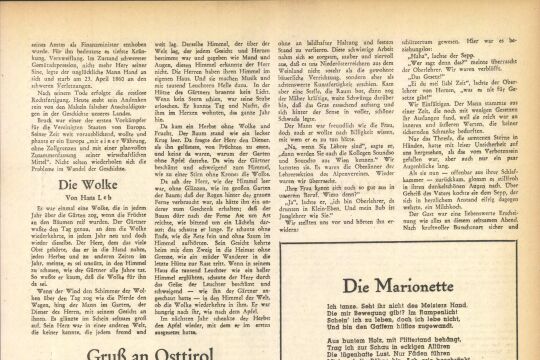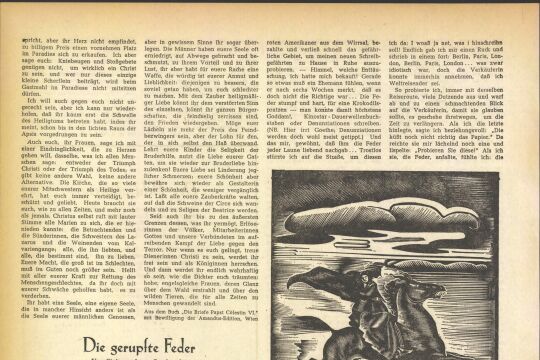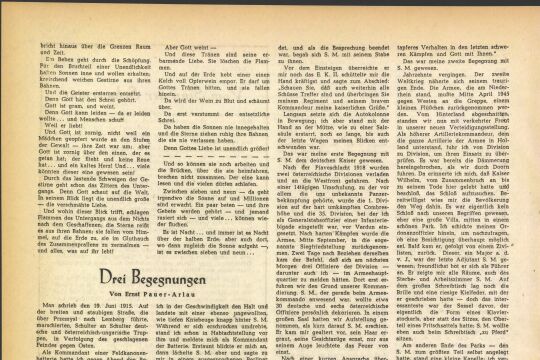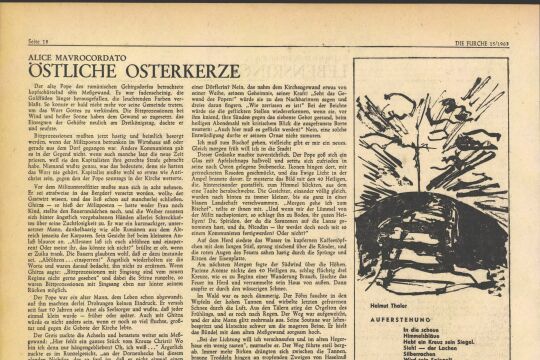Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Szenen aus dem Jahr '38
Langsam schlenderte ich zum Tegetthoff-Denkmal. Es blieb mir mehr als eine Stunde Zeit. Das reichte für eine Stipvisite in den Prater. Es würde zwar noch nicht viel zu sehen geben, denn traditio- nell öffneten die Buden, Ringelspie- le und sonstigen Etablissements offiziell erst am 1. Mai.
Am Anfang der Ausstellungsstra- ße ging es am Zirkus-Busch-Kino vorbei, das in der Stummfilmzeit dadurch berühmt war, daß jede Vorstellung mit einer Ouvertüre, gespielt von Wiener Symphonikern, eingeleitet wurde. Das war in jun- gen Jahren eine Entschädigung für unsere magere Geldbörse gewesen, denn wir konnten uns in diesem teuren Erstaufführungskino nur die billigsten Plätze in den ersten zwei Reihen leisten, waren dafür aber dem großen Orchester ganz nahe.
Als nächstes kam der Fortuna- Palast, wo man sein Glück an ver- schiedenen Apparaten versuchen oder von einem Papagei sein Ho- roskop ziehen lassen konnte. Öster- reichs Glück war nicht darunter gewesen. Vor Preuschers Panopti- kum stand eine lebensgroße Figu- rengruppe, bestehend aus einem Riesengorilla, der eine geraubte Frau mit den Tatzen an sich preßte. Es würde wohl lange dauern, bis Hitlers Wachsfigur hier Einzug hielte. Die Geisterbahn gab mit an ihre Wände gemalten Gespenstern einen Vorgeschmack von Gruseln. Die ist überflüssig geworden, dach- te ich, das Grauen lauerte an allen Ecken und Enden. Das Ringelspiel mit dem Chinesen Calafati in sei- ner Mitte war mit Holzplanken ver- schlossen. Würde der Chinese als rassisch untragbar erklärt werden? Ich lachte bei dieser Vorstellung, denn sie paßte in den Rahmen ras- sischen Irrwitzes. Das Variete Leicht, Sprungbrett für viele Stars von Bühne und Film, schien einge- froren: Verblaßte Farben, ver- morschte Bretter. Welch Welt wür- de sich künftig auf ihnen tummeln?
Beim Kasperltheater verweilte ich einige Minuten. Ich setzte mich auf einen der einfachen, in die Erde eingelassenen Sitze. Es werden auch weiterhin viele Kinder den Kampf des tapferen Kasperls mit dem Krokodil leuchtenden Auges ver- folgen. Allerdings würden die jüdi- schen Kinder fehlen. Der Watschen- mann stand pampig in der Nähe der Rutschbahn Toboggan. Auf die prallen Backen der stämmigen Pup- pe waren schwarze Kruckenkreuze geschmiert. Ich zog mein Taschen- tuch, spuckte hinein und versuch- te, die Zeichen von gestern abzuwi- schen. Es gelang. Dann holte ich mein Taschenmesser heraus, stach mir mit der kleinen Klinge in den Zeigefinger und malte mit meinem Blut Hakenkreuze auf die Wangen des mißbrauchten Tölpels. Das war mein erster Widerstandsakt.
In der Ausstellungsstraße bestieg ich einen B-Wagen, der über die Ringstraße fuhr. Ich wählte den zweiten Beiwagen, der nur für Nichtraucher war, weil ich im Not- fall leicht abspringen konnte.
Beim Carl-Theater stürmten Hitlerjungen in den Waggon, mit Koppel und Dolch bewehrt. Im Nu hatten sie den größten Teil der Sitz- platze beschlagnahmt. Ein hagerer Bursche, etwa 14 Jahre, vermutlich der Scharführer, erhob sich nach kurzer Fahrt, breitete die Arme aus und rief: „Ein Lied. Das Lied vom Führer!" Darauf plärrten alle los:
„Es gibt so viele Menschen, die dich segnen, wenn auch ihr Segen nur ein stummer ist. Es gibt so viele, die dir nie begegnen und denen trotzdem du der Heiland bist. Wenn du zu deinem deutschen Volke re- dest, dann klingen..."
Weiter kamen sie nicht. Ein vier- schrötiger Mann, ein Muskelberg, wohl Kutscher oder Maurer, war aufgesprungen und schrie: „Haubts eich gesdan no ned hasrig gschrian? Nix gengan Fira. Oba wos gnua is, is gnua. Hoids amoi die Pappn!"
Der Anführer ließ sich aber nicht abbringen, fuchtelte weiter mit seinen Armen und begann noch einmal die zweite Strophe:
„Wenn du zu deinem deutschen Volke redest, dann..."
„Gebts a Rua oda steigts aus!" brüllte der große Starke, eilte auf den Dirigierer zu, hob ihn mit bei- den Händen hoch und drückte ihn auf seinen Sitz: „De Tramway is ka Tonhalle, vastaundn!"
Die Burschen schwiegen tatsäch- lich, begannen aber miteinander zu tuscheln. Der Mann ging auf seine Bank zurück. Der Schaffner hatte sich auf die Plattform zurückgezo- gen. Nur das Rumpeln der Räder war zu hören.
Ein alter Jude im Kaftan war zugestiegen. Der Wagen war voll besetzt. Ich blickte herum, die Buben einzeln fixierend. Keiner machte dem Alten Platz. Auch der Riese rührte sich nicht, was ich nach seinem energischen Auftreten ge- gen das Geplärr erhofft hatte. Nach einem flüchtigen Aufschauen zog er eine Zeitimg heraus und ver- steckte sich dahinter.
Beim Cafe Silier, schräg gegen- über der Urania gelegen, hoffte ich, ein Taxi aufzutreiben, denn dort gab es schon immer einen Stand- platz. Das Cafe war vollkommen leer. Nur ein Kellner lehnte ver- drossen beim Podest der Kassierin. Wo kein Fahrgast zu erwarten war, gab es auch kein Taxi. Die Stamm- gäste, die Juden aus der angren- zenden Leopoldstadt, die den be- rühmten besten Kaffee von Wien zu schätzen wußten, wagten sich nicht her oder weilten bereits au- ßer Landes. Wir wären als einzige Gäste aufgefallen. Wir plazierten uns am Straßenrande, um ein sich hierher verirrendes Vehikel durch Handzeichen abzufangen.
Es kamen auch einige ohne In- sassen vorbei, aber keines blieb ste- hen. Augenfällig war, daß nahezu alle über die Aspernbrücke in den zweiten Bezirk fuhren. Als endlich eines anhielt, riß der Chauffeur den Wagenschlag auf und brüllte uns an:
„Judenbagage olendige, wollts eich no bei guatn Wind ausn Staub mochn, wos? Haha, oba net bei mir. I scheiß auf Judengöd. Für jeden Volksgenossen is jetzt da Plötz beim Hotel Imperial. Des is mei Züi. Heil Hitler!" Er spie auf uns und sauste weg.
„Der tausendprozentige Nazitax- ier", grübelte ich, „hat ungewollt etwas Wichtiges preisgegeben. In Panik geratene Juden versuchen wahrscheinlich mit Taxis die tsche- chische Grenze zu erreichen.
Wir gingen langsam in Richtung Schottenring. Keine Menschensee- le begegnete uns. Es beschlich uns ein Gefühl trostloser Verlassenheit und Hilflosigkeit. Alle Geschäfts- lokale waren geschlossen, bei vie- len die Rollbalken herabgelassen. Oft stand darauf mit Kalk ge- schmiert: ,Saujud!' Oder ,Juda verrecke!' Oder ,Kauft nicht bei Juden!'
Das Knirschen und Quietschen eines bremsenden Autos schreckte uns auf. Dicht neben uns hielt ein Taxi. Der Fahrer kurbelte das Fenster herunter, grinste uns an und fragte, wobei er das Jiddeln nachzuahmen versuchte: „Eine lange Fahrt gefällig?"
„Was heißt lange Fahrt?" fragte ich.
„No" blieb er in der gleichen Tonart, „wohin die Herrschaften wollen: Gmünd, Bernhardstal oder Preßburg? Ich mach's billig. Mein Einheitspreis ist 600 Schilling."
„Wir wollen nur nach Florids- dorf", sagte ich kühl.
Der Mann starrte enttäuscht. „Des moch i net", lehnte er ent- schieden ab.
„Unsere kurze Fahrt stört wohl Ihr gutes Geschäft mit der Todes- angst der Juden", entgegnete ich.
Er zuckte zusammen, ließ aber nicht nach: „A so a Hockn hob i in mein Leben no nia ghobt", schwär- mte er. „Seit Saumstog rollts ohne Pause. Und jetzt kumman sö mit ana Bettlfua daher. Loßns mi in Kraut und suachns ihna an aun- dern."
Rasch wollte er das Fenster wie- der heraufkurbeln, ich riß aber die Wagentür auf und griff fest in das Lenkrad: „Sie fahren jetzt mit uns zur Nordwestbahnbrücke, sonst gibt es überhaupt keine Fuhr mehr für Sie. Verstanden!"
Er schaute mich scheu an und stotterte dann: „San sö vielleicht goa a..."
„Erraten!" fiel ich ihm ins Wort.
„Pardon!" bat er, unvermittelt ganz Lakai. „Daß mir des passiern hot kenna. Se schaun jo a goa net jidisch aus. Do is nua des schlechte Liacht schuld. Daß a so spät die Stroßnbeleichtung eischoitn. Bit- te, steigns ei."
Während der Fahrt wurde kein Wort gesprochen. Einige Autos, fast nur Taxis, überholten uns.
Bei der großen Donaukanal- schleuse mit den zwei imposanten Steinlöwen ließ ich halten, und wir steigen aus. Als ich zahlen wollte, lehnte er mit den Worten ab: „Is jo net da Rede wert, Volksgenosse. Woa mir a Vagnügn." Nach einer Pause demütig: „Se wem mi do net auzeign?"
„Ich denke nicht daran", ver- sprach ich, „vielleicht haben Sie einigen in die Freiheit geholfen. Dafür wäre Ihnen sogar zu dan- ken."
„Bestimmt sogoa. Mir is wirkli net nua ums Göd gaunga. I könnts beschwörn. Es woa a großes Risiko dabei. A fir mi."
„Wem haben Sie Ihre Fahrgäste an der Grenze übergeben?" bohrte ich, „Gab es Verbindungsmänner?"
„In etlichn Fällen scho."
„Und in den anderen Fällen?"
Er schwieg eine Weile und sah zu Boden. Dann murmelte er: „Maun- chesmoi san di Verbindungsleut ausbliebn. I hob nua ghert, daß ei- nige ins Wossa gaunga san, de aun- dern haum hoit gwort. Se san kane von de neichn, se vastengan, wos i man?" „Nein, wir sind keine."
„I sog net auf Wiedasehn", ver- abschiedete er sich. Als er in eine Linkskurve bog, winkte er uns leb- haft zu.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!