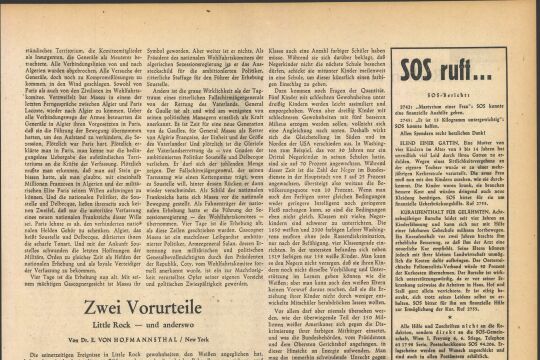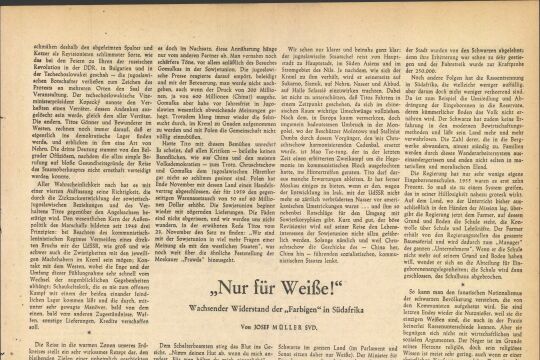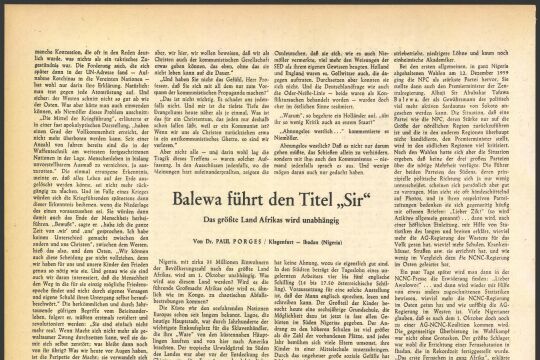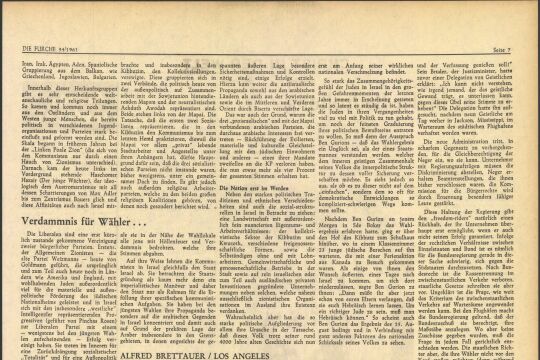Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Tödlicher Haß auf „Gelbe Imperialisten"
58 Tote, 4.000 Verletzte, 12.000 Verhaftete und ein Schaden von einer Milliarde Dollar - das ist die Bilanz des Aufstands von Los Angeles vor zwei Wochen. Los Angeles wurde immer als besonders bekömmliche Mixtur aus Europäern, Koreanern, Chinesen, Japanern, Mexikanern, Indern, Libanesen und anderen gerühmt. Dieses Stilleben wurde zerstört.
58 Tote, 4.000 Verletzte, 12.000 Verhaftete und ein Schaden von einer Milliarde Dollar - das ist die Bilanz des Aufstands von Los Angeles vor zwei Wochen. Los Angeles wurde immer als besonders bekömmliche Mixtur aus Europäern, Koreanern, Chinesen, Japanern, Mexikanern, Indern, Libanesen und anderen gerühmt. Dieses Stilleben wurde zerstört.
Die schrecklichsten Rassenunruhen in der jüngeren Geschichte der Vereinigten Staaten begannen im April als Resultat der Brutalität weißer Polizisten gegenüber einem Schwarzen. Es war das altgewohnte Bild weißer Lynchjustiz. Was man auf dem Bildschirm sah, wirkte wie eine Episode aus der Zeit der Sklavenhalter, beziehungsweise wie eine Szene aus dem Film „Roots" des kürzlich verstorbenen Bestseller-Autors Alex Haley, eines Schwarzamerikaners, der die Leiden seiner Vorfahren in Amerika beschrieb.
Doch der Haß der über den Frei-spruqh der Polizisten aufgebrachten schwarzen Slumbewohner von Los Angeles richtete sich gar nicht primär gegen die privilegierten Weißen. Vielmehr entlud er sich auf den Gelben, den Neuzuwanderern aus Asien. Es waren hauptsächlich deren Geschäfte, die geplündert und in Brand gesetzt wurden. Hauptleidtragende der schwarzen Volkswut waren die Koreaner, die schon seit etwa zehn Jahren Zielscheibe des Aufbegehrens der Afro-Amerikaner sind.
Ende der siebziger Jahre kam es zur Entfaltung des koreanischen Kleinhandels, vornehmlich wegen eines äußerst effektiven Bankwesens - von Koreanern für Koreaner. Ohne die Kredite, die Koreaner zum Eröffnen eines Ladengeschäfts von Banken ihrer amerikanisch-koreanischen Vereinigungen erhalten, wäre der wirtschaftliche Aufstieg dieser relativ jungen Minderheit undenkbar.
Mit anderen Worten, die Koreaner haben genau das entwickelt, was die Schwarzamerikaner am dringendsten brauchen; denn es ist erst kürzlich wieder nachgewiesen worden, und zwar durch gediegene Untersuchungen, daß selbst die schwarze Mittelschicht kaum Zugang zu Krediten hat, und daß die Banken nach wie vor diskriminieren. Banken von Schwarzen aber gibt es nicht. Zwar sind die Angestellten vieler Banken heute in der Mehrzahl Schwarze, doch selbst die sind ihren Volksgenossen gegenüber häufig mißtrauisch.
Die Koreaner sind vielerorts an die Stelle von Juden getreten, die früher den Kleinhandel in den schwarzen Ghettos beherrschten, inzwischen aber sozial aufgestiegen sind. Auch viele Koreaner, wenn nicht gar die meisten, wohnen längst in besseren Vierteln. Gerade das aber wird ihnen von den Schwarzen vorgehalten. Man sieht in ihnen Imperialisten, die das Geld aus den Armenvierteln herauspressen und damit fürstlich leben, weitab vom Schuß. Deshalb könne es zu keiner Stadtsanierung kommen. Wenn schon die Koreaner ihr Geld an den Schwarzen verdienen, dann sollten sie es auch in den Ghettos ausgeben.
Problematisch ist ferner, daß die Koreaner in der Regel nicht zu den sanftesten Bürgern gehören, sondern sich eher durch eine gewisse Aggressivität auszeichnen. Das heißt, von Schwarzen drangsalierte Koreaner schlagen zurück, und nicht zu knapp. Verkäufer in Ladengeschäften, Tank-stellenwart und Taxifahrer gehören zu den gefährlichsten Berufen. Alteingesessenen fehlt der Mut dazu, allerdings auch die Strebsamkeit. Es sind hauptsächlich Einwanderer aus dem Mittleren Osten, die in die Bresche springen - und oft mit ihrem Leben dafür zahlen. In New York und Washington sind mehrere Afghanen umgebracht worden, die in der Heimat großen Ruhm als furchtlose Mudschahedin erworben hatten. In den USA wurden sie als Tankstellenwarte des Nachts für ein paar lumpige Dollar ermordet - 20 Dollar, 25 Dollar, in einem Falle handelte es sich um nicht mehr als 15 Dollar. Ein Ex-Mudscha-hedin zog die Arbeitslosigkeit vor, statt jede zweite Nacht wegen ein paar Flaschen Bier im Geschäft bedroht zu werden.
Koreaner dagegen langen schnell zum Revolver unter dem Ladentisch, und es gibt eine Fernsehaufnahme von einer koreanischen Ladenbesitzerin, die eine schwarze Jugendliche erschießt. Deshalb werden in New York und anderswo einige koreanische Geschäfte seit zwei Jahren „bestreikt", durch ununterbrochene Demonstrationen schwarzer Radikaler. Inzwischen ist das alles bereits zum Filmthema geworden, zum Beispiel durch den Kassenschlager „Do The Right Thing" des schwarzen Meisterfilmemachers Lee Spike.
In Los Angeles sind auch Schwarze und Latinos (Einwanderer aus Lateinamerika) aufeinander losgegangen. Zwischen diesen beiden Minderheiten sind blutige Auseinandersetzungen häufig und werden wohl auch kaum nachlassen; denn beide sind etwa gleichstark und stellen ähnliche Ansprüche. Dabei zeigt sich jetzt schon, daß die Latinos das Rennen machen werden, einmal durch stärkere zahlenmäßige Zunahme, zum anderen durch schnelleren sozialen Aufstieg.
In Miami fühlen sich die Schwarzen von den Latinos unterdrückt, die dort meist aus Kuba stammen, in der großen Mehrzahl weißer Hautfarbe sind und die Oberschicht darstellen. In Washington sind die Latinos generell weniger weiß, sondern stärker indianisch geprägt. Die Mehrzahl kommt aus El Salvador, Guatemala und Nikaragua. Sie fühlen sich von der schwarzen Stadtverwaltung und der überwiegend schwarzen Polizei so behandelt, wie anderswo Schwarze sich von den Weißen behandelt fühlen. Daher der große Rassenkrawall von 1991, als der von Latinos bewohnte Stadtteil Mount Pleasant brannte.
In Los Angeles, wo die Latinos aus Mexiko stammen, halten sich beide die Waage, und mancherorts sind sie bei den jüngsten Unruhen gemeinsam gegen die Asiaten vorgegangen -Schwarz und Braun gegen Gelb.
Damit wird die alte Kontroverse wieder aufgeworfen: Werden die USA zum Schmelztiegel der Rassen oder zum Schauplatz von „Stammeskrie-' gen"? Tatsächlich findet beides gleichzeitig statt, das eine schließt das andere nicht aus. Auffallend ist dabei, daß sich Weißamerikaner, also speziell die dominierenden WASPs (White An-glo-Saxon Protestants) mehr mit Menschen aus dem Mittleren Osten, aus Lateinamerika und vor allem aus Asien vermischen als mit Schwarzamerikanern. Bei schwarz-weißen Heiraten ist meist der Mann Schwarzamerikaner und die Frau Deutsche, oder aber der Mann Weißamerikaner und die Frau Afrikanerin.
Die Zuwanderung so vieler Afrikaner ist ein Phänomen besonderer Art, das noch von sich Reden machen wird.
Rund 300.000 Nigerianer gibt es mittlerweile in den USA, und wenigstens noch einmal so viele Einwanderer aus anderen afrikanischen Staaten. Sie verhalten sich nicht anders als andere Einwanderer auch, das heißt sie ak-kem und schuften und steigen auf. Das schafft eine Kluft zwischen Afrikanern und Afro-Amerikanem. Es ist nicht auszuschließen, daß sich in Zukunft ähnliche Zusammenstöße zwischen Schwarz und Schwarz ereignen werden wie derzeit zwischen Schwarz und Gelb oder Schwarz und Braun. Vereinzelte Beispiele dafür gab es bereits.
In Philadelphia brachte 1986 ein zum Islam konvertierter Schwarzamerikaner seinen arabischen Imam um. Seinem nigerianischen Lehrer gegenüber beschwerte sich der Mörder wie folgt: „Du bist auch nicht anders. Ihr braucht nur drei Jahre, um es zu schaffen. Im ersten Jahr lernt ihr die Sprache, im zweiten schafft ihr es zu einem Job und einem Auto, im dritten bringt ihr es zu einem Haus und seid gemachte Leute. Wir schaffen es nie. Wir helfen euch bei den ersten Schritten, bringen euch die Sprache bei, aber nach drei Jahren stehen wir noch genauso da wie zuvor."
Auch wenn die afrikanischen Einwanderer aus Pietät es sich nicht anmerken lassen, sie gehen gern auf
Distanz zu den Schwarzamerikanem und ziehen die Gesellschaft der Weißen vor.
Ganz offensichtlich ist die Hautfarbe nicht der springende Punkt. Die Schwarzen sehen sich heute als die amerikanischsten aller Amerikaner, und nicht zu Unrecht; denn sie gehören zu den ältesten Volksgruppen im Lande. Die Mehrzahl der heutigen Amerikaner ist später gekommen als die Sklaven aus Afrika. Daher besteht ein starkes Ressentiment gegen „Ausländer". Bei den Diskussionen über die Unruhen in Los Angeles schimpfte eine schwarze Politikerin heftig auf die Einwanderungspolitik und warf der Regierung vor, mehr für „Kurden und solche Leute" auszugeben als für die Armen im eigenen Land. Was man in den letzten Wochen zu hören bekam, unterschied sich wenig von der Anti-Ausländer-Agitation der europäischen Rechten, nur kam es hier aus dem Munde von Schwarzen - gegen Gelbe und Braune.
Vor dem Hintergrund dieser nationalen Debatte ist die Gestalt des von Polizisten brutal verprügelten Randalierers Rodney King verblaßt. Bisweilen wird stundenlang diskutiert, ohne daß der auslösende Vorfall überhaupt erwähnt wird. Augenscheinlich haben die USA einen solchen Auslöser gebraucht, um endlich eine Auseinandersetzung in Gang zu setzen, für die es höchste Zeit war. Was dabei an aufgestauter Frustration herausbricht, ist umwerfend.
Im Mittelpunkt steht zur Zeit die Rolle von Amerikas „Modellgemeinde", der Koreaner, die bisweilen als die mustergültigste aller Ein Wanderergruppen bezeichnet worden ist. Was macht sie so stark? Eine religiöse Einheit bilden sie nicht; denn sie teilen sich gleichmäßig auf Buddhisten und mehrere christliche Konfessionen auf, alle gleichermaßen aktiv. Nicht zu vergessen die aggressive Unifica-tion Church des geschäftstüchtigen Messias Sun Moon, dessen „Moonies" in den USA eine Macht darstellen.
Alle Vergleiche ergehen sich in endlosen Erklärungsmustern, weshalb die Schwarzamerikaner nicht vorankommen. Die tüchtigen afrikanischen Einwanderer kommen meist aus gerade jenen Ländern, aus denen die Sklaven geholt wurden, sind also gewissermaßen Verwandte. An der Rasse liegt es also nicht, ein Argument, das bisher viel zu wenig Beachtung gefunden hat, vielleicht weil die starke afrikanische Präsenz erst jüngsten Datums ist.
Offensichtlich ist die tragische Geschichte der Sklaverei nicht so schnell zu überwinden, wie viele gehofft hatten. Die Narben brechen immer wieder auf. Die Genesung von dem psychischen Schaden wird noch recht lange dauern und Anstrengungen ganz besonderer Art erfordern.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!