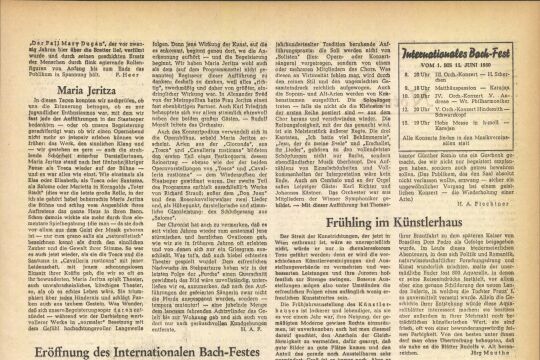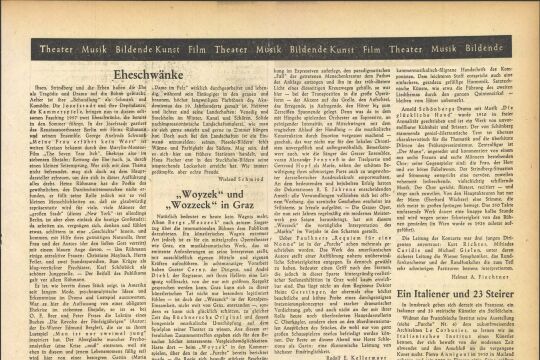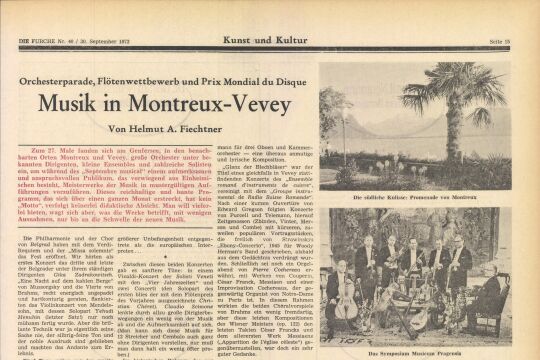Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Totales Musiktheater
Kürzlich übernahm das BBC Orchester in London unter der Leitung von Pierre Boulez die europäische Erstaufführung von „Foxes and Hedgehogs”, Verses and Cantos für vier Sänger, 15 Instrumente und elektronische Tonanlage von Eric Salzman (geboren 1933), dem amerikanischen Universitätsprofessor und Musikkritiker, der durch die wahllose und unbeschränkte Verwendung von Multi media dem Kommunikationsproblem auf die Spur kommen und das Publikum durch Provokation zu regerer Beteiligung veranlassen will.
Seine Forderung nach einer „nicht-abstrakten, weitreichenden, humanistischen, echt post-modernen Kunst” kleidet er in die Fabel Ar-chilokos' von den Füchsen, die vieles wissen, und dem Igel, der nur das Eine weiß, und er unternimmt es, eine komplexe Situation zu konfrontieren, interpretieren und dramatisieren, um zu einer Neuwertung von Ausdruck, Kommunikation und Kontext zu gelangen. Theoretische und technische Argumente lehnt er ab und indem er durch Hinzunahme von Jazz, Pop, Sprache, Gesang, Aktion, Film, Elektronik, Beleuchtung, Ampliflkation, Kostümierung und Verfremdung, Kollage und Kolportage die Umwelt zu beteiligen und einzubauen versucht, glaubt er, die technologische Gesellschaft zu reflektieren und für das totale Publikum unserer Zeit ein totales Kunstwerk zu schaffen.
Daß Salzman durchaus die technischen Voraussetzungen erfüllt, um die verschiedenen Media richtig einzusetzen, kann stillschweigend angenommen werden. Daß theatralische Momente in der Allegorie geschickt eingesetzt werden, soll nicht bestritten werden. Wenn der Funke trotzdem nicht zündet, so liegt das wahrscheinlich daran, daß die amerikanische Umwelt nicht der hiesigen entspricht, und Zitate, Assemblagen, Jazz-Überblendungen, Gesten und
Pop-Allusionen gemeinsame Erfahrungen, Eindrücke und Erinnerungen voraussetzen, die hier einfach fehlen. Für Ausdrucksformen, die in Amerika vor fünfzig Jahren von Charles Ives eingeführt wurden und durch die Diskrepanz zwischen vielschichtiger Gestaltung und naiver Formulierung befremdeten, findet Salzman neue Lösungen, die sein mögen, jedoch keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben können.
In den Aufführungsnotizen bestimmt er, daß ein in zwei Gruppen von je vier Musikern eingeteiltes Tutti wenn möglich im Orchestergraben, also unsichtbar und in konventionellem Frack, spielen soll — offenbar vertreten sie die Tradition — während auf der Bühne ein aus Klavier, Gitarre, Trompete, Posaune, Kontrabaß und zahlreichem Schlagzeug bestehendes Ensemble in Straßenanzug sich mit den vier Sängern unterhält, auf dem Podium umhergeht, den Eindruck einer Jam-Session erweckt und den Zeitgeschmack vertritt. Und die Sänger? Ob sie den Text von Bery Ashbery singen, kreischen, lallen oder rezitieren, ob sie schnalzen, pfeifen, klatschen oder brabbeln, verstehen soll man sie sowieso nicht, man soll nur erfassen, worum es geht, aber man kennt heute Ligetis „Aventu-res” und Schnebels „Glossolalie”, und Gruppenimprovisationen sind fast so alltäglich in Konzerten wie Filmprojektionen und Dialoge mit Tonband; daher war man auch nur milde amüsiert. Es war einfach zu viel des Guten, der Spuk dauerte zu lang (55 Minuten), das Spiel war zu bekannt.
Mit einer ausgedehnten und brillant gespielten Saxophonkadenz begann das Stück, das unter einem Horror vacui zu leiden schien, und es endete mit einer ohrenbetäubenden Tutti-Improvisation, die plötzlich im Sande verlief. „Breath out” hauchte der Bassist in das Mikrophon. Es klang wie ein Stöhnen der Erschöpfung, ein Aufatmen der Erleichterung. Das Publikum war sich einig, man hatte entschieden genug. Nur die mustergültige Aufführung, an welcher Catherine Comay (Assi-stant-conductor), Richard Rodney Bennett (Klavier), Mary Thomas (Sopran) und eine Unzahl hervorragender Sänger, außergewöhnlicher Schlagzeuger und erstklassiger In-strumentalisten, vor allem ein auffallend virtuoser Saxophonist, teilnahmen, konnte einen versöhnen mit der Strapaze, der man sich unterzogen hatte.
In dem in Nr. 20 der „Furche” auf Seite 11 erschienenen Referat über musikalische Graphik steht ein falscher Name. Statt „Frau Professor Berta Fuchs” muß es heißen „Frau Professor Berta Ernst”.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!