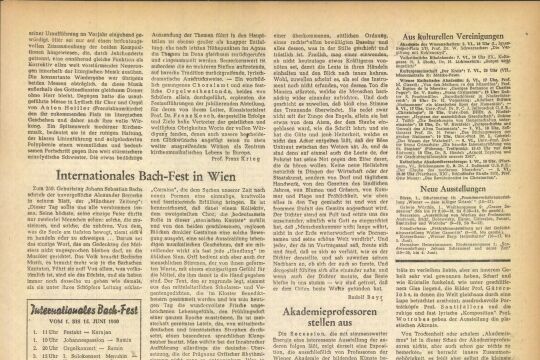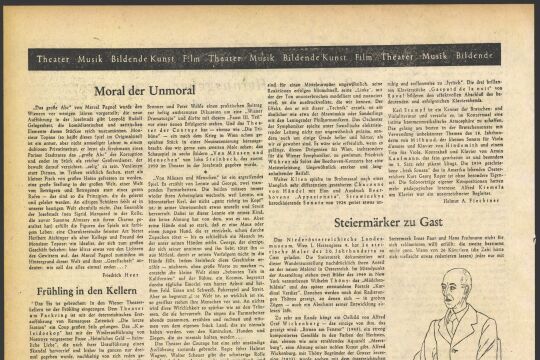Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Triumph der Tragödie
Die Bayerische Staatsoper hat ihre zweite Festspielnovität: Verdis „Don Carlos“ in italienischer Sprache (man wollte zunächst die französische Sprache der Originalfassung, das scheiterte jedoch an technischen Schwierigkeiten), von Otto Schenk inszeniert, dirigiert von Georges Pretre und ausgestattet von Rudolf Heinrich. Die Besetzung — das sei vorausgeschickt — ist sensationell: Carlos Cossutte in der Titelpartie, Katia Ricciarelli als Elisabeth, Brigitte Fassbaender als Eboli, Ruggero Raimondi in der Rolle des Königs-Philipp; Eb&fTiäfä WäcBFef“5ä7s Posa und Luigi Roni als Großinquisitor. Otto Schenk stellte erstmals in München die sogenannte Originaloder Urfassung des Werkes vor, allerdings mit einigen Einschränkungen, denn Schenk hat nur so viel von diesem Original verwendet, als ihm dramaturgisch zu einer Klärung der Handlung notwendig erschien, und tatsächlich ist diese Fassung — auch wenn sie den Abend bis zu der stolzen Länge von viereinhalb Stunden dehnt — von großem Vorteil. Die Exposition mit dem in Fontainebleau spielenden ersten Akt macht jetzt verständlich, warum die zunächst mit Carlos verlobte Elisabeth, trotz ihrer Liebe zum Infanten, in die Heirat mit Philipp einwilligte, diese Heirat nämlich ist Voraussetzung zum Frieden mit Spanien, einem Frieden, den sich Flandern dringend ersehnt. Elisabeths Heirat ist also ein Opfer für ihr Volk, gleichzeitig aber auch der Ausgangspunkt der sich nun folgerichtig entwickelnden Tragödie. Verdi hat seinen „Don Carlos“ für die Pariser Weltausstellung des Jahres 1867 als Große Oper komponiert, und Otto Schenk hatte recht, wenn er sich in der dramaturgischen Konzeption, aber auch in seiner Personenregie und in den großen Chorszenen ganz an diese Form der Großen Oper hält, wie sie zu dieser Zeit in Paris Furore machte (Verdi-Wagner-Meyerbeer, welche Konkurrenten in der französischen Metropole!).
Selbstverständlich hat diese Interpretation der historischen Oper aus der Sicht des 19. Jahrhunderts auch ihre Schwächen und vor allem in den geistigen Dimensionen des Stoffes werden bei Schenk Grenzen bemerkbar, die er anscheinend nicht überschreiten kann, da sie sich mit rein komödiantischen Mitteln nicht überbrücken lassen. Auch läßt Schenk seinen italienischen Protagonisten zuviel Freiheit in den Aktionen — ein strengeres, macht-strotzenderes, furchterregenderes, gnadenloseres Spanien wäre zu erwarten gewesen. Ein besonderes Lob noch dem Staatsopernchor — wieder in der Einstudierung Wolfgang
Baumgarts — und auch der Bühnenmusik, die in den monumentalen Bühnenbildern Rudolf Heinrichs präzis funktionierte.
Als Dirigent war Claudio Abbado vorgesehen, mußte jedoch aus gesundheitlichen Gründen absagen. Es war deshalb für Georges Pretre, der sich bereiterklärte, die schwere Aufgabe zu übernehmen, sehr undankbar, seine Vorstellungen durchzusetzen. Pretre ist als Dirigent so völlig anders geartet als Abbado, ,daft.:vaush: das Publikum umdenken, mußte und da ; bekanntlich-, die, Trägheit des Denkens eine weitverbreitete Krankheit ist, mußte sich Pretre von Aufzug zu Aufzug das musikalische Terrain erst einmal erobern. Pretre ist nicht der federnde Brio-Dirigent für italienische Klangeffekte, vielmehr ist er — aus der Schule von Cluytens kommend — ein sehr auf Transparenz und gewissenhafte Detailarbeit bedachter Maestro echt französischen Feinschliffs, ein Dirigent, der nicht so sehr dem Augenblick verhaftet ist, als vielmehr das Ganze vor Augen hat und deshalb eine langsame aber konsequente Steigerung der musikdramatischen Vorgänge anstrebt. Die Münchner Philharmoniker boten ihm die denkbar beste Hilfestellung, sie schenkten ihm die Schlagkraft des Tutti, die warmen Hornpassagen, das Secco von Posaunen, Tuba und Trompeten, die differenziertesten Holzbläserpassagen, ein traumhaftes Cello-Solo (Heinrich Klug) und die Fülle ihres immer wieder faszinierenden Streicher-klanges. Das Ende dieser Festspielpremiere war unerfreulich, denn die Anhänger verschiedener Sänger übertrafen sich gegenseitig an willkürlichen Reaktionen, so daß das Münchner Nationaltheater ein Kesseltreiben von Buh- und Bravorufen über sich ergehen lassen mußte.
Glanzvoller der Festspielstart: Das Triumvirat: Rennert — Sawallisch — Heinrich huldigte dem Jubilar -Carl Orff am Abend seines 80. Geburtstags im Münchner Nationaltheater mit einer faszinierenden Wiedergabe der „Antigonae“, ein Werk, das seit der Münchner Erstaufführung im Jahre 1951 im Prinzenregententheater (unter der musikalischen Leitung von Georg Solti, von Heinz Arnold inszeniert und ausgestattet von Helmut Jürgens) nicht mehr auf dem Spielplan der Bayerischen Staatsoper gestanden hat. „Antigonae“ — 1949 in der Salzburger Felsenreitschule zur Uraufführung gebracht — ist die erste der griechischen Tragödien Orffs, 1959 von „Oedipus der Tyrann“ gefolgt und 1968 mit dem „Prometheus“
fortgesetzt. Orff nennt sein Werk: „Antigonae. — ein Trauerspiel des Sophokles von Friedrich Hölderlin“.
In diesem Titel sind die Stationen schon genannt, die auf dem Weg zu Carl Orff liegen. Was wir in dem Orffschen Werk erfahren, ist schon gefiltert und bei Orff zu einer letzten Steigerung, Summierung und Konzentration gebracht. Von Sophokles (495 bis 405 v. Chr.) sind von schätzungsweise 130 Dramen nur sieben erhalten geblieben und davon steht,,.^Antigonae“ nach,, „Ajas“ .an zweitqr/^te^jSmhokles war .der zweite große attische Tragiker, dessen Höhe, zusammenfällt mit der Blüte Athens unter Perikles. Es ist nicht verwunderlich, daß sich Hölderlin um Übertragungen der Werke dieses schöpferischen Genius' bemühte.
Hölderlin (1770 bis 1843), neben Schiller und Goethe der dritte große Bewahrer des klassischen Ideals — „so unbedingt in seiner Forderung des Reinen, daß er daran zerbrach“ — hat ja in seinem „Archipelagus“ ein Urbild des Griechentums in Natur und Geschichte geschaffen und so spricht aus seiner Antigonae-Dar-stellung antiker Geist, wie er auch wieder in der Gestaltung durch Carl Orff lebendig ist. Zu Orffs 60. Geburtstag schrieb Wieland Wagner an den Komponisten: „Ihnen ist mit der .Antigonae' das Wunder gelungen, durch ein völlig neues Klangbild von bestürzender Unerbittlichkeit eine für uns Heutige gültige neue Deutung des Phänomens .Griechische Tragödie' zu schaffen...“ Dieses Phänomen liegt in der Kom-promißlosigkeit eines unausweichlichen Schicksals, ja in der Herausforderung dieses Schicksals — das nur Tod für Antigonae bedeuten kann — durch die Protagonistin. Dadurch, daß sie Kreon zwingt, sie töten zu lassen weil sie durch die Bestattung des Bruders und Staatsfeindes gegen das Gesetz handelte, zwingt sie den Tyrannen, an seinem eigenen Gesetz zu zerbrechen.
Rudolf Heinrich hat einen großräumigen, rechteckigen Bühnenraum geschaffen, der durch mehrere Zugänge und einen Lichtschacht von der Decke herab hell erleushtet ist, bisweilen sich etwas verdunkelnd, doch ohne mystisches Pathos. Dieser Raum ist sehr zweckdienlich für chorische Bewegungen, Blockbildungen und weit in den Zuschauerraum hineinreichende Einzelauftritte.
Das ist ganz im Sinn der Personenregie Günther Rennerts. Er löst die starren Formen des Kultischen — wie sie noch vor zehn Jahren üblich waren — weitgehend auf, stellt Kreon zwischen den antiken Chor und das Publikum, gibt ihn ganz dem Anblick des Zuschauers preis, macht dieses zwischen Menschsein und Politik eingekeilte Individuum durchschaubar, rückt diese Gestalt nicht in die unpersönliche Welt des Symbols, sondern bringt sie uns menschlich näher. Von diesem Zentrum her sind alle übrigen Figuren zu verstehen und William Murray verkörpert in Gesang und Spiel diese Potenz zwischen ausübender und zerbrechender Macht mit unvergeßlicher Intensität. Selbstverständlich bleibt dabei, von der Aktion her gesehen, die Gestalt der Antigonae die treibende Kraft und dieser Umstand wird in jeder Position und jeder Geste Cotette Lorands artikuliert. Was für eine Darstellerin! Eine Frau zwischen Priesterin und Furie tritt uns entgegen, in wogender Gangart durchmißt sie, hoch aufragend, den Raum, wird zu einem Bündel aus Trotz und Energie und besteht auf ihren Tod. Dabei hat Frau Lorand — ihrer extremen Aussage entsprechend, — fortwährend die extremsten Stimmlagen zu bewältigen. Kreon warnend, nähert sich der blinde Seher Tiresias, der in Hel-muth Melchert erschütternden Ausdruck fjndet und gleichermaßen zwingend auch die übrigen Sänger-
Darstellter: Ortrun Wenkel (Isme-ne), Astrid Varnay (Eurydice), Kieth Engen (Bote), Thomas Lehrberger (Hämon), Horst Hoff mann (Wächter) und Hans Günter Nöcker (Chorführer).
Dem Klangapparat steht Wolfgang Sawallisch vor. Er gibt den Chören — vortrefflich einstudiert von Wolfgang Baumgart — kommentierendes und deklamierendes Gewicht, er verdeutlicht das Nebeneinander von dramatischen, lamentierenden und cantablen Gesangsphrasen der Solisten und er beherrscht die instrumentale Klangpalette aus mehreren Klavieren, Bläsern, Harfen, Kontrabässen und ungezählten Schlaginstrumenten, die von etwa 15 Musikern bedient werden (darunter Marimbaphone, afrikanische Trommeln oder javanische Gongs). Sawallisch ist aber darüber hinaus noch etwas sehr Wesentliches gelungen: er hat es nicht bei rhythmischen Akzenten und hämmernden Ostinato-Effekten belassen, sondern auch auf den Klangreichtum dieser Partitur verwiesen — auf ihre eigentlich musikalische Substanz! Ovationen für alle Mitwirkenden und Huldigungen für den anwesenden Carl Orff.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!