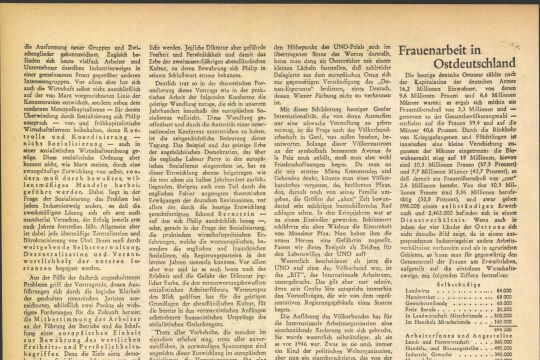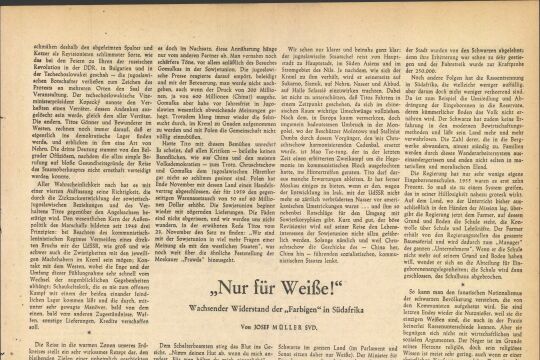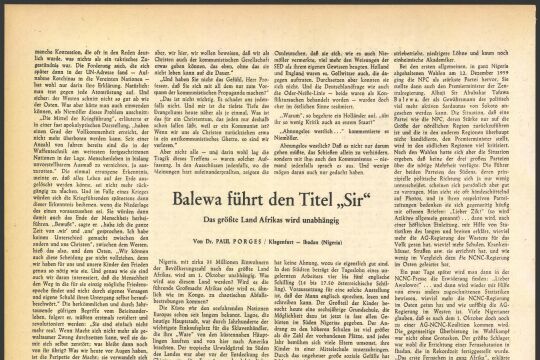Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Trumpf am Kap
Die politischen Konflikte im Süden des afrikanischen Kontinents verdienen immer mehr die Aufmerksamkeit des alten Europa, das mit seinen Grenzziehungen am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts hier zum Teil gegen seine eigenen und gegen die Belange der dort lebenden Negervölker operiert hat. Darüber hinaus ergab sich in den Gebieten mit konzentrierter Ansiedlung von Europäern der Gegensatz zwischen „Schwarz” und „Weiß”, der seit dem Ende des Ersten Weltkriegs in der gesamten Südafrikanischen Union bestimmend wurde. Gegenwärtig wird versucht, die überall südlich des Äquators daraus entwickelte Spannung durch Befriedungsbemühungen zu mildern. Sollte dies nicht gelingen, könnte ein Brand entstehen, der auch die großen Mächte der Politik vor unlösbare’ Aufgaben stellen würde. i
Bereits vor einigen Jahren sah Sieh die Südafrikanische Republik genötigt, auf der Suche nach Absatzmärkten für die eigenen Produkte eine „Outwärd-policy” einzuleiten, die sich an die schwarzafrikanische Staatenwelt richtete. Viel Erfolg konnte dieser Politik jedoch nicht beschieden sein. Gleichzeitig wurde nämlich im Innern des südafrikanischen Staats die international verurteilte Apartheid — die Rassentrennung — eher verschärft als gemildert. Man erinnere sich an die Entrüstung, vor allem in Großbritannien. als 1966, nach der Ermordung des Ministerpräsidenten Ver- woerd, sein Nachfolger, der heute noch amtierende Premier Balthasar Vorster, die Rassentrennung sogar auf „Farbige” (wie die Mischlinge genannt wurden) ausgedehnt hatte.
Eben Vorster unternahm in den letzten Wochen einen neuen Versuch entgegenkommender Außenpolitik über den Sambesi hinweg nach Norden. Obgleich man meinen könnte, die Voraussetzungen dafür ständen gegenwärtig noch schlechter als zu Beginn der siebziger Jahre, als die „Organisation für Afrikanische Einheit” (OAU) sich jedem Kontakt mit Pretoria widersetzt hatte, übersieht man wahrscheinlich in Europa leicht einige günstigere Aspekte für die südafrikanische Politik.
Es ist Tatsache, daß Südafrika nur Dank des Vetos der drei Westmächte im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen pro forma Mitglied der Weltorganisation geblieben ist. Dem berechtigten Ärger der Gründernationen dieser 1945 errichteten internationalen Ordnung über den damit offen zutage liegenden Mißbrauch der Majorität zugunsten eigensüchtiger asiatischer und afrikanischer Zielsetzung hat Washingtons UN- Botschafter Scali in einer Rede ausgedrückt. Er hat — nach jahrelangen Provokationen gegen die den finanziellen Hauptanteil der UN tragenden Vereinigten Staaten — endlich einmal klargestellt, daß Amerika nicht auf Dauer Entscheidungen des Plenums gegen die permanent zahlenden Staaten Nordamerikas und Westeuropas hinzunehmen gewillt ist.
Was die Situation Südafrikas angeht, so ist allerdings, trotz des Bruchs der farbigen „Weltöffentlichkeit” mit Pretoria, nicht zu übersehen, daß die schwarzafrikanischen Staaten größtenteils mit Hungersnöten oder mindestens wirtschaftlichen Engpässen zu tun haben, die sie allein nicht zu meistern vermögen. Daher konnte Vorster, ungeachtet der Diskriminierung seines Landes in der UN-Vollversammlung, im Senegal mit dem literarisch angesehenen und gern zwischen „progressiven” und „gemäßigten” Afrikanern vermittelnden Präsidenten Senghor Zusammentreffen; er konnte mit dem mehr auf Evolution hinarbeitenden Präsidenten Houphouet- Boigny von der Elfenbeinküste sprechen.
AIS wesentlich für die mögliche Verlagerung des politischen Gegensatzes zwischen der OAU und Südafrika auf die Ebene von Gesprächen sieht man aber eine Zusammenkunft von Ministerpräsident Vorster und Präsident Kaunda von Sambia an. Man spekuliert sogar, daß der nach wie vor eigenwillig gegen London seinen Standpunkt vertretende Premier von Rhodesien, Ian Smith, an einem solchen Treffen teilnehmen könnte. Ob eine Konferenz, die kürzlich im sambischen Lusaka zwischen Kaunda und seinen Kollegen Nyerere aus Tansania und Khama aus Botswana abgehalten wurde, der Vorbereitung einer solchen schwarzweißen Annäherung dienen konnte, steht dahin. Während der südafrikanische Rundfunk davon sprach, die „weltweite Detente” dürfe vor dem Südteil Afrikas nicht halt machen, behaupten andere Kenner der Verhältnisse, der schwarzweiße Dialog sei endgültig gescheitert.
Offenbar erwarteten Kaunda und die ihm verbundenen Präsidenten, daß sich Südafrika — sozusagen in Fortsetzung seiner Linie der Nichtintervention bei der Umstrukturierung des portugiesischen Moęam- bique — nun in Rhodesien für einen Kurs einsetzt, der den vier schwarzafrikanischen Befreiungsorganisationen sofort die politische Dominante ermöglicht. Selbstverständlich wird die Regierung Smith dies nicht akzeptieren. Und weil sie sich dieser Maximalforderung nicht beugt, werden die Guerrillero-Aktionen gegen Rhodesien weitergehen, deren Einstellung Kaunda zunächst gegen einen Abzug südafrikanischer Polizeieinheiten von der rhodesischen Grenze angeboten hatte.
Neben diesen Sorgen um die nächste Zukunft des afrikanischen Kontinents südlich des Äquators besteht für Pretoria der Zwang zur Verbesserung der allgemeinen außenpolitischen Lage. In diesem Punkt ist man nicht einmal zu pessimistisch, rechnet man doch, ungeachtet der durch die Apartheid gegebene Isolierung auch gegen Westeuropa, doch mit einer Aufwertung infolge der maritimen Politik der Sowjetunion im Südatlantik und im Indischen Ozean.
Die Sowjets besitzen Stützpunkte im ostafrikanischen Somalia und auf der Insel Sokotra; im Persischen Golf haben sie (als Gegenzug zur iranischen Beherrschung der Öl-Route) das irakische Um-Quasr ausgebaut. Sie ließen sich in Indien hier und dort Hafenrechte einräumen, deren Stützpunktcharakter allerdings von der indischen Regierung bestritten wird. Der Westen — das heißt in diesem Falle: die Vereinigten Staaten und Großbritannien — muß dieser Expansion begegnen. Dafür benötigt er Simonstown bei Kapstadt.
Seit dem nach dieser Basis genannten Vertrag von 1955 hat die englische Marine vom Kap aus den Seeweg in den Indischen Ozean kontrolliert. Nun haben die Briten vor, im Zuge der Reduzierung ihrer Verteidigungsausgaben, dieses Abkommen zu beenden. Südafrika fühlt sich dadurch nicht mehr emotionell getroffen. Die Jahre der Harmonie mit den Engländern, die erstaunlich schnell dem Burenkrieg der Jahrhundertwende gefolgt waren und später in einer engen Freundschaft zwischen Churchill und General Smuts gipfelten, sind ohnehin entschwunden. Nach Lage der Dinge, das weiß man in Kapstadt, werden andere NATO- Mitglieder, vor allem die Amerikaner, sich dieser unersetzlichen Bastion annehmen müssen.
Es ist im übrigen noch keineswegs sicher, daß auch in London das Interesse an Simonstown endgültig abgeschrieben worden ist. Großbritannien hat zwar Bastionen abgebaut und rüstet weiter „ostwärts von Suez” ab (vom Persischen Golf bis Singapur). Die für die Zukunft wichtigste Basis jedoch, Diego Garcia im Tschagos-Archipel inmittel des Indischen Ozeans, wird nicht nur behauptet, sondern gemeinsam mit den Amerikanern „bescheiden erweitert”. Auch die Labour-Regierung folgt also in dieser Frage dem schon vom konservativen Kabinett Heath eingeschlagenen Kurs. Simonstown bleibt in jedem Falle wichtigste Station auf der Route vom Nordatlantik nach Diego Garcia.
Sowohl Neu-Delhi als auch Moskau regen sich seit längerem über diesen Ausbau einer westlichen Basis auf. Sie glauben zu wissen, daß hinter der Formulierung „bescheidene Erweiterung” die Errichtung von Rollfeldern für atomare Waffenträger jeglicher Kapazität steht. Südafrika paßt diese Entwicklung auf jeden Fall ins eigene Konzept. Um als Staat zu überleben, mag es in der Innenpolitik die Apartheid abwandeln oder gar abschaffen müssen. In der Außenpolitik aber braucht es weiterhin die militärische’Kooperation mit den angelsächsischen Mächten, denen es in zwei Weltkriegen verbunden war.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!