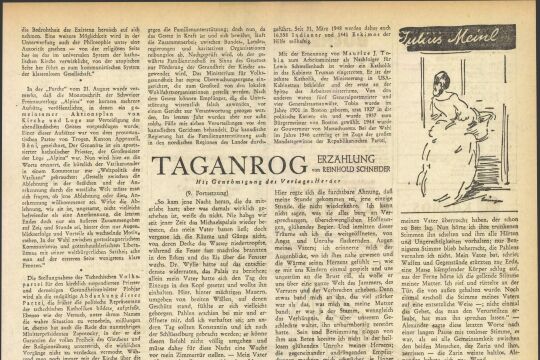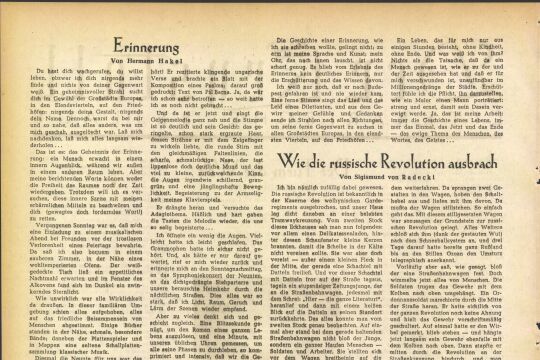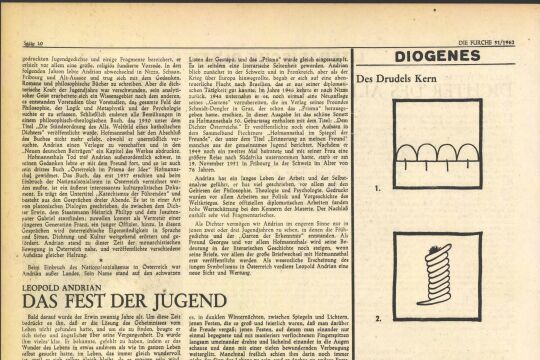Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Tschernobyl, jähe Angst
Wir wissen wenig oder nichts. Deshalb haben wir Angst.
Wissenschaftler wissen mehr, aber nicht so viel, daß sie keine Angst zu haben brauchten. Sie fällen ein Urteil über die Augenblickslage direkt und sprechen indirekt von den Folgen. Glaubhafter klänge es, mit jeder Aussage schon beim Aussprechen Zweifel anzumelden. Der Ängstliche gibt seiner Angst Ausdruck, indem er das Einfachste fordert: Weg mit dem, was uns Angst macht! — Das sei nicht so einfach, entgegnen Politiker.
Erinnern wir uns: Es war alles sehr einfach. Das Einfache zieht die Grenze zum Irrationalen. Man sah nichts, hörte nichts, roch nichts, nahm überhaupt mit
menschlichen Sinnen nichts wahr. Haben wir also mit dieser Katastrophe alles Machbare aus der Hand gegeben und die Grenze zum Irrationalen bereits überschritten? In Hinblick auf das Ge-■ schehene gibt es den Schritt zurück nicht mehr. Wir müssen damit leben. Und leben wir damit? Und wie?
Es dauerte eine Zeitlang, bis das Ausmaß der Katastrophe ganz ins Bewußtsein eindrang, bis die Abwehrmechanismen, die natürlich sind, das Nichtdrandenken, das Verdrängen der klaren Tatsache des Ereignisses überwunden waren.
Damals hatte ich einen Traum. Ich war in einen ungeheuer großen und weiten Raum aus Metall eingeschlossen. Nichts bedrohte mich direkt, aber das Wissen und das Gefühl, in dieser Unendlichkeit eingeschlossen zu sein, erzeugte in mir eine Angst, die sich zur Verzweiflung steigerte, durch die ich schließlich jäh erwachte. Ich stand auf, ging umher, öffnete ein Fenster in die Nacht; aber es nützte nichts, die Angst wirkte weiter. Wieder im Bett, wehrte ich mich gegen das Einschlafen, obwohl die Müdigkeit die Angst zu verdrängen schien.
In dieser Nacht wachte ich noch einige Male auf, ohne Grund, denn der angsterregende Traum kam nicht mehr. Aber ich hatte in diesen Schlafpausen eine überdeutliche Vorstellung von dem erlangt, was uns betroffen hatte, ohne daß ich sagen könnte, was diese Vorstellung genau war.
Am Morgen ging ich, wie jeden Tag, den gewohnten Weg, eine Übung, ein Training, um mit der regelmäßigen Bewegung des Gehens die Trägheit des Schlafs ganz abzustreifen und den Tagesund Arbeitsrhythmus zu finden. Und die Vorstellung mitsamt der Betroffenheit ging neben mir her, begleitete mich wie ein treuer Hund, der nicht abzuschütteln ist. Ich anerkannte sogar seine Begleitung, fand Worte, die ich zu ihm sagte in dem Bewußtsein, daß wir nun eine unzertrennliche Gemeinschaft waren.
Die Worte gingen von der neuerlangten Lebensperspektive aus, die von der Angst geprägt worden war und mir bei jedem Schritt mehr und mehr ihre Daseinsberechtigung aufzwang. Und ich sagte ja, bei jedem Schritt ja, obwohl sich mein Inneres dagegen aufbäumte.
Dieses Ereignis, die Katastrophe, wollte also eine Symbiose mit mir eingehen, ich spürte, wie ihr das zu gelingen drohte, eine Symbiose — ich war erschrocken und erstaunt zugleich, dachte an die sinngemäße Deutung des Wortes Symbiose: Zusammenleben un-
gleicher Lebewesen zu gegenseitigem Nutzen. Eine Ironie, ein Wahnsinn, eine Zumutung dieser Vorgang, dem ich nicht entrinnen würde.
Ich schaute aufmerksam herum. Nichts hatte sich verändert, alles war wie immer, die Straße, die Äcker, der Wald, die Häuser, die Gärten. Die Vögel sangen — wie immer. Ich sagte zu meinem Begleiter, das sei das Infame daran. Er gab die Antwort, die ich mir selber gab. Ich war allein mit seiner wortlosen Sprache, welche die Gewißheit, daß er da war und mich für immer begleiten würde, zur Realität machte.
Ich begegnete einer Frau in ihrem Hausgarten, die ein Beet richtete, um, wie sie sagte, Rüben anzubauen. Ich sah Bauern auf den riesigen Feldern, die paarweise oder zu viert, in einer Reihe nebeneinander, durch die daumengroßen Rübenpflanzen gingen, um sie mit einer Harke zu vereinzeln, hörte beim nächsten Hof jemanden die Sense wetzen und sah den jungen Bauern, der, ehe er zum Mähen ausholte, mich bemerkte und einen Arm zum Gruß hob; ich gehe fast täglich hier vorüber, sie kennen mich, wir begrüßen uns, oft reden wir, meistens darüber, was sie auf den Höfen oder in den Einfamilienhäusern persönlich betrifft.
Ich spürte, wie weit das, was mich betroffen machte, von ihnen weg war. Und dennoch wollte ich zu dem mähenden Bauern hingehen und ihm sagen, was mich ängstigte. Wieder gab mein Begleiter die Antwort, die ich mir selber gab: geh' nicht hin, der lebt bereits mit mir.
Am selben Tag sah ich einen Nachtfilm im Fernsehen, in dem ein Mann, der alles verloren hatte, mit der Gewißheit seines gewaltsamen Endes lebt, und glaubt, daß dies ihn dazu berechtigt, sich an denen, die ihm alles genommen haben, zu rächen. Er führt seine Rache mit einer so klaren Direktheit aus, welche die Betroffenen und seine Umgebung nicht erwarten. Und in der Euphorie seiner Endstimmung erlebt er noch ein ganz kurzes Glück, nämlich die Zuneigung und Liebe des Mädchens seines jungen, ermordeten Freundes, zu dem er, da der Junge seinem toten Sohne ähnlich war, so etwas wie Vatergefühle hatte.
Dieses kurze Glück hat die Zerbrechlichkeit der Bindungen, die außerhalb der Gesellschaft und unter dieser absoluten Endstimmung vergeblich bleiben. Aber es war eine kurze, echte Symbiose.
Auf dem Rückweg meines Morgenganges entdeckte ich den Staub auf meinen Schuhen, eine dünne, graue Schicht über dem frischgeputzten Leder, die sich mit dem Tau vermischte, als ich den Wiesenweg zwischen Feldern einschlug. Dann, wieder auf der Straße, trocknete das Gemisch, und neuer Staub legte sich darüber. Somit wendete ich mehr Aufmerksamkeit als gebührlich auf diesen Vorgang, und wie unter Zwang sah ich immer wieder auf meine Schuhe.
Vor der Haustür angekommen, faltete ich ein Papiertaschentuch auseinander und wischte sorgfältig den Staub von den Schuhen; eine Geste, den behördlichen Anweisungen und mir, nicht aber der Angst gegem'ihpr
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!