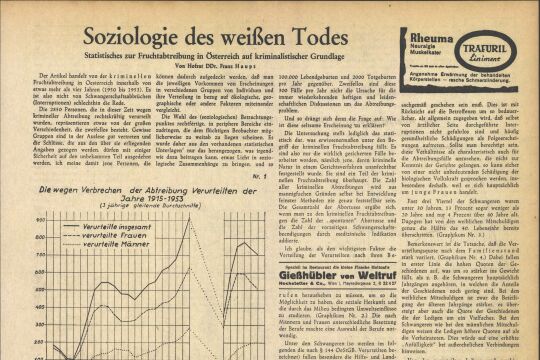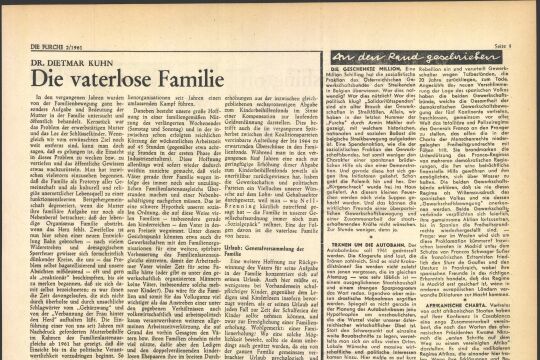Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Und das ist Gleichheit ?
Wenn heute immer wieder eine gewisse weltanschauliche Annäherung der Großparteien festgestellt wird, ist davon die Familienpolitik sicher auszunehmen. Hier bestehen nach wie vor deutliche, ja scharfe Gegensätze. Sie betreffen vor allem die Sicht und Wertung der Mehrkinderfamilie.
Aktuell wird der Streit - wieder einmal — an Hand der sogenannten Mehrkinderstaffelung. Die Volkspartei will, daß die Beihil-fenzahlungen bei großer Kinderzahl nicht nur durch einfache Multiplikation erhöht werden,sondern dann auch pro Kind, also überproportional, ansteigen. Die SPÖ lehnt eine solche Neuordnung ab. Sie verwendet dabei das schon zum sogenannten „Stehsatz” gewordene Argument, daß für sie .jedes Kind gleich” sei. Damit wird den Verfechtern der Mehrkinderstaffelung unterstellt, eine sozial nicht vertretbare Ungleichheit, also Bevorzugung bestimmter Kinder anzustreben.
Diese sehr einfache und auch ins Ohr gehende Argumentation ist freilich leicht widerlegbar, wenn man sich vom eher simplen Slogan löst und nur ein wenig in die Tiefe der Materie geht. Es beginnt schon damit, daß die Beihilfe eben nicht dem einzelnen Kind zugedacht ist, sondern den Eltern. Mit Recht heißt sie ja Familien-, nicht aber Kinderbeihilfe. Ihre Aufgabe ist nach der klaren und auch historisch nachweisbaren Absicht des Gesetzgebers, die materielle Benachteiligung derer (natürlich nur teilweise!) auszugleichen, die sich zur Pflege und Erziehung von Nachwuchs entschlossen haben.
Keinesfalls soll hingegen das Beihilfensystem eine staatliche Kinderalimentation bedeuten. Die Vorstellung, daß der Staat an die Stelle der Eltern tritt und die Kinder ernährt, mag vielleicht in gewisse ideologische Konzepte passen. In Wahrheit stellt sich die Gemeinschaft solidarisch an die Seite jener, die Erziehungskosten tragen; sie betreibt also Familien-, nicht aber Kinderpolitik.
Hier wird also die weltanschauliche Trennungslinie sehr deutlich. Der sonst in der Sozialdemokratie verfochtene Solidaritätsgedanke läßt aber im Verhältnis von Kinderlosen und Eltern sozusagen aus.
Knüpft man hier an, ergibt sich die Logik der Mehrkinderstaffelung sozusagen von selbst: Da jedes Kind — trotz Beihilfe und sonstigen Förderungsmaßnahmen — eine erhebliche verbleibende Belastung für die Eltern bedeutet, sinkt der Lebensstandard mit der steigenden Kinderzahl. Unbestrittene und exakte Erhebungen, etwa der Mikrozensus des Stati-
stischen Zentralamtes, ergeben sogar, daß sich die Zahl der Armen in unserem Land zu einem erheblichen Teil aus den Mehrkinderfamilien rekrutiert. Dabei spielt natürlich eine wesentliche Rolle, daß eine beiderseitige Erwerbstätigkeit der Eltern ab etwa drei Kindern praktisch nicht mehr vertretbar ist, was den Lebensstandard weiter schmälert. Da Letztgesagtes für kleinere Kinder im besonderen gilt, ist die sogenannte Altersstaffelung zumindest problematisch.
1 Wenn man also das Gleichheitsargument in der Familienpolitik zu Wort kommen lassen will, dann muß man es wohl in erster Linie auf die Eltern anwenden. Ihr Lebensstandard bestimmt ja letztlich auch das Wohlergehen des Kindes. Was hat das vierte Kind für eine Genugtuung aus dem Wissen, dem Staat „gleich viel wert” zu sein wie sein erstes Geschwisterkind, wenn die ganze Familie - verglichen mit einer anderen mit nur einem Kind und beiden Eltern im Erwerb - ungleich schlechter lebt?
Daß formale Gleichheit keineswegs selten erst recht zur Ungleichheit führt, muß auch den Sozialpolitikern der linken Reichshälfte klar sein. Man fragt sich daher verwundert, warum hier die sozial höchst berücksichtigungswürdige Gruppe der Mehrkinderfamilien so sehr vernachlässigt wird.
Zu denken geben mag, daß innerhalb der SPÖ familienpoli-tisch Frauenfunktionärinnen der Gewerkschaft das große Wort führen, denen zum Teil auch die persönliche Erfahrungssituation der Mehrkinderfamilien nicht zur Verfügung steht. Dies soll keineswegs ein Vorwurf sein, aber doch als Mahnung verstanden werden, die Familienpolitik nicht nur von Frauen bestimmen zu lassen, die auf Familienmütter oft mit recht scheelen Augen sehen.Sicher, die Mutter, die Familien- und Berufspflichten gemeinsam bewältigen soll, hat es besonders schwer. Das ändert aber nichts daran, daß die Hilfe der Gemeinschaft nicht gerade dort geringer werden darf, wo die persönliche Opferbereitschaft größer wird und den Kindern zuliebe auf den Beruf verzichtet werden muß.
Hat ein Ehepaar kein Kind, so ist nach einfachster Rechnung ein zweites mit vier Kindern nötig, um die Bevölkerungssubstanz zu erhalten (und damit die Zahlung künftiger Pensionen zu sichern). Es ist dies ein mathematischer Ausgleich. Daß er mit großen Unterschieden des Lebensstandards einhergeht, sollte gerade denen zu denken geben, die das Wort „Gleichheit” auf ihre Fahnen geschrieben haben.
Der Autor ist OVP-Abgeordneter zum Nationalrat.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!