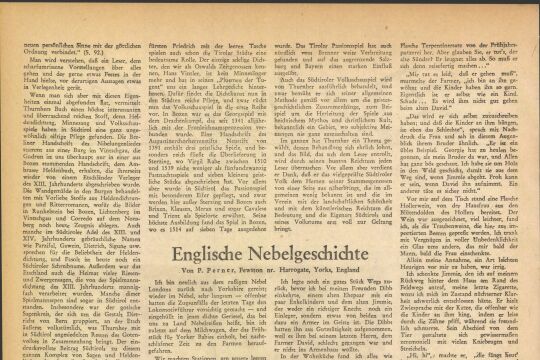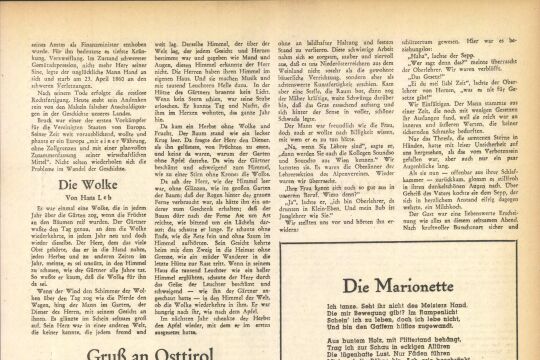Für mich klang der Name Jurij immer ein wenig sonderlich und von weit her, wie aus einer Sage, von der man nicht weiß, was daran wahr ist. Und ich beneidete meine älteren Geschwister, weil sie ihn von Angesicht kannten, mit ihm geredet hatten und sich genau vorstellen konnten, wie er aussah. Sie konnten leicht den Kopf schütteln oder lachen, wenn die Mutter von ihm erzählte.
Alles, was ich im Laufe der Jahre über ihn erfuhr, zeichnete ihn in meiner Vorstellung als einen wunderlichen Einzelgänger, der eigensinnig und allein Tür sich lebte. Er war anders als die anderen. Er machte meist das, was man nicht erwartete, war wohl gutmütig, aber mehr so wie ein Igel, der sich nur unter seiner Stachelhaut wohlfühlt. Natürlich war er unverheiratet und dachte nicht daran, seinen Stand zu ändern.
Wenn die Mutter von Jurij redete, spürte man, daß sie ihn, trotz aller Einwände und Bedenken, herzlich gern hatte. Seit dem Tod ihrer Schwester Maria, die Jurijs Mutter gewesen war, hatte sie alle Sorgen um ihn übernommen, als wäre er ihr eigener Sohn, und sie fühlte sich auch dann noch für ihn verantwortlich, als er längst ihrer Obhut entwachsen war.
Vor dem Ersten Weltkrieg hatte Jurij einige Jahre in Graz gelebt und die Tischlerei erlernt. Er muß wohl damals schon sehr fleißig und sparsam gewesen sein - Mutter hob gerade diese Eigenschaften immer mit besonderem Stolz hervor; denn als er plötzlich das Getriebe der Stadt satt bekommen hatte, konnte er sich mit seinen Ersparnissen wieder unten in der Gegend von Sladka Gora ansiedeln. Mag sein, daß das mit ein Grund dafür war, daß die Mutter so oft von ihm erzählte.
Jurij schrieb alle paar Monate einen langen Brief. Wir erfuhren so, wie es um ihn, aber besonders, wie es um seine Wirtschaft stand. Wie das Frühjahr sich gemeldet und ob der Reif den Obstbäumen geschadet habe. Wie der Wein austrieb und wie es um den Kukuruz,
um die Bohnen und um das Gemüse stand. Ob die Pfirsiche saftig wären und wieviel Schnaps er brennen würde. Wie die Kastanien und Nüsse trugen, ob die Kuh gut melke und ob der letzte Wurf der Kaninchen weiß oder schwarz oder scheckig gewesen sei.
Und immer wieder auch, oft ungeduldig und drängend, lud er uns ein, doch zu ihm zu kommen. Er würde schon recht gut auf uns schauen und die Hasen abstechen. Fett und Fleisch und Würste, auch Nüsse und Wein, hätte er genug. Wie gern wir Jurijs Einladung gefolgt wären - besonders ich, schon aus Neugier und Reiselust, und auch, um das oft Vernommene endlich wirklich kennenzulernen -, es kam doch nicht dazu. Immer gab es ein anderes Hindernis, und am Ende verlor ich schon alle Hoffnung, daß es jemals wahr würde.
Die Briefe, die Jurij an die Mutter richtete, waren in slowenischer Sprache geschrieben. Darin klang alles richtig und manchmal sogar poetisch verklärt. Nur wenn er sich an einen von uns wandte, übertrug er seine Gefühle in ein etwas wunderliches Deutsch, in dem es groß und klein durcheinanderging und alle Vokale und Konsonanten ein lustiges Eigenleben führten, als wären sie eben erst neu entstanden und kollerten, wie es ihnen gerade einfiel, direkt auf das Papier.
Einmal schickte Jurij eine Fotografie mit, auf der er selber in seinem schönsten Anzug, mit Krawatte, Weste , Uhrkette und Steirerhut, abgebildet war. Im Hintergrund war seine Keusche zu sehen, der Nußbaum und ein Stück des Weingartens, der fast so steil himmelan stieg wie das Strohdach mit den sauber geflochtenen Zöpfen an der Giebelseite. Die Mauern waren frisch gekalkt, und die winzigen Fenster glitzerten. Aus dem kleinen Schornstein,
der auf dem Stroh hockte, quollen lichte Rauchschwaden.
Das war ein friedliches Bild, sehr sonntäglich und still - beinahe zu still. Denn mir wollte scheinen, es fehlte etwas, irgend etwas Lebendiges, vielleicht nur eine Farbe oder eine Bewegung, die anders wäre. Ich spürte die Einsamkeit, die lieblose Leere, über die Jurij bisweilen klagte.
Nach dem Tod der Mutter blieben die Briefe lange Zeit aus. Es kamen auch keine Besuche mehr, die Nachricht gebracht hätten. Jurij schien ver-
schollen, weit weggerückt wie ein Vergangenes, an das man sich nur dann und wann erinnert.
Aber einmal, nach Jahren des Schweigens, steckte doch wieder eine Karte im Briefkasten. Jurij schickte Grüße und fragte, was denn mit uns los sei, warum wir uns überhaupt nicht meldeten. Er schrieb deutsch. Man merkte, daß er sich besondere Mühe gegeben hatte, nur ja keinen Fehler zu machen. Bald daraufkam ein Brief, der sehr lang und traurig war. Jurij schrieb von meiner Mutter, wie gut sie zu ihm gewesen sei, die einzige Seele, die ihn nie ganz verlassen habe. Er selbst war nun auch schon hoch in den Sechzigern. Und er lebte noch immer allein. Er war müde und fühlte sich einsamer als je zuvor. Man spürte aus seinen Worten, daß er keinen rechten Frieden hatte, daß er etwas erwartete und nicht recht sagen konnte, was es wäre.
Damals - ich weiß nicht, war es Zufall oder Fügung - fiel mir zum ersten Mal wieder die alte Fotografie in die Hände. Ich fand sie in Mutters slowenischem Gebetbuch, unter all den vergilbten Briefen und Heiligenbildern, die sie dort zwischen den Blättern aufbewahrt hatte. Und daneben lag etwas, das mich besonders ergriff: ein halb beschriebener Briefbogen mit ihrer Handschrift.
Ich verstand nicht, was die Worte bedeuteten- sie waren slowenisch - aber aus der Uberschrift merkte ich, daß sie an Jurij gerichtet waren. Das Datum war kurz vor dem Tag, an dem die Mutter von uns gegangen ist. - Als ich es las, das Datum und immer wieder die fremden Worte bis zur Stelle, an der sie, mitten im Satz, aufhörten, war mir so eigen, als würde mir eine Schuldigkeit bewußt, die zu erfüllen ich lange gesäumt hatte.
Wenige Wochen später kam wieder ein Brief von Jurij. Er schrieb, daß er ernstlich krank sei. Das Herz wolle nicht mehr richtig, er werde alle Augenblicke schwindlig, und beim Atmen steche es im Rücken. Auch im Kreuz habe er arge Schmerzen. Er müsse im Bett liegen und wisse nicht, was nun werden solle. Der Brief erschreckte mich zutiefst. Ich befürchtete das Schlimmste. Unverzüglich schrieb ich ihm eine Expreßkarte, daß ich, sobald es nur möglich wäre, zu ihm käme.
Einer meiner Brüder, der Arzt, stellt eine Auswahl von Medikamenten zusammen, die nach der Art der angege-
benen Beschwerden Linderung bringen würden. Und so machte ich mich dann auf die Reise und war, kaum eine Woche nach Erhalt des Schreibens, in Slowenien.
Von Poljcane, der Bahnstation, hatte ich noch an die zwei Stunden zu Fuß zu gehen, erst der Straße nach, dann durch die Weingärten hinauf in die Hügel. Freundliche Leute, von denen fast alle älteren ein paar Brocken deutsch sprachen, wiesen mir den Weg, luden mich auch zu einem Trunk ins Haus oder begleiteten mich eine Weile, so daß ich als-
bald, ohne einen größeren Umweg ge-' macht zu haben, vor Jurijs Keusche anlangte.
Der Schornstein über dem Strohdach rauchte. Das beruhigte mich. Irgendwer mußte sich also doch um den Kranken gekümmert haben. Auch die Haustür stand einladend offen. Zudem hörte ich von drinnen her das kratzende Geräusch eines Besens, und als ich in den dämmrigen Flur eintrat, wehte mir ein würziger Geruch von gebratenem Fleisch entgegen. Man mußte mein Kommen wahrgenommen haben, denn das Kratzen hörte auf, etwas wurde hastig zurechtgeschoben und eilige Schritte klangen aus der Stube. Zu meinem größten Erstaunen stand mir alsbald Jurij selbst gegenüber. Ich erkannte ihn sofort, obwohl er um vieles älter geworden war, als ich ihn von der Fotografie her in Erinnerung hatte.
Die Begrüßung war überschwenglich. Jurij schüttelte mir immer wieder beide Hände, ließ mich nur los, um mich zu umarmen oder auf meine Schultern zu klopfen. Er war außer sich vor Freude, weinte und wußte gar nicht, was er anstellen sollte, bis der Bratengeruch draußen auf dem Herd schon brenzlich zu werden begann. Da lief er hinaus, drehte das Fleisch um, verschwand ein paar Sekunden und kehrte, beide Hände voll, mit einem Teller aufgeschnittener Nußputizen, mit einer Flasche Wein, mit Schnaps und Gläsern wieder. Es war wohlig warm. Ich fühlte mich vom ersten Augenblick an wie daheim, vielleicht gerade deshalb, weil alles so rührend eng und ärmlich war.
Man konnte sich kaum umdrehen, ohne an eine Ecke zu stoßen. Zwischen den zwei Betten, die beiderseits an der Wand standen, war gerade Platz für den Tisch. Dann drängte schon der Backofen - die Pec - in den Raum, grün gekachelt und, wie mir schien, übermäßig groß. Er füllte gut ein Sechstel der Stube aus und war obenhin, bis zu den Balken der Decke, mit Säcken, Körben und Geschirr vollgestellt. Dazu noch die Kommode und im anderen Eck die Stellage, die so weit nach vor stand, daß die Tür gerade noch aufging.
Uber dem einen Bett hingen ein großes Kruzifix und ein Rosenkranz. Und daneben und rundum an den niedrigen Wänden waren Heiligenbilder und Fotografien in altmodischen Rahmen angebracht. Alles drängte sich aneinander.
Sogar die Fensterbretter waren dicht mit Blumenstöcken, mit Zwergrosen, Pelargonien, Fuchsien und Rosmarin, vollgestellt.
Fürs erste mußte ich einmal essen und trinken, und wieder essen. Dann aber fing das Erzählen an, hin und her, bis tief in die Nacht, als der Schirm der Petroleumlampe schon rußig wurde. Jurij war frisch und munter, als hätte ihm nie etwas gefehlt. Als ich ihn einmal zwischendurch, ein wenig verwundert, fragte, wie er seine vielen Leiden, die er ein paar Tage vorher so drastisch geschildert hatte, so schnell losgeworden sei, lachte er fröhlich auf. Er sagte, daß er, als er meine Karte las, vor lauter Freude allein schon gesund geworden sei.
Die paar Tage, die ich unter dem
Strohdach von Jurijs Keusche zubrachte, waren so fern von allem, so still und entrückt, daß es mir jetzt noch, in der Erinnerung schwer fällt, zu scheiden, was Traum und was Wirklichkeit war. Auf eine geheime Weise schien sich alles zu lösen, leicht und frei zu werden. Die Mutter war da, der Vater, die toten Geschwister und alle vorher, von denen ich nur den Namen weiß.
Das Vergangene, halb schon Vergessene, das in Gesprächen und Empfindungen aufleuchtete, war greifbar nahe und lebendig, als träte es aus einem Raum, in dem alle Dinge in unauslösch-barer Gegenwart aufbewahrt sind.
Nur einmal, als ich das Gespräch auf das Nächste zu lenken versuchte, gab es einen kleinen Mißton. Ich meinte, daß es vielleicht doch nicht ganz das Richtige sei, wenn Jurij nun, an seinen alten Tagen, so allein bliebe; daß ihm die Arbeit doch einmal zu viel würde. Und was wäre, wenn er einmal wirklich ernsthaft erkrankte, dann hätte er keinen Menschen, der ihm helfen könnte.
Jurij wurde in diesem Augenblick beinahe böse. Er fing von der Falschheit der Menschen zu reden an, daß keiner von denen, die er kannte, es ehrlich meinte. Es kämen wohl manche - eine Witwe von dort, eine andere von da, auch eine, die allein geblieben war wie er -, und sie wollten schon bei ihm leben. Aber sie hätten es allesamt nur auf seinen Besitz abgesehen, und das wäre keine wirkliche Liebe.
Es fiel mir nicht leicht, von Jurij Abschied zu nehmen. Etwas war da, als wollte es mich mit Gewalt zurückhalten. Und ich hatte von dieser Zeit an ein unruhiges Gefühl, wenn ich dachte, wie einsam es nun wieder um ihn sein würde. Es war fast wie ein Heimweh nach der Stille unter dem Strohdach, nach dem Grünen und Weiten und nach dem Menschen, der dort auf dem Hügel von Sladka Gora sein Stück Erde verteidigte. Besonders stark wurde es, wenn ich wieder einmal den Brief aus Mutters Gebetbuch in die Hände nahm, der für Jurij bestimmt und der nicht mehr zu Ende geschrieben war. Ich sah die offene Stelle, dort wo der Satz abbricht, und mir schien, als müßte ich etwas finden, um sie auszufüllen.
Aus dem demnächst im Styria Verlag, flraz, erscheinenden autobiographischen Werk von Hergouth „Der Mond im Apfelgarten"