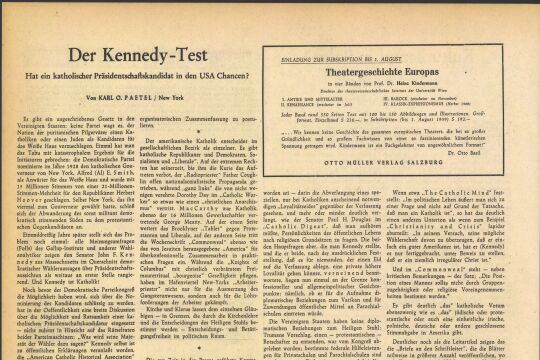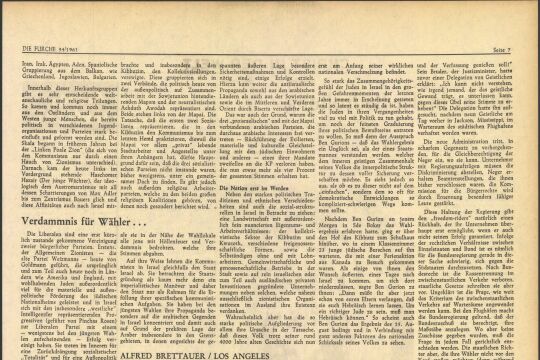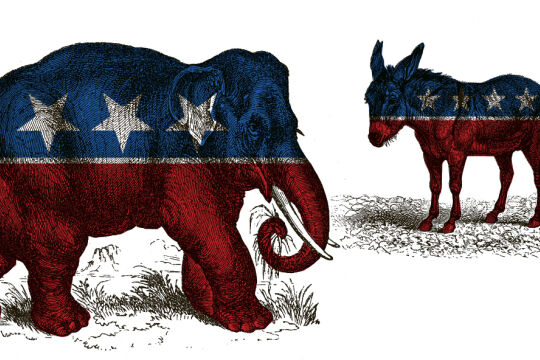USA: Frust und Rassenhaß
Die USA haben ihren Super-Haider: David Duke, 41, den blendend aussehenden Kandidaten der Republikanischen Partei für das Amt des Gouverneurs in Louisiana im tiefen Süden der USA. Duke, ein ehemaliger „Groß-Zauberer" (Grand Wizard) des rechtsextremen Ku Klux Klans und Gründer der rassistischen „Nationalen Vereinigung zur Förderung der Weißen", konnte als völliger Außenseiter bei den Wahlen am 16. November 39 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.
Die USA haben ihren Super-Haider: David Duke, 41, den blendend aussehenden Kandidaten der Republikanischen Partei für das Amt des Gouverneurs in Louisiana im tiefen Süden der USA. Duke, ein ehemaliger „Groß-Zauberer" (Grand Wizard) des rechtsextremen Ku Klux Klans und Gründer der rassistischen „Nationalen Vereinigung zur Förderung der Weißen", konnte als völliger Außenseiter bei den Wahlen am 16. November 39 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.
Dukes Gegenkandidat, der frühere Langzeit-Gouverneur Edwin W. Edwards, 62, der durch seine Spielerleidenschaft und Korruptionsaffären bekannt wurde, konnte nur mit Hilfe seiner aufgeschreckten afro-amerika-nischen Wählerschaft 61 Prozent der Stimmen gewinnen.
Auch wenn David Duke diese Wahl verloren hat, ist eine tiefe Irritation über die ganze Nation hereingebrochen, und lange vergangene rassistische Reminiszenzen aus den Zeiten der Rassentrennung und des Einflusses des Ku Klux Klans auf die Politik in einigen Bundesstaaten sind aus der Mottenkiste politischer Vorurteile hervorgekrochen. Dukes Klan- und Neo-Nazi-Vergangenheit hat nicht verhindert, von 55 Prozent aller weißen Wähler seine Stimmen zu erhalten.
David Duke spielte im Wahlkampf die Rolle des Volkshelden der kleinen Leute, erklärte sich selbst zum Führer einer neuen konservativen Mehrheit in Amerika, verglich sich in seinem Kampf gegen die etablierte politische Elite mit Boris Jelzin und sieht sich als geistigen Nachfolger von George Wallace, dem großen Populisten in der US-Politik und erbitterten Gegner der Bürgerrechtsbewegung in den sechziger Jahren. Seine Vergangenheit im militant rassistischen und anti-katholischen Ku Klux Klan sieht er als .Jugendsünde", und seit 1980 will er eine selbst von seinen Mitarbeitern bezweifelte „religiöse Bekehrung" durchgemacht haben. Der blonde und blauäugige David Duke spielt mit subtilen rassistischen Parolen, wenn er in Anspielung auf die enormen sozialen Probleme der schwarzen Bevölkerung in den USA diese „wachsende Wohlfahrts-Unterklasse" für die „Krankheiten" der großen Nation Amerikas verantwortlich macht: Durch die Einstellung der Sozialleistungen aus dem Geld der Steuerzahler seien die schwarzen Sozialschmarotzer, würde er in Österreich sagen, nicht mehr in der Lage, „ihre Drogen" und „ihre Lottoscheine" zu kaufen, und der Kriminalität wäre damit Einhalt geboten.
Louisiana ist ein ökonomisch und politisch rückständiger Staat und rangiert mit seinen Sozial- und Wirtschaftsdaten auf dem 49. Platz unter den 50 Bundesstaaten der USA. Wegen seiner politischen Korrup-tionsskandale und einer bemerkenswerten Geschichte autokratischer Politiker Wirdes gerne als die „Bananen-Republik" der USA bezeichnet. Louisiana ist eine faszinierend bunte Mischung: Die Heimat von Louis Armstrong, der starken französischsprachigen Minderheit der Cajungs, über 30 Prozent Afro-Amerikanern, mit starken katholischen und protestantisch-konservativen Gemeinden, reichen Ölvorkommen und riesigen Einkommensunterschieden. Und genau dort gewinnt Duke mit seiner eloquenten Sprache - die sehr stark an Jörg Haider erinnert - Anhänger in einer frustrierten weißen Mittelschicht, die sich wegen der in den USA strikt eingehaltenen Gesetze zur Förderung von Schwarzen („affirmative action") zurückgesetzt fühlt, und selbst von Arbeitslosigkeit und Kürzungen der Sozialleistungen bedroht ist. Dukes Antwort: „Ich bin für gleiches Recht für alle, aber niemand soll besonders behandelt werden."
Vor allem weiße Amerikaner fühlen sich durch David Duke angesprochen, der persönlich nie einem Beruf nachgekommen ist, und immer von Geldern des Klans oder seiner rassistischen „Bürgerrechtsorganisation", die eine rassische Überlegenheit der Europäer und Nazi-B ücher propagan-diert, lebte. „Irgend etwas funktioniert in unserer Regierung nicht mehr. Die Leute haben keinen Nutzen mehr davon", meint der weiße Rechtsanwalt Jim McPherson, 59, bisher treuer Parteigänger der Demokraten und jetzt Rechtsberater von David Duke. Diese Wähler haben Angst vor der Drogenplage, der Obdachlosigkeit, der steigenden Kriminalität. Und Duke verspricht „Abhilfe": „Warum sollen die Leute arbeiten wollen, wenn sie Arbeitslosengelder beziehen?"
Sowohl der blanke Rassismus als auch die Sorge um einen weiteren wirtschaftlichen Abstieg Louisianas hat die Mehrheit der Wähler in das Lager der schwachen und korrupten Alternative Edwin Edwards getrieben. Die gefährlich knappe Aussicht, einen Gouverneur in Louisiana zu haben, der sich öffentlich von Adolf Hitler beeindruckt zeigt und als Student Parties zu „Führers-Geburtstag" feierte, ließ befürchten, daß besonders das Kongreß- und Tourismusgeschäft um den Bundesstaat einen großen Bogen schlagen werde. Duke hat noch 1989, als er bereits Kongreßabgeordneter in Louisiana war, in einem Interview erklärt: „Es gibt nur noch ein einziges rein weißes Land auf dieser Erde, und das ist Island. Und Island ist nicht genug." Daher schlug er vor, daß es „ideal wäre, wenn wir eine geographische Trennung der Rassen entweder innerhalb der USA oder auf einem außerkontinentalen Gebiet erreichen könnten." Schuld am Niedergang der Weißen seien, so das vertraut klingende Vorurteil, die Juden: „Nun, die Juden haben uns diese Krankheit der Rassenmischung eingebracht. Und sie sind dabei sehr erfolgreich gewesen."
Der immerhin beachtenswerte Wahlerfolg David Dukes bringt die Republikanische Partei von Präsident Georg Bush in delikate Verlegenheit: Hat Bush gerade durch die erfolgreiche Entsendung von Clarence Thomas in den Obersten Gerichtshof eine entscheidende Karte im Poker um die afro-amerikanischen Wähler spielen können, droht die „Grand Old Party" nun in einen Strudel von Rassenvorurteilen zu geraten, die bei ihren mehrheitlich weißen und konservativen Wählern erfolgreich zu sein scheinen. Der Preis für die stetigen Kürzungen im Sozialhaushalt der USA und die an Duke erinnernde Rhetorik der einfachen Antworten durch drei konservative Regierungen in den letzten elf Jahren scheint die Angst vor neuen Rassenunruhen zu sein. Kein Wunder, daß das Weiße Haus in Washington und die nationale Parteileitung sich eilfertig bemühen, David Duke aus der „G. O. P." auszugrenzen.
Nur David Duke verkündet im landesweiten Fernsehen: „Ich bin ein Republikaner. Und der Sprecher der konservativen Mehrheit." Er wird daher höchstwahrscheinlich im nächsten Jahr als republikanischer Präsidentschaftskandidat antreten.