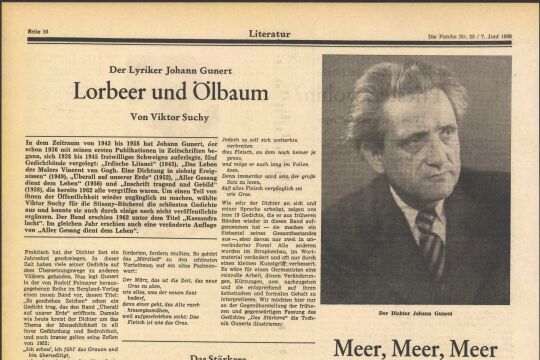Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Vergilbte Wörter
Menschen, wenn sie sterben, er-' halten einen Grabstein, Wörter nicht. Kein Friedhof, auf dem sie beigesetzt, kein Steinmetz, von dem sie in den Granit gemeißelt, keine Trauergemeinde, von der sie verabschiedet werden. „Der Worttod“, sagt der Kulturhistoriker Werner Ross, „vollzieht sich abseits, undramatisch. Neue Modewörter überschwemmen unsere Redeweise, und die von gestern gehen klaglos zum Orkus hinab.“
In den fortschrittlichen Gazetten unserer Zeit, die sich soviel
darauf zugutehalten, wortschöpferisch zu wirken, kann man immer wieder Siegesmeldungen lesen—des Inhalts, dieses oder jenes „neue“ Wort habe es geschafft, „angenommen“ zu werden, selbst der heikle Duden habe sich „beugen“ und in seiner jüngsten Neuauflage dem forschen Frischling Einlaß gewähren müssen: der „Null-Lösung“ und dem „Spon-ti“, der „Entsorgung“ und dem „Instandbesetzer“. In der Bundesrepublik Deutschland ist — mit Sitz in Wiesbaden — eine eigene „Gesellschaft für deutsche Sprache“ damit beschäftigt, dem Volk aufs Maul zu schauen und neu aufkommende Modewörter zu registrieren.
Dagegen ist nichts zu sagen, solange es — auf der anderen Seite — Sprachwächter vom Schlage Hans Weigels gibt, die darauf achten, daß die Bäume der Neu töner nicht in den Himmel wachsen — oder besser: in die Hölle, nämlich in die Hölle einer allzu unbekümmerten Sprach Verhunzung („Die Leiden der jungen Wörter“ hieß Weigels einschlägiges Buch).
Doch halten wir uns nicht mit den Neuschöpfungen auf — sie sorgen durch ihr lärmendes Wesen selber für genug Aufsehen. Gedenken wir vielmehr jener anderen, denen das gegenteilige Schicksal beschieden ist, die sich nicht wehren können, die über
keine für sie agitierende Lobby verfügen: der sterbenden und der schon gestorbenen Wörter.
Wörter sind Lebewesen, auch sie unterliegen den Darwinschen Gesetzen, die Franzosen sprechen von der „biologie des mots“. Es spricht zwar für die zunehmende Internationalisierung der Sprachwissenschaft, ist aber im Grunde doch beschämend, daß das vor einigen Jahren publizierte Lexikon der untergegangenen deutschen Wörter kein Deutscher, kein Österreicher und kein Schweizer geschrieben hat, sondern — ein Ägypter.
Nabil Osman heißt der nicht genug zu rühmende Mann. Zum Glück ist ihm seine Mühe gelohnt worden: Das Büch hat bereits die vierte Auflage erreicht. Es ist also doch nicht so, wie man zuweilen glauben möchte, daß die deutsche Sprache bereits zum allgemeinen Abschuß freigegeben ist.
Einer der ranghöchsten österreichischen Politiker hat einmal in einem Interview gesagt, er habe einen „Horror vor schönen Sätzen“ — und damit selber einen wahren Horrorsatz geprägt. Wahrscheinlich hätte er auch für Rettungsversuche im Bereich der gefährdeten Wörter nur ein verächtliches Lächeln übrig.
Zum Glück hat niemand auf ihn gehört: Das Gros der Schriftsteller tut unbeirrt das eine wie das andere — schöne Sätze formulieren und schöne alte Wörter vorm endgültigen Untergang bewahren. In Jutta Schüttings Buch „Am Morgen vor der Reise“, sagt das Kind Stephan zu seiner Tante (die Lehrerin ist):
„Laß deine Schulkinder Wörter wie .arglos', .anmutig', .sorgsam', .ungehörig', .zaghaft', .behutsam' und .wohlerzogen' (nur noch der Großvater gebraucht sie) recht oft in Ubungssätzen verwenden, vielleicht sterben sie dann doch nicht aus.“ Und es fährt fort: „Deine Schulkinder werden sie anderen Kindern und ihren Kindern weiterschenken, und dann werden diese Wörter wie vom
Aussterben bedrohte und deshalb eine Zeitlang in einer Reservation gehaltene wilde Tiere auch in freier Rede wieder leben.“
Es ist gut, zu wissen, daß unsere staatlich bestellten Wörterwärter keine Killertypen sind; von einer unter ihnen (Üniversitätsprofes-sor Maria Hornung, der Mitherausgeberin des „österreichischen Wörterbuches“) habe ich mir schildern lassen, wie es bei derlei Begräbnissen zugehe: wie um jedes noch so veraltete Wort gerungen werde, wie man in Marathonkonferenzen von bis zu zwölf Stunden Dauer über Leben und Sterben der Moribunden sitze.
Wie sonst soll auch gewährleistet sein, daß man Autoren des 19. Jahrhunderts wie Marie von Eb-ner-Eschenbach oder Johann Nestroy heute noch lesen und Wort für Wort begreifen kann?
Hier ein paar Beispiele „umstrittener“ Wörter, um die hierzulande in jüngster Zeit gerungen worden ist:
Ist das „Unband“, das ungebärdige Kind aus den moralisierenden Tischzuchtreden der einstigen Töchterschulen, noch zu retten? Lohnt es sich, für den „Untern“ zu kämpfen, den längst überall die „Jause“ abgelöst hat? Gehören „Damspiel“ und „Kolli“ zum alten Eisen? Wird „blank“ noch im Sinne von „ohne Mantel“ verstanden? Ist das altvaterische „Tippfräulein“ vielleicht sogar diskriminierend?
Im „österreichischen Wörterbuch“ gibt's zum Glück Abstufungen: das Sternzeichen, das für „wenig gebräuchlich“ bzw. „ungebräuchlich“ und das Kreuzzeichen, das für „veraltet“ steht. Erst, wenn auch keines dieser beiden mehr zu verantworten ist, entschließt man sich zum gnadenlosen „Deleatur“, zum radikalen Hinauswurf des Todeskandidaten aus der nächsten Auflage.
Denn jeder der Beteiligten weiß: Es wird ein stilles Begräbnis sein. Ohne Totenschein. Und ohne Chance auf Wiederkehr.
Poesie gegen Funktionalismus
Vor vier Jähren Wurde das neue Museum am Abteiberg in Mönchengladbach eröffnet, ein Werk des österreichischen Architekten Hans Hollein, der eine Collage der Gegensätze schaffen wollte: ein Schauhaus und zugleich eine Werkhalle, funktionsgerechte Gebrauchsarchitektur, allerdings mit Poesie und Spielfreude inszeniert.
Ein Buch des deutschen Autors Wolfgang Pehnt schildert die Entstehungsgeschichte des Bauwerks, analysiert Holleins Formenrepertoire und zeigt Zusammenhänge mit der Wiener Baukunst der Jahrhundertwende. GS HANS HOLLEIN. MUSEUM IN MÖNCHENGLADBACH. Von Wolfgang Pehnt. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt 1986. 96 Seiten, öS 76,50.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!