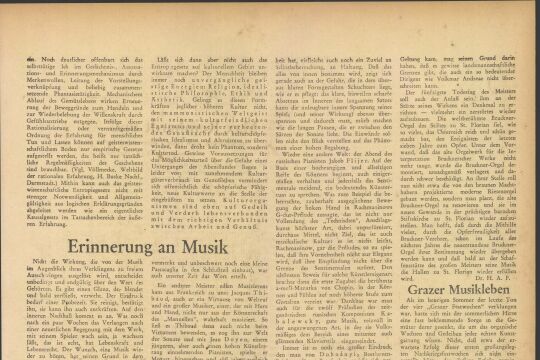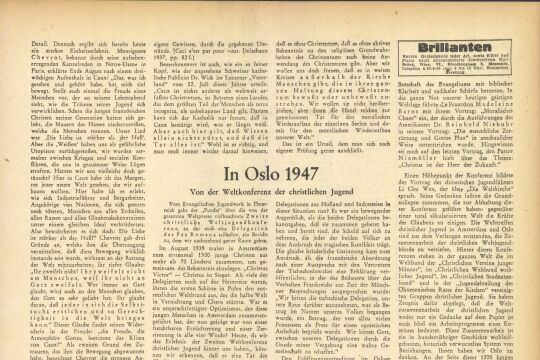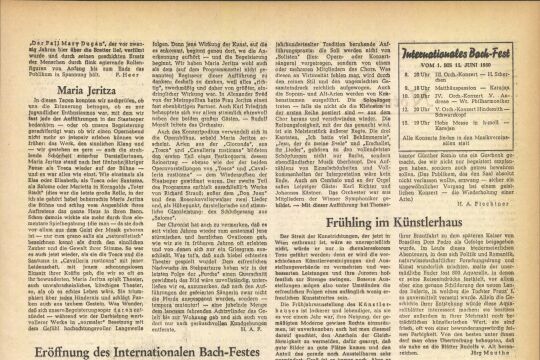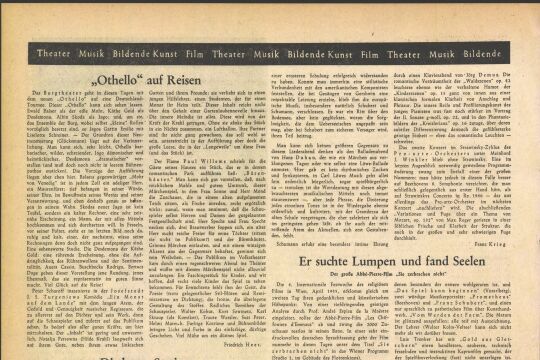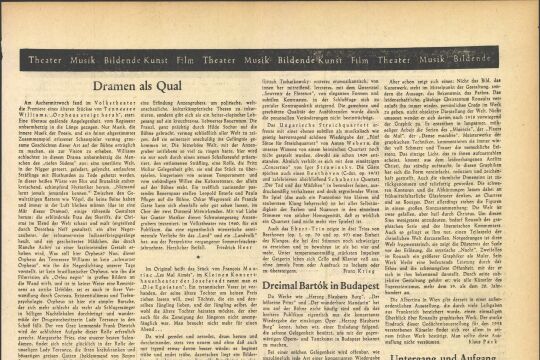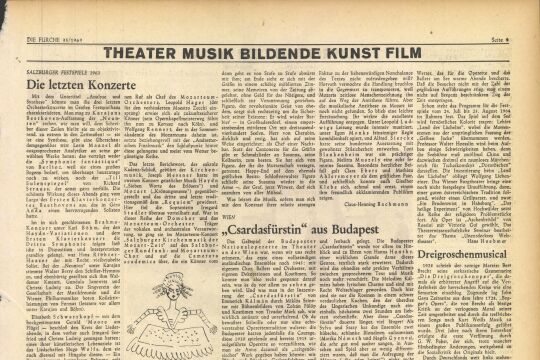Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Verlangen ohne Sattigung
Man kann ein bißchen süchtig werden auf diesen klappernden Seria-Me-chanismus mit den vertrackten Koloratur-Arien und der sterotypen Dreiteiligkeit: Allegro-Adagio-Allegro, oder auch einmal: Adagio-Andan-te-Adagio. Das Oratorium „Betulia li-berata“ des 15jährigen Mozart, Finale der Mozartwoche 1978“ im Großen Salzburger Festspielhaus, unterscheidet sich nur durch die Aufführungsform, nicht im Stil und im musikalischen Aufbau von einer Opera seria.
Es muß einmal ausgesprochen werden, gerade wegen des erlesenen Beifalls, der diesen akademisch-künstlerischen Taten zumal in Salzburg sicher ist („II sogno di Scipione“, die Huldigungsoper für Graf Colloredo, steht auf dem Programm für 1979): Mit keinem dieser Stücke wird ein Bedürfnis der Hörer von heute wirklich befriedigt; was in ihnen geschieht, berührt uns überhaupt nicht, aber - es hat schon den heranwachsenden Knaben Mozart nicht sehr berührt. Er hat für den Tag aus gegebenem Anlaß komponiert (Auftraggeber der „Betulia li-berata“ war ein Edler aus Padua mit dem blumigen Namen Don Giuseppe Ximenes de Principi d'Aragona) und ist dabei immer unmerklich über den Tag hinausgelangt. Das ist der in fast jedes Mozart-Frühwerk eingelassene „Widerspruch“, der das Verlangen nach immer Neuem weckt. Es bleibt sozusagen jedesmal ein unaufgelöster Rest, der daraus entsteht, daß die Musik sich über den weitgehend austauschbaren, nur als Material dienenden Text erhebt; daß sie uns das Geschehen durch ihre Empfindungstiefe und psychologische Fundierung nahebringt, aber eben doch nicht nahe genug: man wartet auf das nächste Werk...
„Betulia liberata“ ist biblisch-apokryphen Ursprungs und handelt von der Befreiungstat der jüdischen Idealfigur Judith; die Stadt Bethulien war von dem Assyrer Holofernes belagert, den Metastasios Text ausspart. Dieser Text, nebenbei, ist insgesamt mehr als dreißigmal vertont worden. Der Chor hat in syllabischer, das heißt, Sübe für Silbe betonender Deklamation Ausdrucksvolles mitzuteilen; ein Mozart-Biograph aus der DDR, Fritz Hennenberg, sieht darin „gleichsam die Stimme des Volkes“, doch das ist eine Interpretation aus heutiger Sicht. Der Wechsel von Soli und Chorsätzen im Oratorium war ein formales, kein inhaltliches Moment; die Anführer des Volkes waren, dem Kunstgeschmack der Edlen entsprechend, Kastraten. Wesentlicher ist, daß Mozart alles Indirekte, ihn wenig Berührende so komponiert hat, als ginge es ihn etwas an; er konnte gar nicht anders als „sich aussprechen“ - sonst wäre er nicht Mozart gewesen. Und er blieb dennoch vollkommen in den Schemata seiner Zeit.
Für Wiederholungen, für che Wiederkehr des beinahe Gleichen in anderer Beleuchtung, sind unsere Sinne mittlerweile wieder geschärft. Die moderne Kunst (nicht nur die Musik, auch die iterative Malerei) hat in diesem Sinn einige Zeichen gesetzt. Aber auf die Beleuchtung kommt es nachdrücklich an: und da ist nun die Feststellung unumgänglich, daß die Aufführung der „Betulia liberata“ mit dem Mozarteum-Orchester unter Leopold Hager (und dem klangschön agierenden Salzburger Kammerchor, Einstudierung: Rupert Huber) insgesamt nicht den gleichen Rang, nicht die gleiche Präzision und Ausgewogenheit hatte wie in den vergangenen Jahren die Opera-seria-Produktionen. Unter den Sängern beispielsweise (es gibt drei große, eine kleine und zwei winzige, nervenbelastende Partien) konnten nur Ileana Cotrubas und Peter Schreier eine innere Beziehung zur Komposition deutlich machen.
So bleiben im Gedächtnis als Ausnahme-Ereignisse der Mozartwoche 1978 haften (siehe FURCHE Nr. 5): das Auftreten von Margaret Price, der Liederabend von Peter Schreier und ein Konzert der Wiener Philharmoniker, am Pult und vom Klavier aus geleitet von Andre Previn. Bei ihm, einem Mozart-„Neuling“ zumindest in Salzburg, herrschten Spannung und Eleganz, Esprit und Espressivo; glutvoller, sinnlicher hat man die „Linzer Symphonie“ (C-Dur, KV 425) gewiß nie gehört. Klangfarben waren der Strukturierung, der Themen-Durchbildung dienstbar gemacht, wie man es sonst nur von der Moderne kennt. Auch im c-Moll-Konzert KV 491 blieb Previn bei allem pianistischen Nuancenreichtum Takt für Takt dem Orchester gegenüber präsent; es war, als spielte er auf zwei Instrumenten, eben auf dem Steinway und auf der „Klaviatur“ der (ihm offensichtlich mitgerissen folgenden) Philharmoniker - und führte so einen Dialog mit sich selbst: das Werk geriet zur bruchlosen klingenden Einheit. In solchen Darstellungen werden die vertrauten „Meisterwerke“ im Wortsinn neue Musik, Musik unserer Gegenwart. Läßt sich schönerer Dienst an Mozart und am Publikum denken?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!