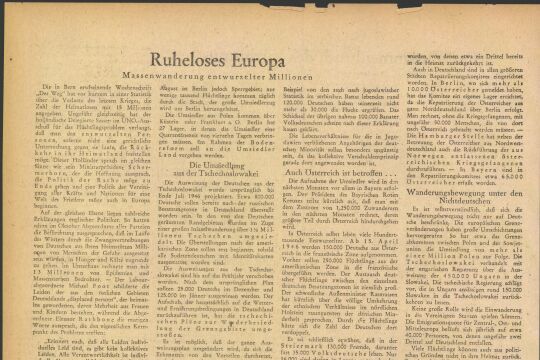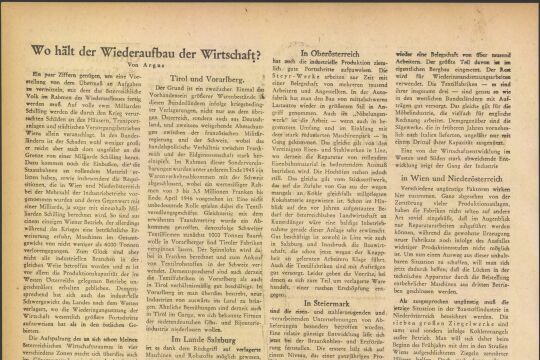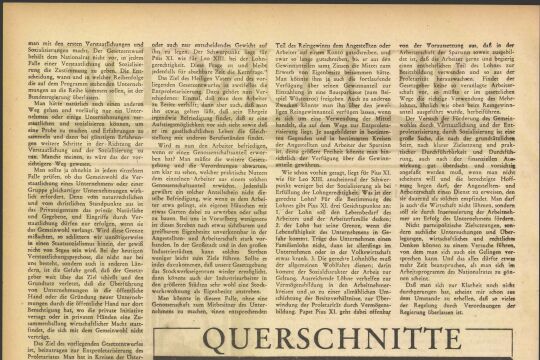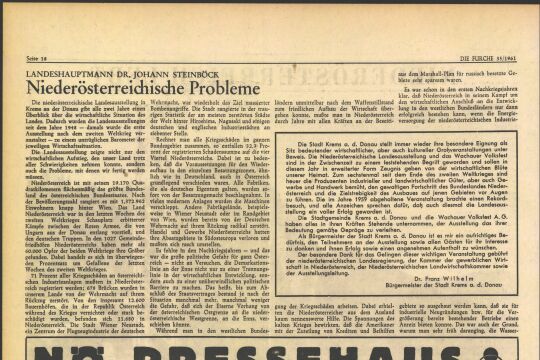Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Vier Hüngerjahre nach Stunde Null
Von den Problemen eines Landes ohne Post und Telefon, ohne Treibstoff, ohne Arbeitskräfte erzählt Harry Slapnicka in einem soeben erschienenen zeitgeschichtlichen Buch.
Von den Problemen eines Landes ohne Post und Telefon, ohne Treibstoff, ohne Arbeitskräfte erzählt Harry Slapnicka in einem soeben erschienenen zeitgeschichtlichen Buch.
Volle vier Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges leiden die Oberösterreicher, soweit sie nicht dem landwirtschaftlichen Bereich zugehörig sind, Hunger. Das ist übrigens fast genausolang wie nach dem Ersten Weltkrieg. Und trotzdem sind die Voraussetzungen, die Gründe dieses Hungers zum Teü recht unterschiedlich: Nach dem Ersten Weltkrieg mußten sich die Oberösterreicher selbst helfen — ohne wesentliche Hüfe von außen. Das Land hatte vor allem rasch seine eigene Landwirtschaft auf den Stand der Vorkriegszeit zu bringen. Das war aber 1918 vorerst deshalb schwieriger, weü der Winter unmittelbar bevorstand. Und es war anschließend deshalb eher leichter, weil die zahlreichen Kriegsgefangenen unerwartet rasch das Land verließen und noch zahlreiche oberösterreichische Kriegsgefangene außer Landes waren und nicht ernährt werden mußten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es vorerst den Vorteü, daß der Krieg Anfang Mai zu Ende geht; man hat also Zeit, sich vor dem Winter so halbwegs einzurichten, nachdem der Bombenkrieg, fast ausnahmslos in den Städten, gewaltige Verwüstungen angerichtet hatte. Es ist jetzt etwas leichter als 1918/19, den Anschluß an die Ernte 1945 zu finden. Dazu kommt entscheidende Hilfe von der amerikanischen Besatzimgsmacht gerade auf dem Verpflegungssektor. Diese US-Hilfe kann allerdings kaum den Nachteil ausgleichen, daß der Einwohnerstand Oberösterreichs fast das Doppelte des Jahres 1938 ausmacht — wobei rund die Hälfte der 1945 anwesenden Nicht-Österreicher aus deutschen Bombenflüchtlingen, Heimatvertriebenen und Flüchtlingen aus Ostmitteleuropa besteht und die andere aus sogenannten „Displaced persons“ (Versetzte Personen), also einstigen Kriegsgefangenen, „Fremdarbeitern“ und KZ-Insassen, aber auch aus deutschen Kriegsgefangenen. Und sie alle drängen sich zumindest ab August 1945 in der amerikanischen Besatzungszone, also im Oberösterreich südlich der Donau, zusammen.
Nördlich der Donau, im anfänglich teilweise, aber ab 1. August 1945 zur Gänze von sowjetischen Truppen besetzten Mühlviertel, ähnelte die Situation von 1945 der von 1918/19: weit weniger Flüchtlinge, die übrigens das Gebiet sehr bald verlassen, aber auch keine Hilfe von Seiten der Besatzungsmacht - anfänglich eher das Gegenteil, so daß diese Besatzungsmacht aus Vorräten und Erträgnissen des Landes verpflegt werden muß. Hier, nördlich der Donau, sind die Österreicher im wesentlichen auf sich selbst angewiesen, und die bescheidenere Urbanisierung des Landes vereinfacht das Problem. Mehr noch: Bezirke nördlich der Donau, wie etwa Rohrbach, helfen anfänglich Notgebieten südlich der Donau, wie etwa dem Bezirk Gmunden.
Die durch sechs Jahre praktizierte Lebensmittelrationierung hat es der Stadtbevölkerung praktisch unmöglich gemacht, auch nur bescheidene Reserven in
den Privathaushalten anzulegen. Später wird erklärt — sicherlich über den Daumen gepeilt —, daß in den ersten sechs Nachkriegswochen der Bevölkerung je Kopf Lebensmittel zu 600 Kalorien täglich zustanden bzw. zugeteilt wurden.
Vorerst muß sich die Bevölkerung recht und schlecht behelf en. So gibt es bis Kriegsende in Linz 22 Lebensmittelgeschäfte, nach Schließung sämtlicher Geschäfte in Linz für rund eine Woche um den 5. Mai 1945 öffnen nur noch wenige dieser Lebensmittelläden. Zum Teil behilft man sich mit „Gemeinschaftsküchen“; nach Kriegsende gibt es davon in Linz 19, ab 20. Juni 1945 sind es 40, in denen nicht nur das Mittagessen, sondern auch das Frühstück und Abendessen ausgegeben wird.
Es gilt aber nicht nur, die Lebensmittel aufzubringen und möglichst gerecht zu verteilen. Es gilt gleichermaßen, die Lebensmittelpreise stabil zu erhalten. Der noch bis 1949 bestehende damals übliche graue und schwarze Markt zeigt, daß dies nur teilweise geglückt ist.
Behindert wird die ganze im Aufbau befindliche Verwaltung dadurch, daß es keinen Brief- und Telefonverkehr gibt; man muß sich vorerst mit Kurieren behel-fen. Dann ist es angesichts des Kommens und Gehens von Flüchtlingen, Gefangenen, Heimkehrern schwer, konkrete Zahlen der zu Ernährenden zu erhalten. Auf den Bauernhöfen gibt es eine Unzahl „unkontrollierbarer Kostgänger“, die mitessen und nur selten arbeiten. Die Sicherheitsverhältnisse sind besonders im Bannkreis der Städte katastrophal.
Jeder versucht sich so gut wie möglich zu helfen, durch Verwandte auf dem Land, durch das Halten von Hühnern und Kaninchen in der Stadt. Wäschewaschen und andere Dienste bei Soldaten und Dienststellen der Besatzungsmächte werden meist nicht bezahlt, sondern durch Lebensmittel oder Zigaretten abgegolten. Diese erst sehr beschränkt funktionierende Wirtschaft, hinter deren Reglementierung allerdings keine drastische Strafandrohung bis hin zur Todesstrafe, wie in der NS-Zeit, mehr steht, braucht Ventile, und ein solches, immer wieder angeprangertes ist der Schwarzmarkt. So wird auf dem Linzer Hauptplatz von Zigaretten bis zu Hosenträgern fast alles „schwarz“ angeboten.
Aus: Harry Slapnicka, „Oberösterreich — zweigeteiltes Land 1945-1955“, Landesverlag, Linz 1986. 336 Seiten, 37 Fotos, Karten, Kt., öS 398,-.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!