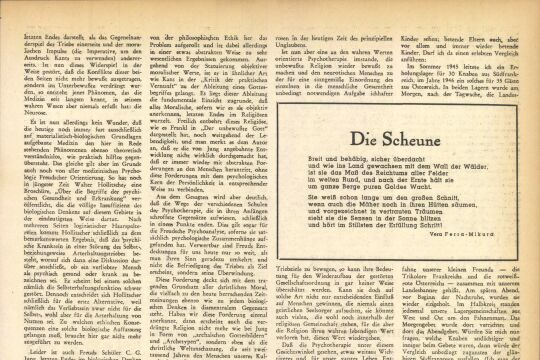Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Von der Fremde oder „ich kann überall hungern"
„Fremd ist der Fremde nur in der Fremde." (Karl Valentin)
Es gehört zum Charakteristischen menschlicher Existenz, sich auf dieser Welt unbehaust und heimatlos, also „fremd" zu fühlen. „Ein Fremder bin ich auf Erden...", lesen wir schon in den Psalmen. „Fremd bin ich eingezogen", singt Schubert, „fremd zieh ich wieder aus." Unzählige literarische Beispiele bezeugen diese exi-stenzielle Unsicherheit.
Anderereits schaffen wir uns ein Zuhause, eine Heimat, mit festem Zaun und tausend Versicherungen, als gälte es, sich für die Ewigkeit hier einzurichten. Das Wissen um existen-zielle Vorläufigkeit bedingt offenbar unsere hartnäckigen Versuche, ihr zu entgehen, und führt diese gleichzeitig ad absurdum. Mit dem Kopf im Sand hofft offenbar nicht nur der Vogel Strauß zu überleben.
Aus dem Bewußtsein der Unbehaustheit resultieren Haltungen verschiedenster Qualität. Da ist die Qual nicht nur des Intellektuellen mit der ewigen Frage: Wer sind wir, woher kommen wir, wohin gehen wir? Optisch am schönsten hat sie Paul Gauguin in dem gleichnamigen Bild dargestellt. Vom sich bedeckt haltenden intellektuellen Agnostiker bis zum
Mann aus dem Volk - „Wos waaß a Fremder? Nix is fix!" - reicht die Palette unbefriedigender Antworten. Erasmus von Rotterdam meinte „Ubi bibliotheca ibi patria!" und flüchtete damit in eine geistige Heimat. Ein altrömisches Dictum setzt die Heimat dort fest, wo es einem gut geht, und bei Brecht lesen wir: „Herr K. hielt es nicht für nötig, in einem bestimmten Lande zu leben. Er sagte: Ich kann überall hungern." Kürzlich meldete der ORF, daß 600 Männer aus Sarajewo flüchten wollten: ob in der Stadt verhungern oder auf der Flucht erschossen werden - sterben könnten sie überall.
Der sich gegen alle Unsicherheit absichernde, eine Heimat schaffende Mensch tendiert seit eh und je dazu, Verunsicherungen und Gefährdungen fernzuhalten. Nach den Griechen der Antike wurden die Fremden schlechthin zu „Barbaren", und barbarisch wurden sie bis zum heutigen Tag auch immer wieder behandelt. Das römische Wort „hostis" bezeichnet gleichermaßen den Fremden wie den Feind. .Unser Wort „Elend" meint ursprünglich „ausgewiesen", in fremdem Land" (ahd. „elilenti") sein- Wer aus seinem Land ausgewiesen ist, in fremdem Land sein muß, befindet sich im Elend. Wir erleben täglich die
Bestätigung.
Auf unser Fremdsein gibt es aber auch eine religiöse Antwort. Sie verweist auf eine Heimat ohne Grenzpfähle, auf unsere Geborgenheit in Gott. Was aber diese Welt betrifft, sind wir, selbst Fremde, angehalten, im Fremden den Bruder zu sehen. „Übt Gastfreundschaft gegeneinander ohne Murren!" mahnt Petrus, und Paulus schreibt an die Hebräer: „Die Gastfreundschaft vergeßt nicht. Durch sie haben ja manche, ohne es zu wissen, Engel beherbergt." Auch Phile-mon und Baucis könnte man befragen. 2000 Jahre Christentum sind offenbar eine zu kurze Zeit, um keine Unterschiede bei Fremden zu machen.
So kommt es, daß uns der zahlungskräftige Fremde willkommen ist. Auch in großer Zahl. Auch mit Eigenwilligkeiten und Unarten. Wir sind diesbezüglich tolerant, bis zur Anbiederung und Selbstverleugnung. Ich wurde zum Beispiel in einem westlichen Bundesland einmal angepöbelt, als ich mich an der Liftkasse weigerte, Retourgeld in der (ach, so geschätzten!) ausländischen Währung entgegenzunehmen. Im Gasthof bekam ich
- Palatschinken habe man leider nicht
- „Omelette süß" angeboten. Da auch ich meine toleranten Seiten habe, zumal bei Appetit, schmeckte mir dieses wie Palatschinken. Seit jenem Erlebnis liebe ich übrigens Erdäpfel, Paradeiser und Schlagobers, während ich den Geschmack von Kartoffeln, Tomaten und Sahne skeptisch beurteile. Wo von einer einheimischen Wirtin mit „Tach!" und „Tschüß!" gegrüßt oder verabschiedet wird, kehre ich nicht ein. So schön können An-, Ein- und Ausblick gar nicht sein. Ich mag einfach Bodenständiges wie Farkas und Figl, Kafka, Küng, Matej-ka oder Mergl und finde Namen wie BusekoderBamhackl, Slavik, Sengst-bratl, Zumtobel und Zilk gleichermaßen schön.
Der mittellose Fremde dagegen ist uns nicht willkommen. Grundsätzlich. Allenfalls in kleiner Zahl, ganz nach unserem wirtschaftlichen oder seelischen Bedürfnis. Zumal er zweifellos Eigenarten aufweist, die uns fremd sind, Unarten, über die man sich nicht einfach hinwegsetzen kann. Im Park dürfen allenfalls Hunde. Selbstverständlich. Apropos Park, dazu fällt mir Bank ein. Auf Parkbänken durften eine gräßliche Zeit lang ausschließlich „wir" sitzen. Ein tödliches Mißverständnis.
An unserer Schule gibt es keine Fremdenproblematik. Die Fremden, die wir haben, zahlen ihr Schulgeld und das in der Fremde übliche Lehrgeld. Die anderen Fremden, die wir auch haben, zahlen nur Lehrgeld, allerdings ein höheres: meist völlig sprachunkundig und mittellos, sind sie in jeder Hinsicht von irgend etwas oder irgend jemandem abhängig. Unsere fremden Kinder wohnen groß-teils'bei Eltern unserer Kinder. Sie erhalten außerhalb des Unterrichts von einzelnen Engagierten Deutschstunden: einer Lehrerin, einer Klosterfrau, einem Rechtsanwalt.
Die Familie eines Schulwarts, dem ich täglich begegne, beherbergt seit knapp einem Jahr eine vierköpfige Flüchtlingsfamilie. Neun Personen leben in sehr beengten Verhältnissen. Die Gastfreundschaft war für Weihnachten 1991 gedacht. Vielleicht in Erinnerung an andere Herbergsuchen-de. Aber noch will jene niemand haben. Noch immer gibt es keine Arbeitsbewilligung. Noch immer können sie nicht in ihre Heimat zurück, und noch immer können sie bleiben. Ich habe von der Aufnahme dieser Flüchtlingsfamilie im Spätherbst 1991 gewußt. Daß es sie noch immer gibt, habe ich in der Zeitung gelesen. Nun weiß ich, was Verdrängung ist.
Weihnachten steht vor der Türe. Ein schönes Fest. Ein entfremdetes Fest. Am 24. Dezember dürften heuer besonders viele warten, draußen vor der Tür.
Der Autor ist Direktor des Gymnasiums des Institutes Sacre Coeur in Preßbaum.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!