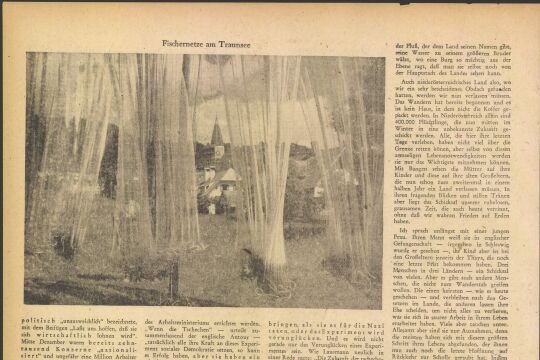Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„VON WEITEM IST AUCH DER ZIGEUNER EIN MENSCH"
Bis der erste Schnee fällt, bleibt Jöz-sef Koltay, der Schäfer, mit seiner Herde in den Bergen. Dann steigt er hinab ins Tal. Über die Wintermonate zieht er sich in der kleinen siebenbiir-gischen Landgemeinde Joseni zurück. Zwei Häuser, mehrere Stallungen und einige dutzend Hektar Land nennt er sein Eigentum.
Doch die Leute sagen, er sei nur so reich, weil er so geizig sei und sich mit dem „Zigeunerpack" einlasse. Oben in den Bergen, was er da alles treibe... Die wildesten Gerüchte geistern unter den Bauern. Für sie ist Jözsef Koltay ein Fremder, obwohl er in Joseni zur Welt kam und in seinem Leben nie weiter als nach Miercurea-Ciuc, der 70 Kilometer entfernten Kreisstadt, reiste. Und dies auch nur dreimal in seinem Leben.
Sein Verhängnis: Sein Vater hatte sich einst mit einem Roma-Mädchen eingelassen. Aber nicht mit einem aus dem Dorf, sondern aus dem fernen Bukarest. Mit einer Rumänin, einer orthodox Gläubigen, wie die Leute sagen. Für die Szeklerländler Ungarn zuviel des Guten. Die ungarischen Bauern, die in dieser gegen Siebenbürgens in einem geschlossenen Siedlungsgebiet leben, mögen keine rumänischen Mitbürger, erst recht keine Roma und niemanden, der sich nicht zum katholischen Glauben bekennt.
Auf dem Plateau des Hargita-Hü-gellandes ist jedoch die andere Welt des Schäfers Koltay. Dort sind er und Dutzende Roma-Großfamilien unter sich. Keine Landkarte vermerkt die armseligen Hütten-Siedlungen, kein Wanderweg führt hier herauf. Es gibt keine Schule, keine ärztliche Versorgung, kein Stromnetz, keine Wasserleitungen. Selbst ein Radiogerät besitzen nur die wenigsten Familien. Auch Jözsefs Kinder können weder lesen noch schreiben. Sein ältester Sohn, 14, sei ein ausgezeichneter Hirte und Experte im Erschließen wilder Wasserquellen, prahlt sein Vater, „aber viel von der Welt wird er wohl nicht sehen, wo soll ein Roma schon hin?"
Untereinander spricht man ein Kauderwelsch aus rumänisch, ungarisch und romanes, ein Idiom, mit dem man sich nur im engsten Kreis verständigen kann. Nicht nur deshalb meidet man die rumänische Gesellschaft. Außer Jözsef Koltay hält kaum einer Kontakte „nach draußen", wie die Roma sagen. Der 35jährige Schäfer, der mit seinen Zahnlücken und seinem krausen Gesicht bereits wie ein 60jäh-riger Großvater ausschaut, fungiert wie ein Kurier zur Außenwelt. Ein-, zweimal im Monat schleppt er mit seinem Sohn und einem Freund Käse, Wolle, Wildbeermarmelade, Weidenkörbe, Holzschnitzereien und ein paar junge Schafe zur staatlichen Ankaufstelle nach Gheorgheni, dem nächstgelegenen Städtchen.
Niemand fragt ihn, woher die Ware kommt, mit wem er den Verdienst teilen wird. „Die wollen nichts über uns wissen, uns ist's recht." Schon im kommunistischen Ceausescu-Regime hat man sich um die Ausgestoßenen in den Bergen wenig gekümmert, seit der Wende erst recht nicht. So untersuchen nicht einmal Soziologen, wie viele Menschen heute ohne Schulbildung, Krankenversicherung, selbst ohne Geburtsurkunde im Lande leben. Gheorge Raducanu, Vorsitzender der „Sozialdemokratischen Partei der Roma" (Seite 11) schätzt, daß Zehntausende „Nichtseßhafte" so ihrem Schicksal überlassen seien.
Ion lebt schon seit zwölf Jahren, wie er erzählt, als Nomade. Er stammt aus einem Dorf in der Nähe des Schwarzmeerhafens Konstanta. Seinen Entschluß, „aus der rumänischen Gesellschaft zu flüchten", habe er als 17jähriger gefaßt. Damals, im tiefsten Winter, sei seine Mutter mit seiner Schwester und ihm bettelnd von Haus zu Haus gezogen auf der Suche nach Nahrungsmitteln. Endlich habe sich ein Bauer freundlich gezeigt. Er sagte: „Gerade habe ich zwei Hasen geschlachtet, den einen könnt ihr mitnehmen." Zu spät habe seine Familie herausgefunden, daß der Hase der Maul- und Klauenseuche erlegen, das Fleisch pures Gift gewesen sei. Ioans Mutter hatte schweren Durchfall bekommen, seine Schwester war nach tagelangem Fieber gestorben.
, Als die Ärzte diagnostizierten, daß meine Schwester infolge einer Lebensmittelvergiftung gestorben war, da stand für mich fest, in dieser Welt wirst du nicht mehr leben."
Es gibt kaum jemanden in der Berggemeinschaft, der nicht ähnliche Geschichten erzählen kann - und sie auch seinen Kindern einbleut. Mißtrauen und Angst sitzen tief, selbst untereinander. „Zum Glück gibt es unter uns nie einen Anlaß zur Blutrache, wir konnten ernste Konflikte stets aus dem Weg räumen", erläutert Jözsef Koltay, „denn das Leben hier ist verdammt hart, sodaß immer wieder jemand durchdreht."
Schon die Hütten aus Brettern und Wellblech sprechen für sich. Sie sind wie Zelte konstruiert und so eng, daß man sich darin überhaupt nicht bewegen kann. Eine Familie mit zwei, drei Kindern muß auf wenigen Quadratmetern Platz finden. In einem „Vorzimmer" befindet sich eine Herdstelle, Kleider- und Vorratskisten stapeln sich übereinander. Jede Ecke ist vollgestopft. Fenster gibt es nicht. Die Hütten werden ausschließlich als Schlafstätten genützt. Schon die Kleinsten sind den ganzen Tag über im Freien. Schlecht gekleidet, meist nur mit Maisbrei im Magen.
Alle verdingen sich als Hirten. Angeblich eine lukrative Beschäftigung, behaupten die Männer und zeigen stolz ihre Schafe vor. Drei Herden von je achtzig bis hundert Tieren, das bringe im Jahr genug Geld ein -mehr als man sonst verdienen könne. Manch eine Bauernfamilie im Tal stehe finanziell schlechter da als sie. Die Gegenfrage, ob man dieses harte und gesundheitlich schädliche Leben wirklich mit einem normalen Dorfleben vergleichen könne, wird immer gleich beantwortet: „Wir sind doch nicht freiwillig hierher gekommen. Aber wenigstens tut uns hier niemand mehr etwas an."
Obwohl sie keine Zeitungen lesen, wissen Jözsef und seine Freunde von den Dutzenden pogromartigen Zwischenfällen, die es in den letzten Jahren in Rumänien gegeben hat. Sie kennen die Geschichte aus Kogalni-ceanu, als wären sie selbst Augenzeugen des Vorfalls gewesen, als eine Gruppe von 400 bis 500 Dorfbewohnern mit Knüppeln und Moloto wcock-tails bewaffnet die Romasiedlung am Rande des Dorfes in Brand setzte.
Für sie ist Bolintin, ein Dorf bei Bukarest, ein Begriff, wo alle Hütten zerstört wurden als Rache für einen jungen Roma, der im betrunkenen Zustand dem Studenten Constantin Melinte die Kehle durchgeschnitten hatte (ein ähnlich gelagerter Fall in Mähren - FURCHE 4671991 - hatte vor zwei Jahren die damalige CSFR-Öffentlichkeit schwer erregt). Für die örtliche Polizei eine Selbstjustiz, die wohlwollend geduldet wurde.
Die Roma von Joseni haben aber auch nicht die pogromartigen Zwischenfälle zwischen Ungarn und Rumänen in TirguMuresvom Frühjahr 1990 vergessen, als rumänische Nationalisten ungarische Bürger zu Tode prügelten. Zwei der Toten sind ungarisch sprechende
Roma gewesen, darüber spreche aber niemand.
Die neugegründete Menschenrechtsgruppe .Junge Generation der Romanii" will im fernen Bukarest in Erfahrung gebracht haben, daß die Sicherheitsorgane einige „Randalierer" des Pogroms von Tirgu Mures zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt hätten - in der Mehrzahl Roma. Genaues wissen aber auch die Menschenrechtsaktivisten nicht. Ihre Arbeit beschränkt sich auf das Aufspüren offensichtlicher Willküraktionen. Geld für Rechtsschutz ist nicht vorhanden, es fehlt auch das Vertrauen und das Bewußtsein unter den Roma, durch Proteste und über den Rechtsweg zugefügtes Unrecht einzuklagen.
Jözsef und seine Freunde verstehen diese jungen Roma-Intellektuellen nicht. „Was die wollen, ist doch illusorisch. Wir sollen unter den Rumänen leben?" Der Schäfer lacht. „Ungarn und Rumänen kommen doch schon nicht miteinander klar, sollen wir uns da noch dazwischenstel-len?"
Die Nischen, die die Gesellschaft den Roma anbietet, seien keine Alternative zum harten Leben, das sie als Hirten führten. Nur weil sein Vater ein angesehener ungarischer Müller und Landwirt gewesen sei, dulde man ihn noch in Joseni, lasse man ihm auch seine Schafherde. Seine Kinder könnten dann zwar zur Schule, auch einmal im Dorfladen einkaufen, aber mit den anderen Kindern spielen, ob das die Eltern auch erlauben würden? Jözsef erinnert sich an die Zeit zurück, als er ein Schüler war. Auch er wollte nach der Schule mit den Nachbarkindern spielen. Aber was hatten die Kinder von den Erwachsenen gehört? Eine „alte Redewendung", die da lautet: „Von weitem ist auch der Zigeuner ein Mensch."
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!