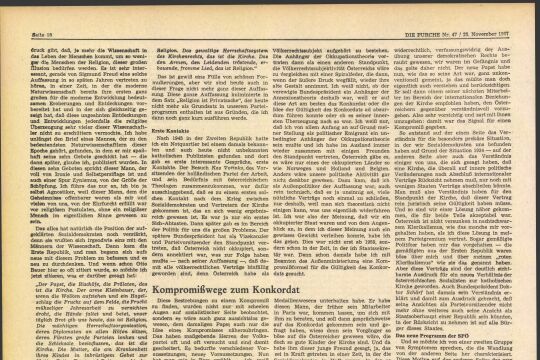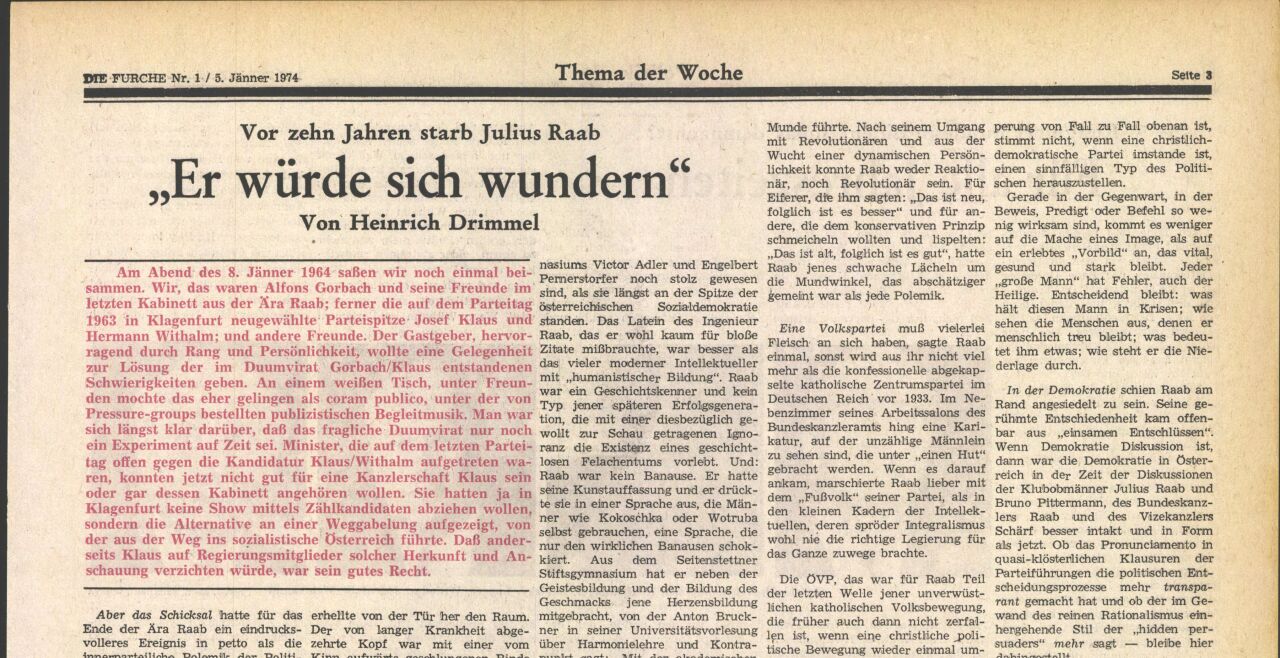
Vor zehn Jahren starb Julius Raab
Am Abend des 8. Jänner 1964 saßen wir noch einmal beisammen. Wir, das waren Alfons Gorbach und seine Freunde im letzten Kabinett aus der Ära Raab; ferner die auf dem Parteitag 1963 in Klagenfurt neugewählte Parteispitze Josef Klaus und Hermann Withalm; und andere Freunde. Der Gastgeber, hervorragend durch Rang und Persönlichkeit, wollte eine Gelegenheit zur Lösung der im Duumvirat Gorbäch/Klaus entstandenen Schwierigkeiten geben. An einem weißen Tisch, unter Freunden mochte das eher gelingen als coram publico, unter der von Pressure-groups bestellten publizistischen Begleitmusik. Man war sich längst klar darüber, daß das fragliche Duumvirat nur noch ein Experiment auf Zeit sei. Minister, die auf dem letzten Parteitag offen gegen die Kandidatur Klaus/Withalm aufgetreten waren, konnten jetzt nicht gut für eine Kanzlerschaft Klaus sein oder gar dessen Kabinett angehören wollen. Sie hatten ja in Klagenfurt keine Show mittels Zählkandidaten abziehen wollen, sondern die Alternative an einer Weggabelung aufgezeigt, von der aus der Weg ins sozialistische Österreich führte. Daß anderseits Klaus auf Regierungsmitglieder solcher Herkunft und Anschauung verzichten würde, war sein gutes Recht.
Am Abend des 8. Jänner 1964 saßen wir noch einmal beisammen. Wir, das waren Alfons Gorbach und seine Freunde im letzten Kabinett aus der Ära Raab; ferner die auf dem Parteitag 1963 in Klagenfurt neugewählte Parteispitze Josef Klaus und Hermann Withalm; und andere Freunde. Der Gastgeber, hervorragend durch Rang und Persönlichkeit, wollte eine Gelegenheit zur Lösung der im Duumvirat Gorbäch/Klaus entstandenen Schwierigkeiten geben. An einem weißen Tisch, unter Freunden mochte das eher gelingen als coram publico, unter der von Pressure-groups bestellten publizistischen Begleitmusik. Man war sich längst klar darüber, daß das fragliche Duumvirat nur noch ein Experiment auf Zeit sei. Minister, die auf dem letzten Parteitag offen gegen die Kandidatur Klaus/Withalm aufgetreten waren, konnten jetzt nicht gut für eine Kanzlerschaft Klaus sein oder gar dessen Kabinett angehören wollen. Sie hatten ja in Klagenfurt keine Show mittels Zählkandidaten abziehen wollen, sondern die Alternative an einer Weggabelung aufgezeigt, von der aus der Weg ins sozialistische Österreich führte. Daß anderseits Klaus auf Regierungsmitglieder solcher Herkunft und Anschauung verzichten würde, war sein gutes Recht.
Aber das Schicksal hatte für das Ende der Ära Raab ein eindrucksvolleres Ereignis in petto als die innerparteiliche Polemik der Politiker. Noch war nach Tisch das Gespräch nicht allgemein geworden, da kam Withaim mit der eben eingelangten Nachricht vom Tod Julius Raabs ins Zimmer. Wir gingen auseinander, um vom toten Kanzler an seinem Sterbebett im städtischen Krankenhaus Floridsdorf Abschied zu nehmen. Während der langen Fahrt auf das andere Donauufer kamen mir in einer Stunde wie dieser Erinnerungen: an Ärger und Enttäuschungen, die ich dem Kanzler verursacht hatte, der mich, einen unbekannten und parteilosen Beamten, in sein Kabinett gerufen hatte. An Konflikte, denen ein Unterrichtsminister inmitten der vorwiegend auf wirtschafts- und finanzpolitische Ziele ausgerichteten Regierungstätigkeit nicht ausweichen kann. Und an die Unruhe, mit der ich zuletzt den Kanzler gequält hatte, als anfangs der sechziger Jahre politische Kräfte auftauchten, die das Werk Julius Raabs ernstlich bedrohten.
Im Krankenhaus traf ich als letzter ein. Auf den Gängen hatte sich schon das öffentliche Leben des Ereignisses des Todes bemächtigt. Als ich in das Sterbezimmer trat, war es von Besuchern leer. In der Reihe der Spitalsbetten stand das Sterbebett als letztes neben dem Fenster, hinter dem eine schwarze Nacht war. Ein fast nur punktförmiges Nachtlicht erhellte von der Tür her den Raum. Der von langer Krankheit abgezehrte Kopf war mit einer vom Kinn aufwärts geschlungenen Binde fast verdeckt. Aber gegen das Nachtlicht zeichnete sich das Gesichtsprofil scharf ab. Es wirkte seltsam jung, so wie man es auf einem Bild des jungen Raab gesehen hat, das diesen als Sappeurleutnant in einer Grabenstellung zeigt. Das Gesicht des Toten zerstörte endgültig die Legende vom Bourgeois, vom Kleinbürger, vom Kapitalisten. Durch dieses willkürliche Image brach das geprägte, scharf konturierte Bild des Julius Raab.
Raab war kein Intellektueller. Als einen Reserveoffizier aus St. Pölten hatte der Ohefredakteur der „Arbeiter-Zeitung“, Oscar Pollak, einmal Raab charakterisieren wollen. Nur wenige haben aus diesem scheinbaren Kompliment des politischen Gegners die zweite Intention herauslesen können, die des intellektuellen Journalisten. Die scheinbare Tatsachenfeststellung Poilaks war nämlich ein Kontrastbild: Provinzielle Beengtheit anstatt weltstädtischer Weite, politische Ersatzreserve vom Land anstatt politischem Gardemaß.
Ein Intellektueller, ein Mensch, der seinem Verstand nicht gewachsen ist (Brockhaus, 1954), wollte Raab jedenfalls nicht sein. Er war ein gebildeter Mensch. An einem Stiftsgymnasium der Benediktiner hat er eine ausgezeichnete Bildung mit Vorkriegsqualität mitbekommen. Eine Bildung, auf die auch die Abiturienten des Wiener Schottengymnasiums Victor Adler und Engelbert Pernerstorfer noch stolz gewesen sind, als sie längst an der Spitze der österreichischen Sozialdemokratie standen. Das Latein des Ingenieur Raab, das er wohl kaum für bloße Zitate mißbrauchte, war besser als das vieler moderner Intellektueller mit „humanistischer Bildung“. Raab war ein Geschichtskenner und kein Typ jener späteren Erfolgsgeneration, die mit einer diesbezüglich gewollt zur Schau getragenen Ignoranz die Existenz eines geschichtlosen Felachentums vorlebt. Und: Raab war kein Banause. Er hatte seine Kunstauffassung und er drückte sie in einer Sprache aus, die Männer wie Kokoschka oder Wotruba selbst gebrauchen, eine Sprache, die nur den wirklichen Banausen schok-kiert. Aus dem Seitenstettner Stiftsgymnasium hat er neben der Geistesbildung und der Bildung des Geschmacks jene Herzensbildung mitgebracht, von der Anton Bruckner in seiner Universitätsvorlesung über Harmonielehre und Kontrapunkt sagt: „Mit der akademischen Bildung muß auch die Herzensbildung verbunden sein.“ So gesehen, war Raab ein gebildeter Mensch, kein Intellektueller in dem Sinn, wie er in den sechziger Jahren herausgestrichen wurde.
Katholisch, österreichisch, christlich-sozial und konservativ —, das war Julius Raab. Während seiner Studentenzeit hatte er die Regungen eines katholischen Integralismus erlebt und seither waren ihm Vertreter dieses Typs, die es in allen Gebieten gibt, unsympathisch. Sein unerschütterlicher religiöser Glaube, der zeitlebens die Experimente hektischer Reformen auf dogmatischen, rituellen und sonstigen Gebieten überstand, ließ die in seinem Inneren verlaufende Schwerpunktlinie seines Wesens ahnen, österreichisch, das war für Raab kein Produkt kurzlebiger legitimierender Staatsideen, auch nichts „Körperliches, nichts Nationales, nichts Politisches“ (Kurt von Sohuschnigg), sondern eine Eigenschaft, die sich an diesem Punkt der Erde in einem bestimmten Way-of-life exemplifiziert. Sozial, das verband sich bei ihm nicht mit .demokratisch“ zu einer sozialdemokratischen politischen Vorstellung; christlich und sozial gehörten für Raab deswegen zusammen, weil für ihn sein Glaube Kriterium seiner Entscheidungen war, ohne daß er diese Gläubigkeit allerweil im Munde führte. Nach seinem Umgang mit Revolutionären und aus der Wucht einer dynamischen Persönlichkeit konnte Raab weder Reaktionär, noch Revolutionär sein. Für Eiferer, die ihm sagten: „Das ist neu, folglich ist es besser“ und für andere, die dem konservativen Prinzip schmeicheln wollten und lispelten: „Das ist alt, folglich ist es gut“, hatte Raab jenes schwache Lächeln um die Mundwinkel, das abschätziger gemeint war als jede Polemik.
Eine Volkspartei muß vielerlei Fleisch an sich haben, sagte Raab einmal, sonst wird aus ihr nicht viel mehr als die konfessionelle abgekapselte katholische Zentrumspartei im Deutschen Reich vor 1933. Im Nebenzimmer seines Arbeitssalons des Bundeskanzleramts hing eine Karikatur, auf der unzählige Männlein zu sehen sind, die unter „einen Hut“ gebracht werden. Wenn es darauf ankam, marschierte Raab lieber mit dem „Fußvolk“ seiner Partei, als in den kleinen Kadern der Intellektuellen, deren spröder Integralismus wohl nie die richtige Legierung für das Ganze zuwege brachte.
Die ÖVP, das war für Raab Teil der letzten Welle jener unverwüstlichen katholischen Volksbewegung, die früher auch dann nicht zerfallen ist, wenn eine christliche politische Bewegung wieder einmal umschmiß. Raab, Gründer des Gewerbebundes (später Wirtschaftsbund) hat die Gesamtpartei immer gegen Versuche einer bündischen oder territorialen Zerstückelung verteidigt. „Weißt du, wer einer der größten Römer gewesen ist?“ fragte er mich einmal in einem unserer seltenen Gespräche zu zweit, um dann nach einigen Zügen aus der Virginia fortzufahren: „Quintus Fabius Maximus,der Cunctator, der mit seinem Zögern in der größten Gefahr Roms dem Staat die Armee erhalten hat, anstatt sie Hannibal zu opfern.“ Raab wollte seine Partei erhalten.
Immer wieder gewann der Kanzler für die „Raab-Partei“ die Stimmen derer, die selbst um keinen Preis „klerikal“ sein wollten; oder die von Österreich nie viel oder nichts mehr hielten; oder die keine Christlichsozialen, sondern Wirtschaftsliberale waren; oder die mit der Eigenschaft „konservativ“ nicht ihre Fortschrittlichkeit bekleckern wollten. Haben solche und andere Österreicher nur wegen einer Interessengemeinschaft für Raab gestimmt? Wohl kaum. Was sie mit1 einer Stimme für die „Raab-Partei“ honorierten, das war vor allem eine Persönlichkeit. Im Falle Raab wirkte die Verkörperung von Prinzipien vertrauenserweckend und überzeugend. Die Phrase, wonach der Sozialismus eher durch eine zeitneutrale Theorie, die christliche Demokratie, aber nur durch eine Verkörperung von Fall zu Fall obenan ist, stimmt nicht, wenn eine christlichdemokratische Partei imstande ist, einen sinnfälligen Typ des Politischen herauszustellen.
Gerade in der Gegenwart, in der Beweis, Predigt oder Befehl so wenig wirksam sind, kommt es weniger auf die Mache eines Image, als auf ein erlebtes „Vorbild“ an, das vital, gesund und stark bleibt. Jeder „große Mann“ hat Fehler, auch der Heilige. Entscheidend bleibt: was hält diesen Mann in Krisen; wie sehen die Menschen aus, denen er menschlich treu bleibt; was bedeutet ihm etwas; wie steht er die Niederlage durch.
In der Demokratie schien Raab am Rand angesiedelt zu sein. Seine gerühmte Entschiedenheit kam offenbar aus „einsamen Entschlüssen“. Wenn Demokratie Diskussion ist, dann war die Demokratie in Österreich in der Zeit der Diskussionen der Klubobmänner Julius Raab und Bruno Pittermann, des Bundeskanzlers Raab und des Vizekanzlers Schärf besser intakt und in Form als jetzt. Ob das Pronunciamento in quasi-klösterlichen Klausuren der Parteiführungen die politischen Ent-soheidungsprozesse mehr tronspa-rant gemacht hat und ob der im Gewand des reinen Rationalismus einhergehende Stil der „hidden per-suaders“ mehr sagt — bleibe hier dahingestellt.
Einmal haben die Reformer in der ÖVP deren Bundesparteileitung mit einem kühnen Vorschlag für eine Aktion vom Fleck weg überfallen. Es war bekannt, daß Raab für dieses Experiment nicht zu haben war. Die Debatte über diesen Punkt war letzter Punkt der Tagesordnung. Ohne selbst das Wort zu nehmen, führte Raab als Vorsitzender zwei Virginia lang mit größter Genauigkeit die Rednerliste. Merkte vor, hakte ab. Nachdem er die letzte Wortmeldung auf der Rednerliste gestrichen hatte, fragte er: „Noch eine Wortmeldung?“ Niemand meldete sich zu Wort, die Reformer hatten alles niedergeredet. Und Raab: „Die Debatte ist zu Ende.“ Nach nochmaliger Pause: „Dieser Punkt der Tagesordnung ist erledigt. Die Sitzung ist geschlossen.“ Sogleich überfielen die Männer mit dem Treppenwitz den Kanzler mit der Frage: „Ja — was geschieht?“ Und Raab: „Nichts.“ Darauf heftige Vorwürfe: „Aber wir haben doch deutlich genug geredet.“ Und wieder Raab: „Geredet wird viel. Ihr hättet aber den vorschlagen und wählen müssen, der zu den Roten geht und ihnen das anhängt, was ihr euch vorstellt.“ Raab behielt nicht nur recht, er hatte in diesem Fall recht.
Nach dem Tode Raabs begann der System- und Stilwechsel in der österreichischen Politik. Auch in der ÖVP erzeugten eine „ideologiefreie, emotionsfreie Sachgerechtigkeit“ der Technokraten und die Passionen der Vorhuten einer Neuen Linken ein richtiges Kauderwelsch. Politiker, deren Schwächen in der Mathematik Raab noch gekannt hatte, versuchten sich in einer mathematisie-renden Form des Politischen. Toleranz verwandelte sich in eine Angst, wonach „die anderen“ vielleicht doch recht haben könnten — und nicht wir. Die Ordnung in einem gestrafften Dialog der Gegner wurde ein flatternder Dialogismus. In einer „modernen Sachlichkeit“ wurde zuweilen Objektivität mit Standpunkt-losigkeit, Grundsatzbezogenheit mit ideologischer Voreingenommenheit verwechselt. Und all das ereignete sich in der zwar kurzen, aber folgenschweren Marx-Renaissance der späten sechziger Jahre.
Frau Hilde Figl wurde um die Zeit, als 1973 das Denkmal ihres Mannes enthüllt wurde, gefragt, was ihr Mann wohl zu den jetzigen Zuständen im Land sagen würde. Mit der gewohnten Zurückhaltung, in der die Frau des ersten Bundespartei-obmannes der ÖVP und Bundeskanzlers der Zweiten Republik an der Seite ihres Mannes gestanden war, sagte sie nur: „Er würde sich wundern.“ Raab würde sich auch wundern und sicher nicht an Grenzen halt machen, die Frau Figl taktvoll respektierte. Raab würde einiges sagen. Weil er uns unter allen Umständen, und heute nach wie vor, viel zu sagen hat.