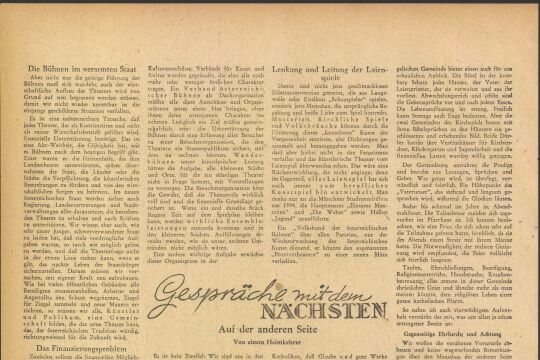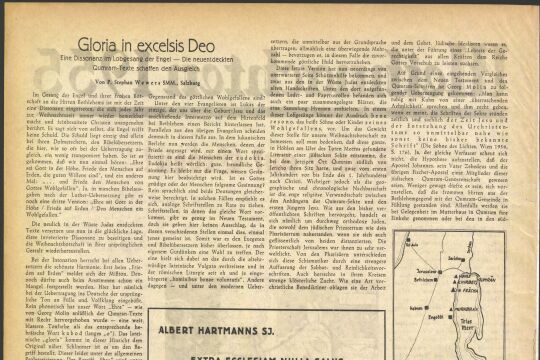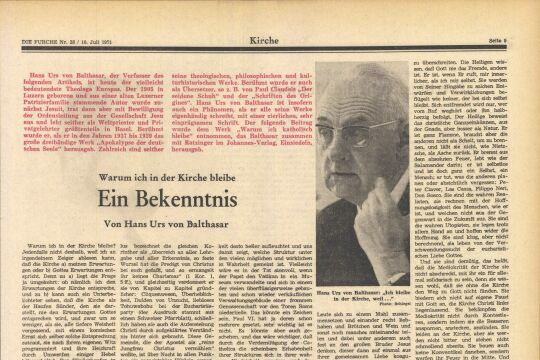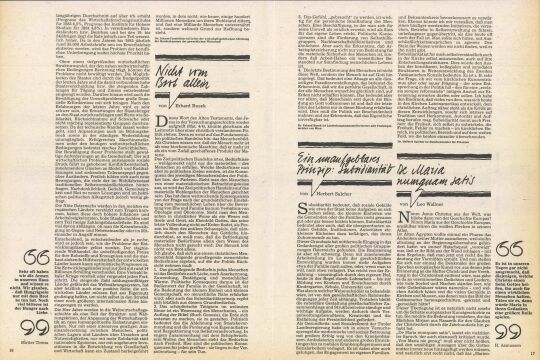Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Vorbild, nicht „Göttin“ !
Das evangelische Verständnis Mariens ist schon seit Luthers Kritik an der Mariologie seiner Zeit vor allem dies: evangelisch, also am Evangelium orientiert. Darin sind nun aber historische Fakten und theologische Aussage auseinanderzuhalten. Der historische Befund der Schrift ist knapp und ernüchternd. Maria spielt im Leben Jesu und während seines öffentlichen Wirkens eine völlig untergeordnete Rolle; sie wird kaum erwähnt, und wo dies der Fall ist, zählt sie offenbar zu jenen Verwandten, die den Weg Jesu nicht verstehen. Erst nach Tod und Auferstehung erwähnt die Apostelgeschichte sie als der
Jerusalemer Urgemeinde zugehörig (Apg 1). Diesem Befund entspricht auch, daß es in den frühen Gemeinden keine wie immer geartete Marienverehrung gab.
Paulus, dessen Briefe zu den ältesten Texten des Neuen Testaments gehören, kennt nichts, was als Ansatz einer Mariologie dienen könnte. Erst etwa zwei Jahrzehnte nach ihm werden die Kindheitsgeschichten des Matthäus- und Lukasevangeliums niedergeschrieben. In ihnen scheint Maria auf den ersten Blick eine wichtigere Rolle zu spielen, allerdings nur, wenn man die Texte als Tatsachenberichte liest und die theologische Intention ihres literarischen Musters verkennt.
Es lag den Autoren daran, die einzigartige Bedeutung Jesu durch einzigartige Umstände seiner Geburt und Kindheit klarzu-r machen und zugleich zu früheren Ereignissen der Heilsgeschichte in Beziehung zu setzen. All das ist nicht um Mariens willen geschrieben, sondern um den Fortgang und die Erfüllung der Verheißungen in Jesus zu betonen. Die besondere Rolle, die dabei Maria zufällt, liegt in der Linie der Mutter der Verheißung, wie Paulus Sara nennt (Gal 4), und entspricht ganz dem, was die Gerechten Israels seit Abraham waren: Wie diese ist Maria ein „Vorbild des Glaubens“ .
Weder Maria noch andere Heilige sind für evangelische Christen in irgendeiner Weise verächtlich oder irrelevant; als „Vorbilder des Glaubens“ verdienen sie höchsten Respekt und fordern zu eben jenem Glauben heraus. Sie sind Menschen wie wir, begnadete Menschen, und sie stehen mit uns auf der Seite der Menschen dem ganz anderen Gott gegenüber.
Die entscheidende Trennungslinie verläuft hier: zwischen Gott und Mensch, und wenn irgend etwas die zentrale Aussage der christlichen Botschaft genannt werden kann, so dies, daß niemand anderer als Jesus, der Christus, der menschgewordene Gott selbst, diese Trennungslinie überschritten hat. Es gibt keinen Mittler als ihn. Die Vorstellung eines himmlischen Hofstaats, in dem manche an der Macht des Souveräns mehr Anteil haben und daher für minder in der Gunst Stehende fürbitten können, widerspricht dieser zentralen, unbestrittenen christlichen Glaubenswahrheit; damit grundsätzlich unvereinbar ist aber die Hochstilisierung Mariens zur „Miterlöserin“ und „Mittlerin aller Gnaden“ .
Tendenzen zu einer Marienverehrung dieser Art sind sehr alt und können ihr „heidnisches“ Interesse bis heute nicht verleugnen. „Heidnisch“ meint hier keineswegs areligiös, sondern gerade
natürlich-religiös: In der gängigen Marienverehrung und ihrer theologischen Legitimierung drohte und droht, wie sehr auch stets in Abrede gestellt, eine Erhebung des Natürlichen ins Göttliche: der Mensch, der weibliche Mensch, Jungfräulichkeit und Mutterschaft scheinen an und für sich mit göttlichen Qualitäten ausgestattet. Es ist daher kein Wunder, daß alle Versuche einer Neubelebung natürlicher Religiosität der Marienverehrung durchaus zugetan sind, die tausend Bilder des Novalis ebenso, wie die Hymne an das Weibliche des Teilhard de Chardin, oder die Anrufung der Mater gloriosa „Jungfrau, Mutter, Königin, Göttin, bleibe gnädig“ , mit der Goethe den Faust II beschließt, unmittelbar bevor er uns durch „das Ewigweibliche“ hinangezogen werden läßt.
Wo die Apotheose des Menschen und seiner Natur in den Vordergrund tritt, wird seine Rolle als demütiger Zeuge des Glaubens leicht übersehen. Das geht nicht ohne soziale Folgen im Raum der Kirche ab. Das Papsttum war seit jeher ein großer Förderer der Marienverehrung; ihr wurden immer wieder Siege über Ketzer und Andersgläubige zuge-
schrieben. Und wenn man liest, daß der römisch-katholische Dogmatiker Matthias Joseph Scheeben (1873) die unbefleckte Empfängnis Mariens und die Unfehlbarkeit des Papstes auf eine Ebene stellte, nämlich wie „Morgenstern“ und „Abendstern“ als Trabanten der „Sonne Christus“ , so erheben sich doch Bedenken: Sollte zwischen der „Heiligen Mutter“ und dem „Heiligen Vater“ , wie sich der Papst immer noch anreden läßt (vgl. dagegen Mt 23), eine Beziehung bestehen?
Ist es nicht bedenkenswert, daß Hoch-Zeiten der Marienverehrung für die real lebenden Frauen nicht gerade die besten waren? Daß die berüchtigten Verfasser des „Hexenhammers“ (Jakob
Sprenger, Heinrich Institoris, 1486) sich als glühende Marienverehrer bekannt haben? Und daß in der römisch-katholischen Kirche, in der gerade jetzt wieder die Marienverehrung forciert wird, den Frauen die volle Gemeinsamkeit mit den Männern im Dienst für das Evangelium vorenthalten wird, während in den Kirchen der Reformation die geistliche Amtsträgerin immer mehr zur Selbstverständlichkeit wird? Hier gewinnt die Marienverehrung auch im Zusammenhang mit einer sinnvoll verstandenen feministischen Theologie einen sehr aktuellen Aspekt.
Andererseits ist uns die biblische Mutter Maria näher als das, was die Tradition aus ihr gemacht įat. Sie ist eine Frau, die mit all dem Unerklärlichen um ihr Kind fertig werden muß, die sich erst sehr spät seinen Jüngern anschließt, eine Frau, die erfahren mußte, daß die natürlichen weiblichen Fähigkeiten des Empfan- gens und Gebarens in der Nachfolge Jesu gerade nicht zählen; eine Frau also, die zum Vorbild des Glaubens wurde, nicht der Mutterschaft oder Jungfräulichkeit, und damit - wie es Luther sah — zum tröstlichen Exempel des durch Christus erlösten Menschen.
Zugleich beglaubigt sie als die Mutter Jesu, daß der Gottessohn wahrer Mensch ist, so daß alle menschlichen Versuche, sich durch asketische Leistungen, durch Mittlerfiguren und Hierarchien zu Gott hinaufzuarbeiten, nutzlos und ein für allemal überholt sind. Eine solche Frau, die
gleichrangig neben den männlichen Glaubenszeugen der Geschichte steht, kommt auch einem wohlverstandenen feministischen Interesse näher, dem es um das tatsächliche Leben der Christinnen in ihren Kirchen heute geht.
So, als Mutter der erfüllten Verheißung und Vorbild des Glaubens, sollte Maria vielleicht auch
in den Kirchen der Reformation allen Abgrenzungsbedürfnissen zum Trotz wieder stärker in den Blick kommen. Ohne römische Äußerungen wie die jüngste Enzyklika und die Feier eines Marianischen Jahres würde uns das freilich leichter fallen.
Die Autorin ist Vorstand des Instituts für Religionspädagogik an der Evangelisch- Theologischen Fakultät der Universität Wien.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!