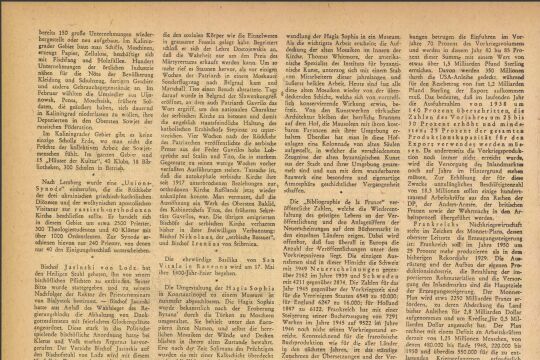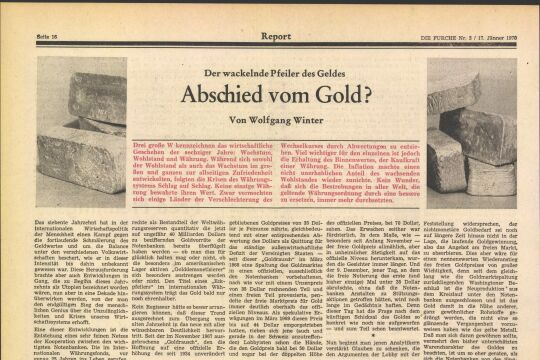Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Warum der Dollar immer weiter fällt
Wäre nicht das Uberschreiten einer Reizschwelle zu befürchten, könnte man den seit Monaten anhaltenden Wertverfall des amerikanischen Dollar als halb so schlimm bezeichnen. Jene, die dabei draufzahlen, werden aber wahrscheinlich irgendwann einmal genug haben und Konsequenzen ziehen.
Zuerst dürfte das Faß vermutlich bei den Erdölstaaten überlaufen, die für ihr „schwarzes Gold“ von den Amerikanern täglich noch wertlosere Dollars. erhalten. Sie drohen zwar schon lange, die ölrechnungen künftig in einer anderen (künstlichen) Währung als dem Dollar auszustellen, ohne daß aber damit bisher Ernst gemacht worden wäre. In jüngster Zeit spricht jedoch einiges dafür, daß allmählich Ernst gemacht wird.
Vor diesem Hintergrund gewinnen die an sich schon alten Drohungen der Scheichs, das Barrel öl bald nur noch gegen ein wohlsortiertes Bündel verschiedener Währungen zu verkaufen, plötzlich neue Brisanz. Mit dieser Umstellung - womöglich bei gleichzeitiger Anhebung des Ölpreises - könnte die Dollar-Talfahrt sicher wirkungsvoll gebremst werden.
Dann müßten die USA zur Bezahlung neuer öllieferungen jedesmal das Währungsbündel zusammenkaufen (es wird mit fallender Dollarnotierung immer teurer), also mehr Dollars pro Faß öl an die Lieferanten überweisen. An diesem Punkt fände das Interesse der Carter-Administration an der fortgesetzten Dollar-Abwertung voraussichtlich sein jähes Ende.
Dann würde man zunächst den Dollar „stützen“ müssen - ein Unterfangen, das heute nur noch die Amerikaner selber vermögen. Immerhin haben es die Notenbanken der Deutschen, Schweizer und Japaner ja versucht: Mit Milliardenbeträgen aus ihren Währungsreserven kauften sie Dollars auf, um so den Kurs zu stabilisieren. Umsonst: Der Dollar ist auch über diese Barrikaden gestürzt, seit einiger Zeit sehen die Notenbanken dieser „Aufwertungsländer“ daher ziemlich tatenlos zu, wie er weiter fällt.
Bleiben als Feuerwehr noch jene, die von Anfang an kaum etwas gegen das Absacken dieser ausgedienten Weltwährung unternommen haben - die Amerikaner selbst.
Sie können ebenfalls an den Devisenbörsen der Welt soviel der eigenen Währung aufkaufen, bis das Angebot merklich knapper wird und der Preis für den Dollar zwangsläufig steigt. Diese „Interventionen“ sind jedoch ein teures Unterfangen, denn um billige Dollars zu kaufen, muß man wertvolle Mark, Yen oder Franken aus den heimischen Tresoren nehmen. Auf diese Weise läßt sich jeder Wechselkurs - theoretisch jedenfalls - beliebig fixieren, man muß nur genügend (fremdes) Geld (das mit Exporten erst verdient sein will) dafür aufwenden.
Daß diese Politik keine Dauerlösung sein kann, leuchtet ein: Devisenreserven gelten unter Ökonomen wie Politikern als sehr kostbare Rücklagen.
Ein Land ohne nennenswerte Devisenreserven gleicht einem Unternehmen ohne Eigenkapital: Beide haben kein Geld und bekommen deswegen auch keinen Kredit. Abgesehen davon, wirken diese Interventionen zusätzlich noch indirekt: Die Welt sieht, daß etwas getan wird, den Dollar zu stützen, womit das Vertrauen in diese Währung automatisch steigt.
Als echte Lösung der Misere bleibt letztlich also nur das von den Amerikanern seit Beginn der Dollarprobleme hartnäckig ignorierte Patentrezept: Vor der eigenen Türe zu kehren, anstatt auf fremden Devisenmärkten intervenieren zu lassen - also die Sanierung der eigenen Wirtschaft, insbesondere der durch riesige ölimporte belasteten Handelsbilanz.
An diesbezüglichen Ankündigungen mangelt es auch nicht; Präsident Carter ließ kein Gipfeltreffen der jün-sten Zeit vorbeigehen, ohne die Welt nachhaltiger amerikanischer Bemühungen zu versichern.
Was die solcherart versicherte Welt-repräsentiert von Notenbanken, Devisenhändlern und Anlegern - von diesen Statements hält, hat sie Ende Juli nach dem Bonner Gipfel augenfällig dokumentiert. Noch hatte Washington das, offizielle Kommunique über das Treffen der sieben wichtigsten westlichen Staatsmänner nicht herausgegeben, da purzelte der Dollar schon wieder. So sensibel Devisenbörsen auf hoffnungsvolle Äußerungen von Politikern wie Carter oder Schmidt reagieren, so enttäuscht geben sich die Devisenhändler, wenn die Politikerworte nur hohl gewesen sind.
Daß die ölländer entschlossen sind, den Dollar nicht mehr als „ihre“ Währung anzuerkennen, scheint allmählich plausibel. Kurze Zeit nach dem ölpreisschock des Jahres 1974 waren Einnahmeausfälle aus dem Kursrückgang des Dollar jedenfalls leichter zu verkraften gewesen als heute. Damals bescherte der überreiche Geldsegen den Scheichs am ölhahn zunächst sogar das gegenteilige Problem: zu hohe Einnahmen. Geld war massenhaft vorhanden, aber sie konnten es nicht schnell genug in Straßen und Fabriken verwandeln.
Rückstände im Lebensstandard lassen sich auch mit Unsummen Geldes eben nicht über Nacht aufholen. Die damals „vagabundierenden Petrodollars“ kennzeichneten die Anlageprobleme der ölländer. Von Wertsicherung der Gelder, die plötzlich hereinströmten, war hingegen nicht die Rede.
Heute ist der Schock aber auf beiden Seiten verkraftet, die ölverbraucher haben sich an den neuen Preis längst gewöhnt und die Lieferanten klagen zumindest nicht mehr über1 Anlageschwierigkeiten ihrer Dollarmilliarden. Sie können - und müssen - sich allmählich der Wertsicherung ihrer Einnahmen zuwenden.
Schließlich zehrt nicht nur die immer noch tiefere Wert-Notierung der US-Währung an den öleinnahmen, sondern auch die Inflation in den westlichen Industriestaaten, allen voran in den Vereinigten Staaten. Im Sog der Inflation steigen die Preise der Produkte und Maschinen, die die ölländer zur Industrialisierung dringend benötigen, gleichermaßen.
Wer nun immer schuld sein mag: Die notwendigen Energiesparmaßnahmen der Amerikaner stehen im wesentlichen bis heute noch aus; Erdöl wird nach wie vor in Riesenmengen eingeführt, womit die Hauptursache für das Loch in der amerikanischen Handelsbilanz offen bleibt. Glaubhafte Erfolge wurden auch an der Inflationsfront nicht errungen, ganz im Gegensatz zu Deutschland oder der Schweiz. Die Beurteilung dieser Politik findet sich nun einmal in den Kursnotierungen der Devisenbörsen.
Daß es mit dem Dollar überhaupt so weit kommen konnte, hat seinen Grund unter anderem in der weitgehenden wirtschaftlichen Autarkie der USA. Wenn man vom Erdöl absieht, sind die Vereinigten Staaten in der Versorgung mit den notwendigen Gütern kaum vom Ausland abhängig. Gemessen an der Größe des Wirt-schaftsraurries, ist daher auch der Außenhandel unbedeutend. Die Importe, die sich mit jedem Dollar-Kurs-Verlust von neuem verteuern, fallen nicht so stark ins Gewicht, daß sie die amerikanische Inflation gefährlich anfachen könnten. Das Abwertungsrisiko, das alle anderen westlichen Länder eingingen, droht dem Amerikanern jedenfalls nicht. Und das wissen sie auch.
Präsident Carter kann sich diese Politik des billigen Dollars eben leisten. In seinem Land dreht sich die Inflationsspirale durch den Dollar-Verfall nicht spürbar schneller als bei stabiler Währung; ein unpopulärer Präsident kann den Welthandel zum Mißfallen der betroffenen Nichtamerikaner umschichten - weil er es sich nicht leisten kann, unpopuläre Energiesparprogramme durchzuboxen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!